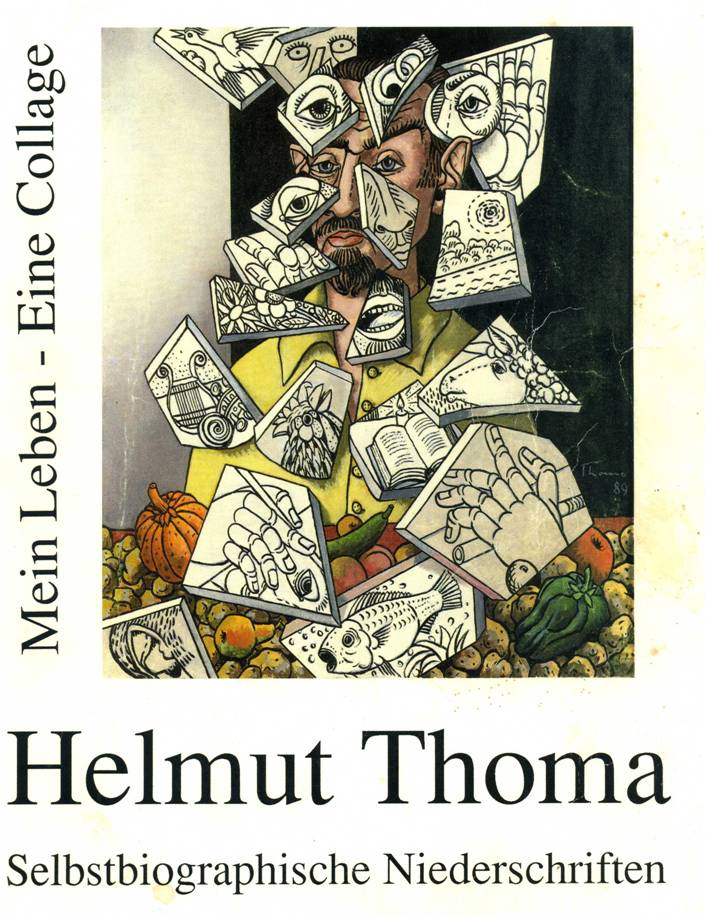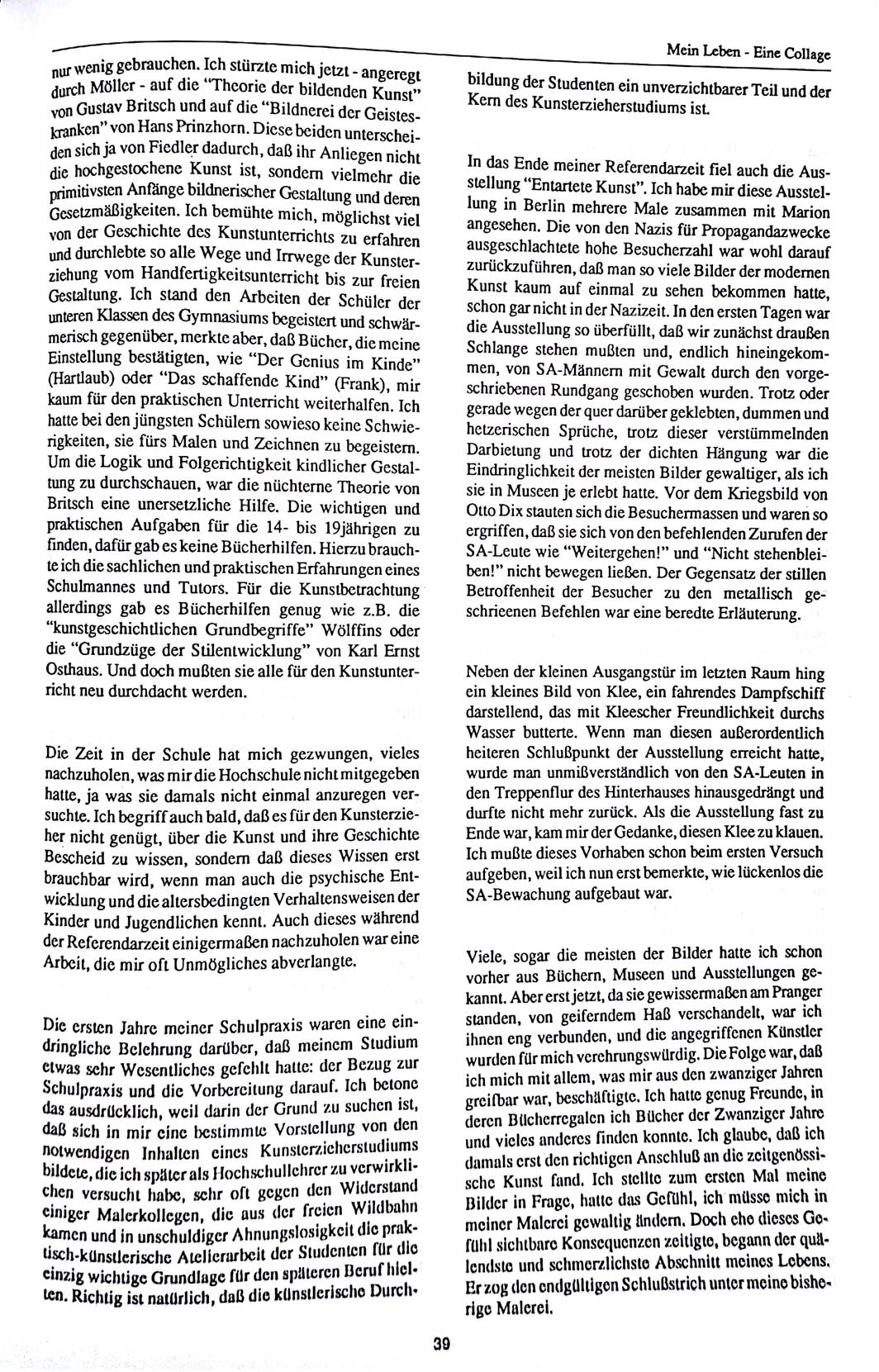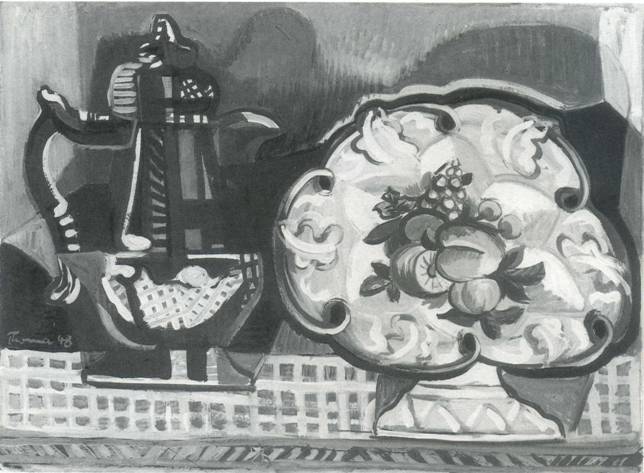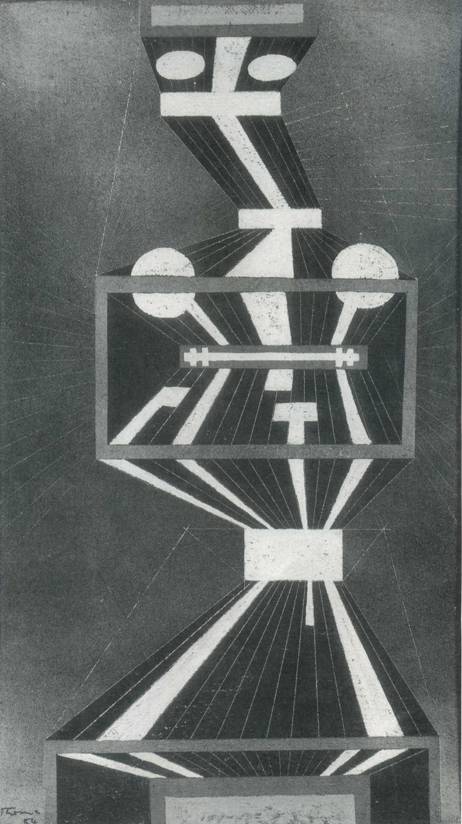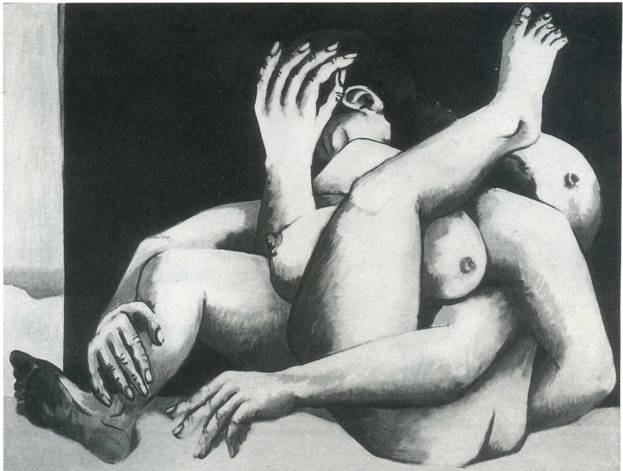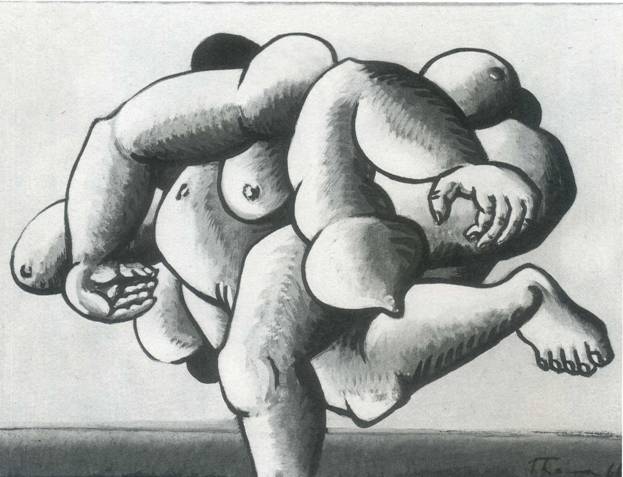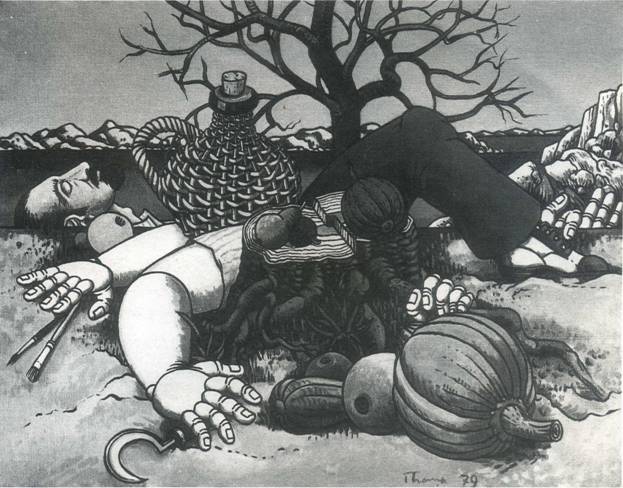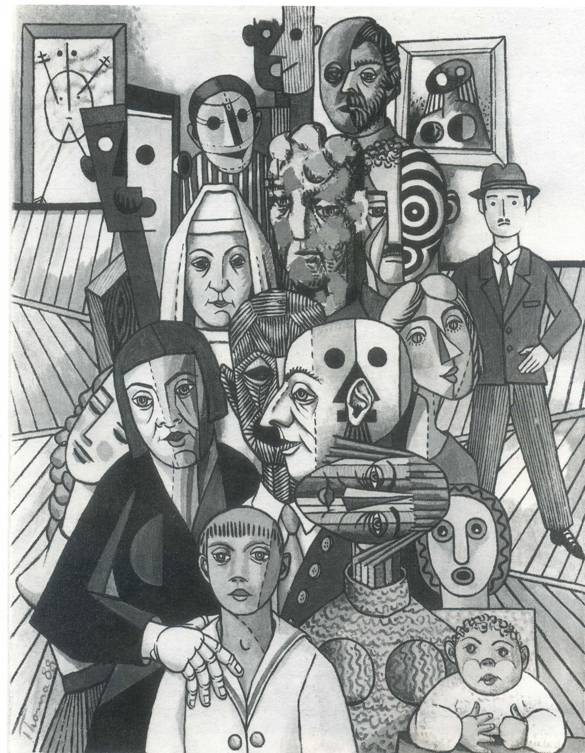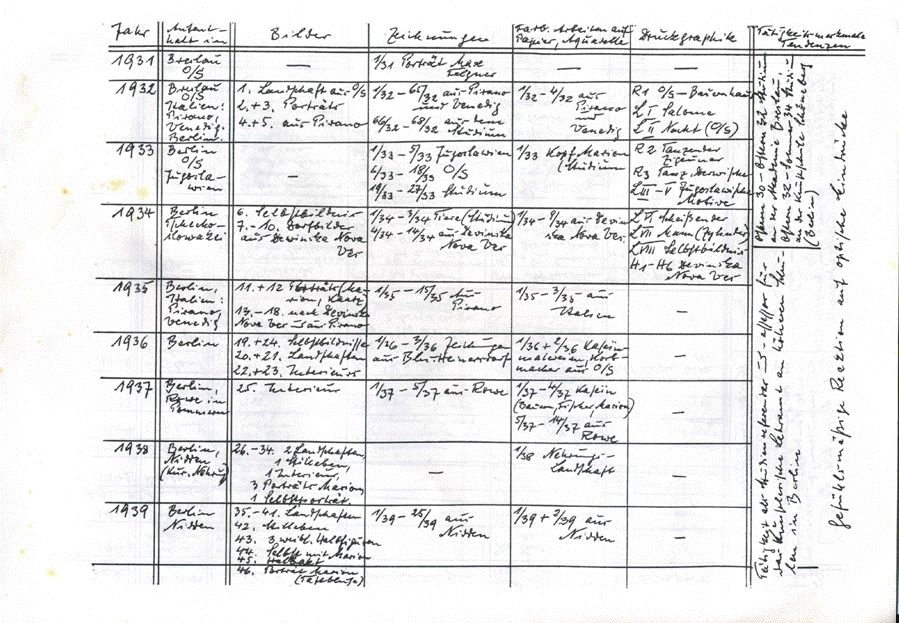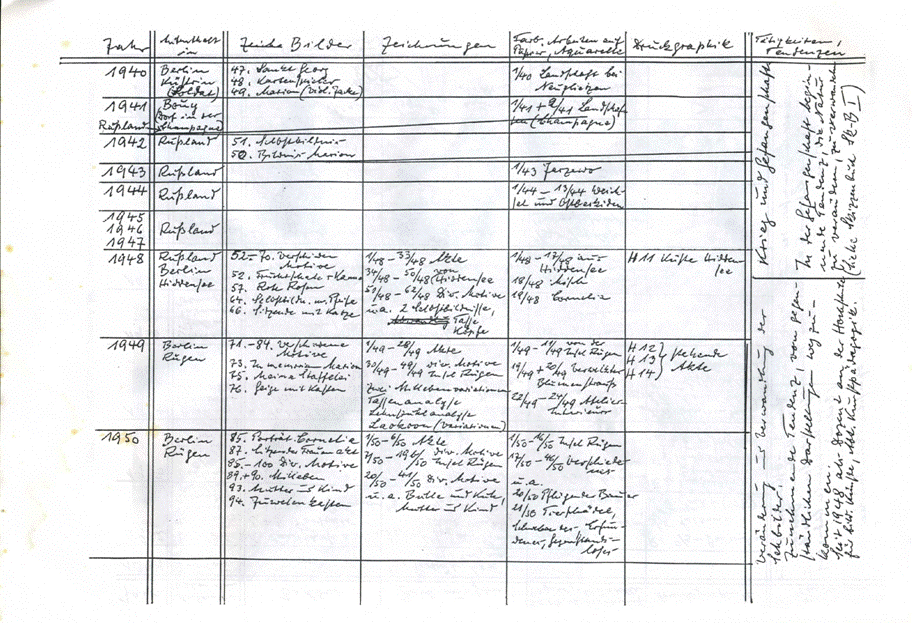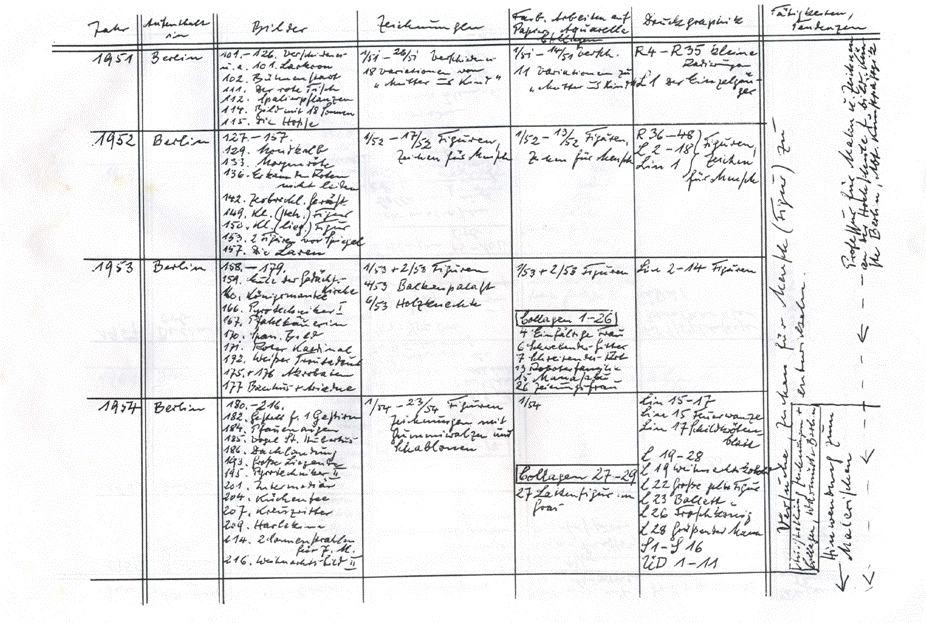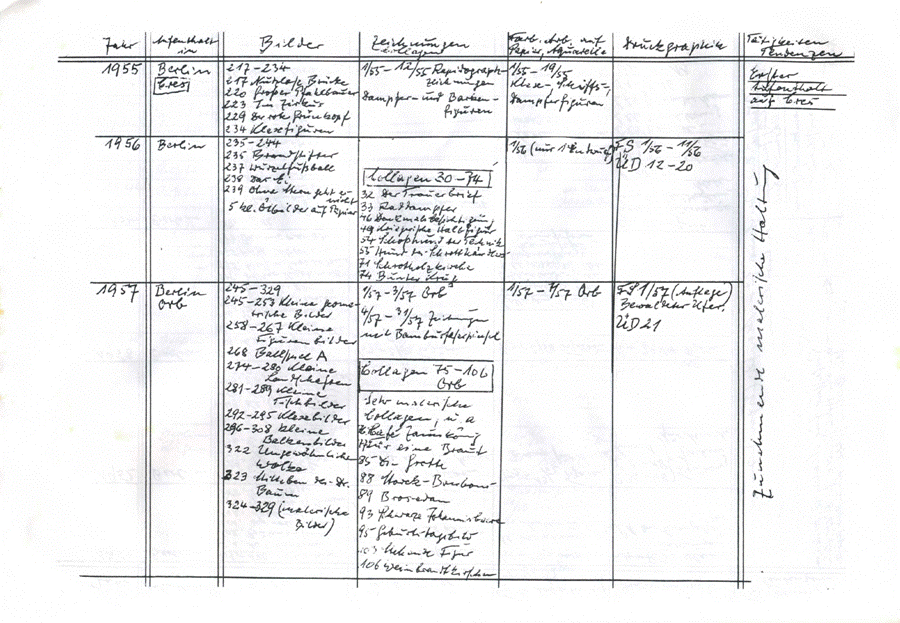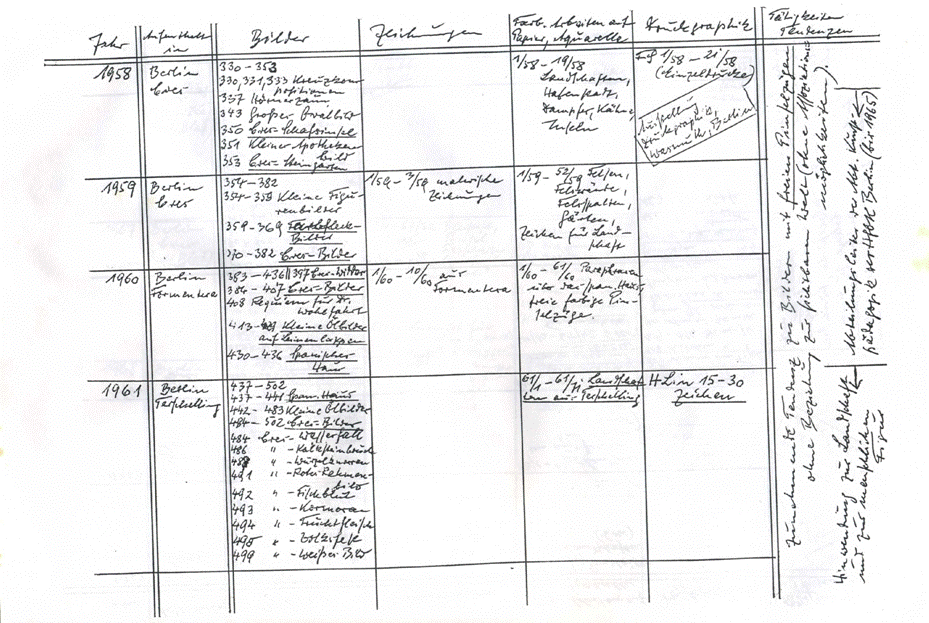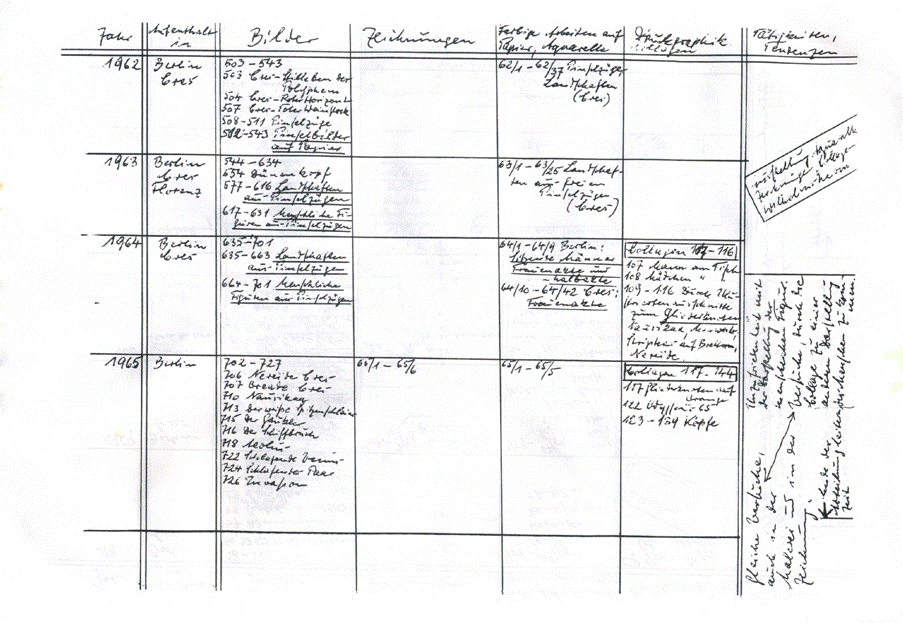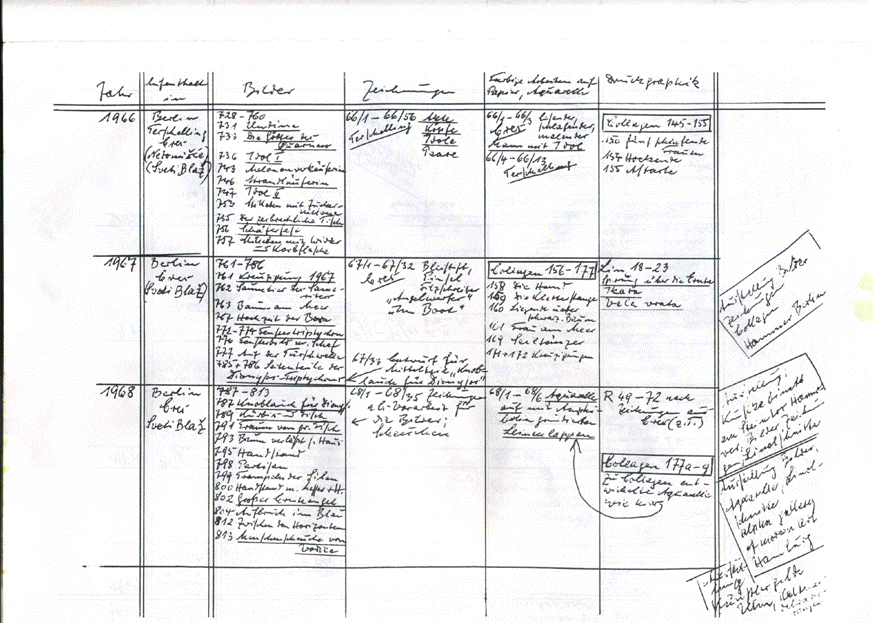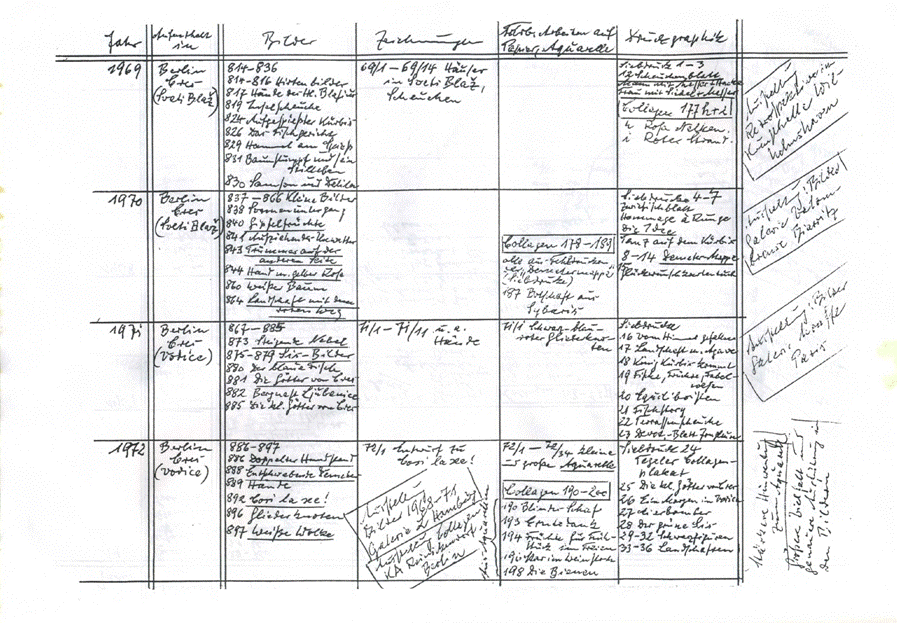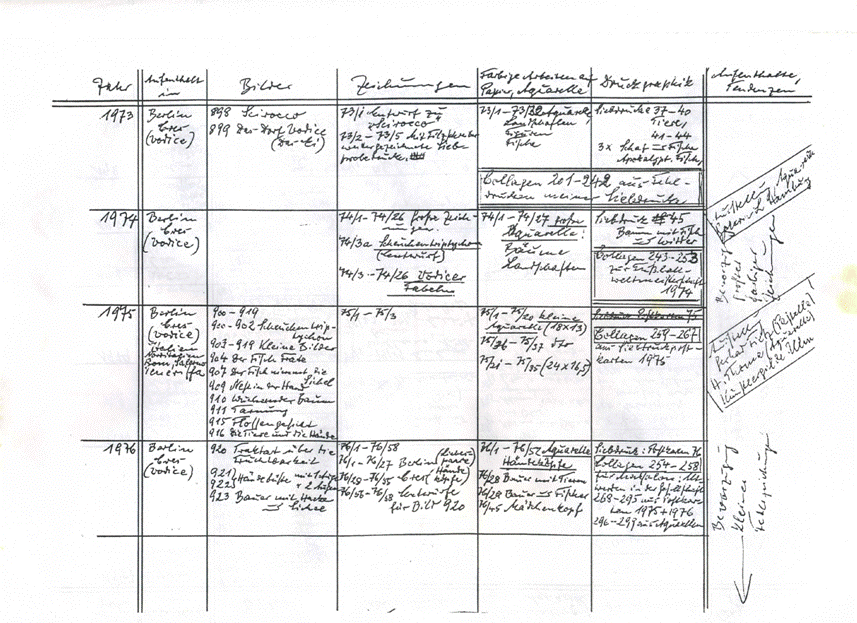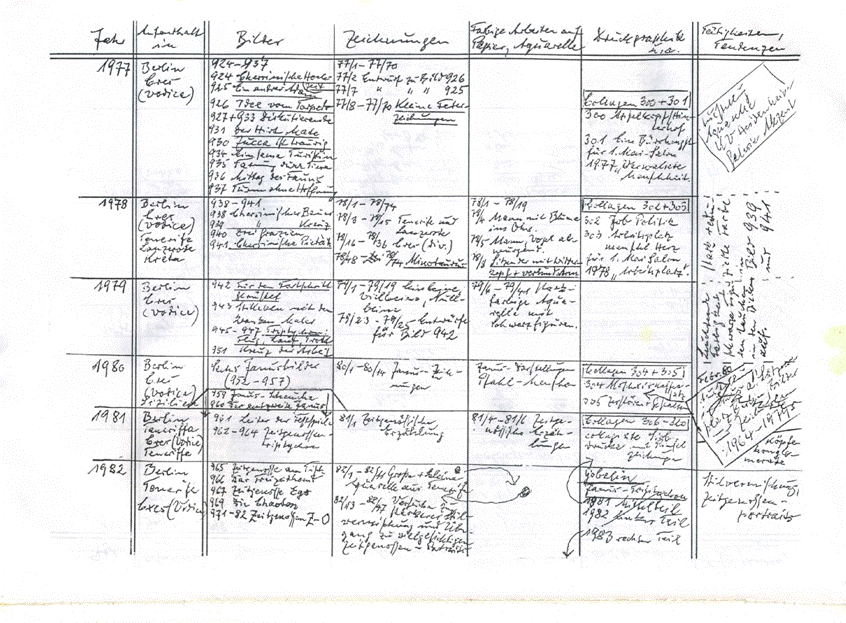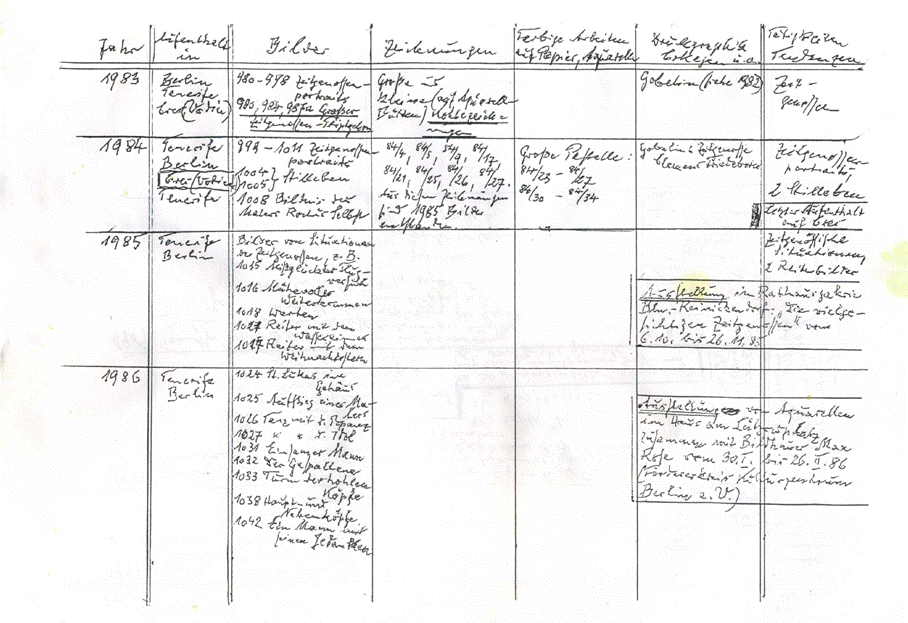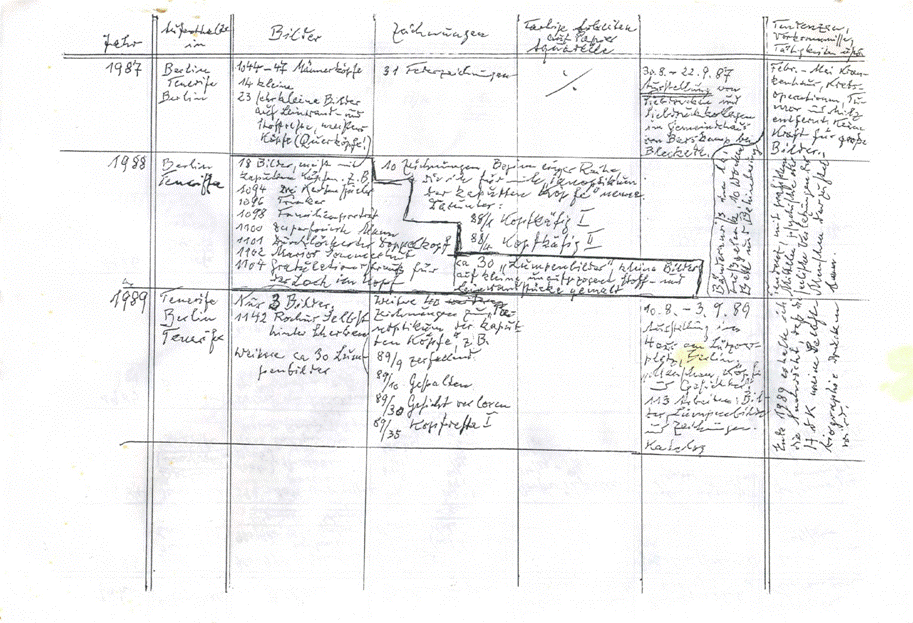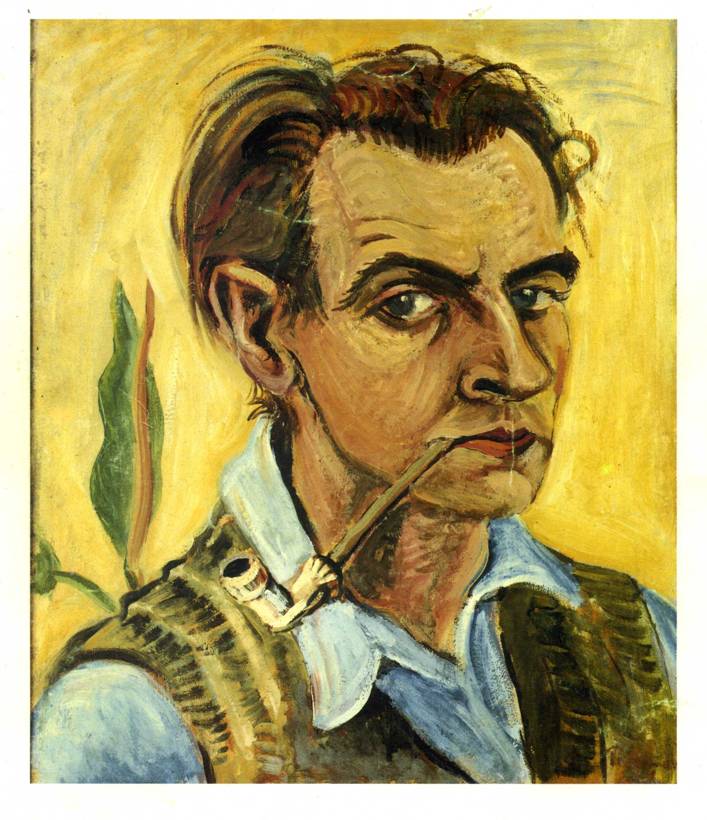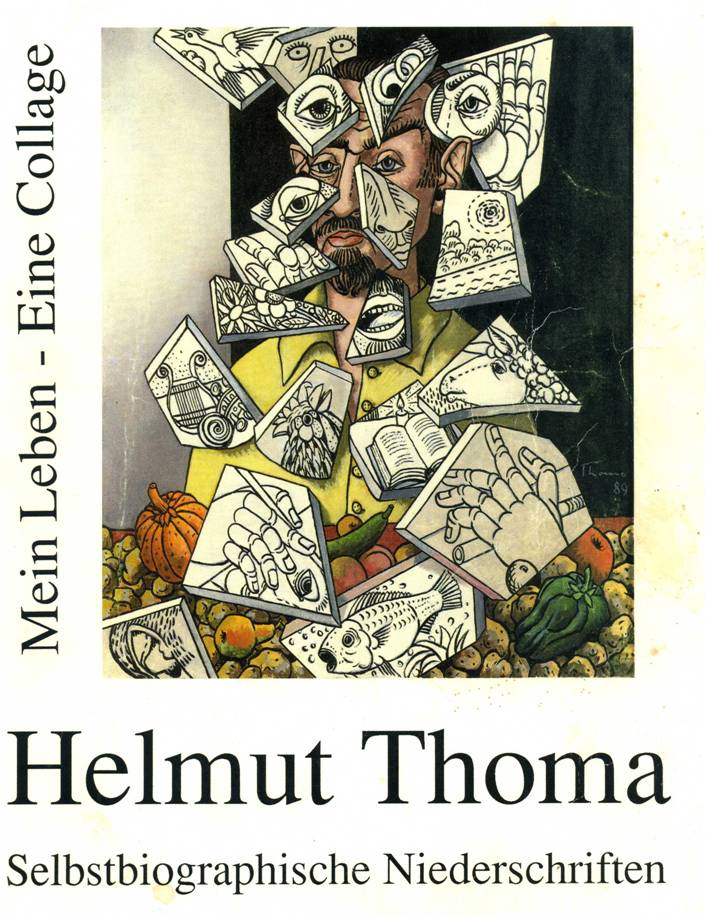
Helmut Thoma
Mein Leben - eine Collage
Selbstbiographische Niederschriften
Entstanden 1979 - 1984 Mit
einem Nachtrag von 1990
Inhalt
Vorwort. 4
Kindheit. 8
Höhere Schule. 31
Studium.. 40
Schuldienst. 60
Krieg und Gefangenschaft. 76
Heimkehr. 99
Teneriffa (Nachtrag von 1990) 199
Bibliographie. 209
Verzeichnis der abgebildeten Bilder und Zeichnungen. 210
Rückseite des Einbandes. 244
Weitere Links. 245
Dies ist ein Nachdruck der originalen Ausgabe von
1991,
der von
Ulrich Thoma neu formatiert und als Webseite
angepasst
wurde. Bei Interesse an weiteren Informationen
kontaktieren
Sie mich bitte gerne über die folgende Seite
www.hausbernstein.de
Bilder von
Helmut Thoma können Sie
über die
Helmut-Thoma-Stiftung
an der
Universität
der Künste Berlin
erwerben
www.helmut-thoma-stiftung.de
Weitere
Informationen erhalten Sie bei
Herrn Josef
Petry
e-mail
j.petry@gmx.de
und
Prof. Dr.
Otfried Scholz, Tel.: 030 31 85 25 14
Impressum
Thoma, Helmut: Mein Leben - eine Collage:
selbstbiographische Niederschriften, entstanden 1979-1984. Mit einem Nachtrag
von 1990
Herausgegeben
von der Hochschule der Künste Berlin im Auftrag des Präsidenten HdK-Pressestelle , verantwortlich Susanne S. Reich Redaktion:
Dr. Christine Fischer-Defoy, Dr. Otfried Scholz . Layout: Prof. Heinz-Jürgen
Kristahn 1 Gestaltung: Petra Rose Repros: Wolfgang Schumann Druck:
Weinert GmbH ISBN-Nr.: 3-89462-005-6
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Thoma, Helmut:
Mein Leben -
eine Collage : selbstbiographische Niederschriften,
entstanden 1979 - 1984. Mit einem Nachtrag von 1990 / Helmut Thoma. [Hochschule
der Künste, Berlin]. - Berlin : Hochsch. der Künste, 1991 ISBN 3-89462-005-6
Liegt dir Gestern klar und
offen,
wirkst du heute kräftig frei
(Goethe)
Vorwort
Schreiben ist nicht mein Metier. Aber ich schreibe ganz gern Briefe, und
dabei merke ich immer wieder, daß mich auch das geschriebene Wort anregen und
mitreißen kann, so daß ich mich in einen leichthin angedeuteten Gedanken oder
Einfall verwickeln lasse und der Brief dann länger wird, als sein ursprünglich
sachlicher Zweck erfordert hätte. Als meine Absicht feststand, über mein Leben
zu schreiben, wollte ich zunächst nur abschnittweise, aber nicht chronologisch
vorgehen und nur kurze, auf Briefeslänge beschränkte Niederschriften
anfertigen, .die dann später geordnet, in Kapiteln zusammengefaßt und zum
Schluß noch einmal überarbeitet werden sollten. Ich wollte anfangs möglichst
viele Gegebenheiten, Lebenslagen, Ereignisse, Zufälle, Zwänge, Erlebnisse,
Hindernisse, Förderungen, Beziehungen, Freundschaften, Vorlieben, Freuden,
Ärgernisse, Verluste, Glücksfälle, Nöte, Ängste, Gedanken, Meinungen usw.
schildern, die in die Bahn meines Lebens eingewebt waren und mich
wahrscheinlich dorthin geschoben haben, wo ich heute bin. Ich werde aber
versuchen müssen, mich auf Wesentliches und Entscheidendes zu beschränken. Und
da ich seit meinem 21. Lebensjahr mit Haut und Haar Maler bin, wird
notwendigerweise allerlei hervorgehoben werden müssen, was mich als Maler
beeinflußt, gefördert, behindert, geleitet, verführt, begeistert, verunsichert
oder gefestigt hat.
Ich habe immer sehr
fleißig gemalt, jedenfalls habe ich fast meine gesamte "Freizeit" in
die Malerei gesteckt, und mir ist bis heute nur mäßiger Erfolg beschieden
gewesen. Meine Begeisterung für das Malen hat sich aber nicht vermindert.
Mein Trieb zum Malen liegt
im Dunkel. Woher kommt er? Ich kenne keinen Vorfahren, der eine bildnerische
Begabung gehabt hat. Allerdings gab es viele, die ein Instrument spielten, zwei
leiteten sogar die Dorfkapelle. Die Anregungen in meiner Heimatstadt Neisse waren
gering, besonders auf dem Gebiet der bildenden Kunst.
Warum habe ich mich so spät, erst kurz vor dem Abitur, für die Kunst
entschieden? Eine Frage, die der Lebenslauf, den ich hier schreiben will,
sicher auch nicht ganz beantworten wird. Man kann ihm vielleicht einiges
entnehmen, das dazu beiträgt, meine Bilder und ihr Zustandekommen besser zu
verstehen. Mein Leben hat sicher diesen Bildern gewisse Charakteristika, Modifizierungen,
eine Richtung, eine Mentalität oder ähnliches aufgestempelt, derentwegen sie
oder ich getadelt oder geschätzt werden.
Generationsbedingte
Einflüsse, nationale, landes- und weltpolitische oder auch nur regionale
Einflüsse hat mein Lebenslauf mit vielen anderen gemeinsam. Meine Generation
hat vier verschiedene Staatsformen durchlebt und zwei Weltkriege überstehen
müssen, einen in der Kindheit, den anderen im besten Mannesalter. Auch das
gehört zu meinem persönlichen Leben.
Vieles aus meinem Leben in
den 30er Jahren läßt sich aus meinen wenigen noch vorhandenen Bildern dieser
Zeit bis zu einem gewissen Grade ablesen oder wenigstens erahnen, weil diese
Bilder nicht verschlüsselt sind. So ist z.B. mein Verhältnis zu meiner ersten
Frau Marion unschwer zu erkennen, weil einige Bildnisse erhalten sind. Über
meine zweite Frau Cornelia ist nichts aus meinen Bildern zu erfahren. Das
einzige Bildnis, das ich nach ihr malte, ist mit Gestaltungsproblemen
überlagert. Es taugt nicht dazu, Cornelias Bedeutung für mein Leben und meine
Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch nur ahnen zu lassen.
Ich schreibe in der Ungewißheit, ob diese autobiographische
Niederschrift eines Tages effektiv werden kann. Ich handele impulsiv, aus einer
Emotion heraus, und weil ich meine, daß ich der Aussagefähigkeit meiner Bilder
noch etwas hinzuzufügen habe.
Diese Hinzufügung ist natürlich für die Bilder nicht wesentlich. Sie kann
aber gewisse Hinweise geben, warum der Gegenstand in meinen Bildern zunächst
große Bedeutung hatte, sich dann stark veränderte (immer verglichen mit dem
Sehbild), schließlich ganz verschwand und ungegenständlichen Formen und Linien
wich, dann wieder auftaucht in einer Art und Weise, die vielen unverständlich
erscheint und meine Bilder nicht in die heute vorhandenen Kunstströmungen
einordnen läßt. Gott sei Dank! oder: Gott sei's geklagt!
Mein Leben war
notwendigerweise durch manche äußeren Umstände stets von mir so eingerichtet
worden, daß ich nicht vom Verkauf meiner Bilder abhängig war. Mit meinen
Bildern hausieren zu gehen, war stets mir zuwider. Ich habe mein Leben lang
immer zwei Berufe gehabt, das Malen, ohne das ich nicht leben kann, und den
Broterwerb als Studienrat und als Hochschullehrer. Seit meiner Emeritierung
(1974) bin ich endlich vom Broterwerb befreit. Ich habe jetzt ein Leben, wie es
sich jeder Maler wünscht: Geld genug zum Leben und Zeit genug zum Malen.
Endlich kann ich so leben und arbeiten, wie ich es mir seit meinem 21.
Lebensjahr nur vorstellen konnte, vielleicht zu spät, vielleicht noch
rechtzeitig genug. Warten wir es ab! Vielleicht läßt mir das Schicksal noch
genügend Zeit.
Auf jeden Fall hat die
Zeit bis heute gereicht, diese autobiographischen Notizen bis zu Ende
niederzuschreiben. Die Erleichterung, die ich bei dieser Feststellung
empfinde, zeigt mir, daß ich einen persönlichen Gewinn von dieser Arbeit habe,
die sich über mehrere Jahre hingezogen hat.
Eine Selbstbiographie ist
eine Lebensdurchforschung und damit eine Selbsterforschung, sicher auch eine
Gewissenserforschung. Sie erfordert eine gewisse Sachlichkeit. Aber wer kann
sich selbst, seinem Tun und Lassen gegenüber sachlich sein? Ob ich es kann, bezweifle
ich. Ich kann nur versichern, daß ich mir Mühe gegeben habe.
Eine Selbstbiographie ist
eine geistige Aktion. Sie bringt Ordnung in die Vergangenheit des Schreibers.
Sie schafft eine Übersicht über das verflossene Leben. Sie kann auch Ausblicke
in die Zukunft öffnen.
Von der Ordnung, die man sich im eigenen Rücken schafft, geht ein
therapeutischer Effekt aus. Ich spüre ihn deutlich. Mir ist leicht zumute.
Schon bei Beginn fühlte ich Erleichterung. Sie ist wahrscheinlich auch der Grund,
daß ich die immer wiederkehrende Anfechtung, das Manuskript wegzuschmeißen und
lieber zu malen als zu schreiben, erfolgreich abwehren konnte.
Nachdem ich in mühevoller, manchmal ärgerlicher Arbeit mein Leben
niedergeschrieben habe, übersehe ich es zum ersten Male sehr deutlich.
Auffällig ist, daß viele Zufälle oder unerwartete, unvorhersehbare Ereignisse
dabei mitgespielt haben. Diese Zufälle waren zu einem Teil Hilfen, zum anderen
Zwänge für mich, aber in manchen Fällen sogar beides. Angesichts dieser vielen
Zufälle und von mir nicht zu beeinflussenden Ereignisse
ist mein Leben aus vielem zusammengesetzt, zusammengeflickt,
zusammengebastelt. Diese logischer Zusammenhänge entbehrende Bastelei wurde oft
durch Druck von außen erzwungen, andererseits aber auch durch meine Neigungen
und manchmal auch, von mir unbemerkt, durch eine mehr motorische Lebensphase
in Gang gesetzt.
Am Ende meiner Niederschriften stehe ich nun - ich muß das schon sagen -
erstaunt und überrascht vordem Bild meines Lebens. Ich sehe in diesem Bild die
vielen "Unebenheiten", die unmotivierten und unvermutbaren Rhythmus-,
Gestalt- und Form Störungen. Da haben viele und hat vieles mitgearbeitet. Die
Bildstruktur ist nicht einheitlich. Abrupte gegensätzliche Stellen sind darin,
aber auch weiche sanfte Partien sind zu sehen. Sehr vieles aber habe ich
tatsächlich selbst gemacht, habe alles von außen Kommende zurechtgeschoben und
versucht, alles so hinzukriegen, daß ich mich wohl fühlen und zurechtkommen
konnte. Hervorstechend ist in diesem Lebensbild, daß ich immer ausdauernd und
zielstrebig gemalt und gezeichnet und diese Tätigkeit gegenüber allen anderen
Forderungen des Lebens in auffälliger Weise bevorzugt habe.
Manches, was einmal für mich sehr wichtig war, z.B. das Geigen- und
Klavierspiel, ist ganz verschwunden. Es wurde von mir selbst aus meinem
Lebensbild herausgefetzt oder mitleidlos überklebt. Natürlich ist mir eine
gewisse Affinität zur Musik geblieben, aber sie tritt nicht mehr spektakulär in
Erscheinung, so wie in einer Collage der erste Gestaltungsversuch im Laufe
einer weiteren Arbeitsphase zum Teil oder sogar ganz überdeckt sein kann, ohne
seine Wichtigkeit für die Gesamtgestalt dadurch verloren zu haben.
Da nun das entscheidende Wort gefallen ist, sei es kurz herausgesagt: Der
Verlauf meines Lebens und der Arbeitsvorgang der Collage weisen viele
Ähnlichkeiten und Parallelen auf; das Bild von meinem Leben und die fertige
Collage sind vergleichbar. Der Mensch in seinem Leben und der Künstler beim
Collagieren gehen beide aus von zufällig Vorhandenem, von zufällig oder auch
gezielt Gesammeltem, von Gefundenem, von eigenen oder fremden Erzeugnissen, und
sie verarbeiten dies alles in verschiedenen Kombinationen, aber auch einzeln
in unterschiedlichen Arbeitsvorgängen. Das Ziel bestimmen sie selbst mehr oder
weniger deuüich oder vage und können es immer wieder modifizieren oder ganz und
gar ändern. Den Endergebnissen sieht man an, daß an ihrem Zustandekommen sehr
heterogenes Material verschiedenster Herkunft beteiligt war.
Ich habe oft aus berufenem Munde gehört und aus berufener Feder gelesen,
daß Kunst eine Metapher des Lebens sei. Ich bin überzeugt, daß diese
Feststellung richtig ist und füge in meinem Einzelfall hinzu: Die zutreffende
Metapher meines Lebens ist die Collage. Vielleicht ist sie sogar für das Leben
vieler, vielleicht auch aller Menschen zutreffend.
Aber sicher wird der eine oder andere Leser feststellen, daß auch sein
Leben eher einer Collage ähnelt als z.B. einem Tafelbild, das vorher geplant
werden kann, in einem bestimmten Material von Anfang bis Schluß durchgeführt
wird, und zwar von einer Hand, das also eine durchgehende Struktur der
Pinselführung aufweist und in allen Teilen die gleiche Sprache spricht, wodurch
es vom Betrachter leicht und unter logischen Gesichtspunkten nachvollziehbar
wird. Mir erscheint es sogar unmöglich, das Lebensbild irgendeines Menschen
meiner Generation aufzustöbern, das nicht der Collage ähnelt.
Ich gehe den Weg zur Kunst schon ein halbes Jahrhundert. Ich habe viele
seiner Wunder und seiner beglückenden Überraschungen erlebt, habe an seinen
Rändern Enttäuschungen hinnehmen müssen und abgrundtiefe Verzweiflung geahnt.
Ich bin überzeugt, daß dieser Weg ohne Ende ist. Jeder, der ihn geht, muß ein
hohes Maß an Selbstbewußtsein, aber auch ein hohes Maß an Demut besitzen, wenn
er vor der Endlosigkeit nicht verzagen soll. Denn ohne Demut wird er nicht
begreifen können, daß er oft nur Werkzeug ist und dann unterhalb seines
Bewußtseins arbeitet.
Hier liegt der Grund
dafür, daß auch in diesen meinen Niederschriften manche Zusammenhänge nicht
klar und logisch mit dem Wort darstellbar sind, sich also dem logischen Denken
entziehen. Ich hoffe, mit dem Leser übereinzustimmen, wenn ich sage: Wir
sollten darüber nicht unglücklich sein.
Kindheit
Mein Vater Paul Thoma
wurde 1881, im Geburtsjahr Picassos, geboren und stammte aus einem sehr großen
Dorf, das an der Bahnstrecke zwischen Oppeln und Brieg in Oberschlesien liegt,
aus Alt-Schalkowitz. Sein Vater, mein Großvater, hieß Franz Thoma. Das Dorf
sprach polnisch, und mein Großvater heiratete auch eine Frau, die den
zweifellos polnischen Mädchennamen Macioszek hatte. Diese sprach kein Wort
Deutsch, der Großvater sprach es gebrochen, aber mein Vater schon fließend.
Mein Großvater war ein Häusler mit zwei Kühen und gleichzeitig Postillon mit
einem Pferd, das er aber auch für seine Feldarbeit benutzen konnte. Außerdem
war er Schneidermeister und übte dieses Handwerk auch aus. Er hatte sieben
Söhne und eine Tochter. Mein Vater war sein zweitältestes Kind. Der
zweitjüngste Sohn und der Ehemann der Tochter fielen im Ersten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
fiel das Heimatdorf meines Vaters - wie alles östlich der Oder-Neisse-Linie -
an Polen und heißt jetzt Siotkowice, nachdem es in den dreißiger Jahren von den
Nazis in Schalkendorf umgetauft worden war. Die dort verbliebenen Verwandten
mit Namen Thoma müssen sich nun ohne h schreiben: Torna. Torna wird mit kurzem
offenem o ausgesprochen und bekommt dadurch beim Sprechen einen ganz anderen
Charakter als das mit langem geschlossenem o gesprochene Thoma. Der jüngste
Bruder meines Vaters, Konstantin Thoma, hat bis heute das h seines Namens mit
Erfolg gegen alle Polonisierungsversuche verteidigt. Konstantin ist jetzt 80
Jahre alt.
Unser Name Thoma taucht
zum ersten Mal in den Schalkowitzer Kirchenbüchern im Jahre 1752 im Taufzeugnis
eines Andreas Thoma auf, bis zu dem sich unsere Ahnenreihe zusammenhängend verfolgen
läßt. Der Vater des Andreas Thoma könnte also in der Folge des Ersten oder
Zweiten Schlesischen Krieges dort eingewandert sein.
Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, war eine besondere Frau. Wir
konnten uns nicht mit ihr unterhalten, weil wir verschiedene Sprachen
sprachen. Sie war immer freundlich zu uns, drohte nur selten mit dem
Zeigefinger, aber immer mit freundlichem Gesicht. Wir hielten sie für eine
Heilige. Sie litt oft unter anscheinend gräßlichen Kopfschmerzen. Denn wenn sie
sich unbeobachtet fühlte, konnte man manchmal kleine Schmer- zensschreie
hören. Um diese Schmerzen erträglicher zu machen, band sie sich ein weißes,
zusammengelegtes Leinentuch fest um die Stirn. Darüber trug sie das im Dorf
übliche schwarze Kopftuch, das, zusammen mit der weißen Stirnbinde, ihr das
Aussehen einer Ordensschwester verlieh.
Tatsächlich war sie sehr
fromm - in einer sehr natürlichen Weise. Wenn sie sah, daß mein Bruder Alfred
und ich in den großen wilden Birnbäumen des Hofes gefährliche Kletterpartien
machten, faltete sie die Hände und betete für uns. Wenn wir dies sahen, fühlten
wir uns behütet und doppelt sicher. Wenn ein Gewitter aufzog, stellte sie ein
geweihtes Kruzifix mit zwei Leuchtern auf den Tisch, zündete die Kerzen an und
ging dann, aus einer Flasche Weihwasser sprengend, mit einem Glöckchen läutend
und laut betend um das ganze Haus herum. Ihre Sorge um das Haus war begründet.
Wohnhaus, Stall und Scheune waren in zusammenhängendem Trakt aneinandergebaut,
und Stall und Scheune waren mit Stroh gedeckt.
Das Brot wurde von ihr
selbst gebacken. Am Backtage holte sie aus dem Vorratsraum den Backtrog. In
einer seiner Ecken klebte noch vom letzten Mal ein kleiner Rest Teig, der sich
inzwischen in Sauerteig verwandelt hatte. Die schwere Arbeit des Teigknetens
verrichtete sie selbst. Wenig später standen dann die riesigen Teigklumpen in
Strohschüsseln auf Stühlen, Tischen und Bänken. Im Backofen wurde nun Feuer
gemacht. Sie schichtete den Holzstoß sorgfältig rechteckig auf, in dessen Mitte
kleingespaltenes Holz aufgehäuft wurde. Dann ging sie in die Scheune, holteeine
Handvoll Stroh, das sie auf dem Rückweg zum Haus zu einem Kreuz band. Dieses
wurde auf einen langstieligen Holzschieber gelegt, angezündet und unter die
Mitte des Holzstoßes geschoben. Sobald das Holz aufflammte, rannten wir Kinder
auf den Hof, um das Herausquellen der ersten Rauchwolke nicht zu verpassen. Das
spätere Hineinschieben der Brotlaibe war wieder mit einer frommen Zeremonie
verbunden. Jeder Laib wurde, bevor er in den heißen Ofen geschoben wurde, von
Großmutter bekreuzigt. Auch das Anschneiden jedes Bortlaibes bei Tisch geschah
nicht, ohne daß vorher dessen Rückseite mit der Spitze des Messers dreifach
bekreuzigt wurde. Ich habe nie sonst einen Menschen kennengelernt, der mit so
selbstverständlichem Ernst seinen Glauben praktizierte. Der Durchmesser der
runden Brotlaibe betrug ungefähr 70-75 Zentimeter. Großmutter schnitt das Brot
immer im Stehen, wobei sie es mit der Kante auf den Tisch stellte und mit der
linken Hand an ihren Körper drückte.
Unsere Bewunderung für diese Frau wurde ins Unermeßliche gesteigert bei
einem kleinen Unglücksfall meines Bruders Alfred. Er hatte sich - wir sind als
Kinder im Sommer immer barfuß gelaufen, sogar noch in den Anfangsklassen des
Gymnasiums - eines Tages in der Scheune an einer herumstehenden Sense den
großen Zeh bis zum Knochen aufgeschnitten. Die Blutung war beängstigend stark.
Die Dorfkinder, mit denen wir gespielt hatten, liefen schreiend zur Großmutter
ins Haus. Sie kam heraus, ruhig mit ihrem schmerzlichen Lächeln, setzte sich
auf einen Stein, winkte Alfred heran, nahm seinen blutenden Fuß auf ihr Knie,
hielt beide Hände segnend darüber, blickte zum Himmel und bewegte die Lippen im
Gebet, immer lächelnd, beinahe verklärt. Fast augenblicklich hörte die Wunde
auf zu bluten. Dann holte sie aus dem Garten vier, fünf Blätter einer
Schöllkrautplanze, klopfte sie mit einem Küchenmessergriff, so daß der
orangene Saft herausquoll, legte sie auf die Wunde und verband diese mit den
Fetzen eines alten, verbrauchten Bettlakens. Kein Wunder, wenn wir Kinder in
ihr eine Heilige sahen.
Der Großvater war ein einfacher, frommer und lieber Mann, der still und
ohne Aufsehen seine vielen Arbeiten (als Bauer, Schneider und Postillon)
verrichtete. Wir begleiteten ihn gern, wenn er abends mit der Radwer für das
Vieh Futter holte, und halfen ihm beim Häckselschneiden, indem wir das große
Schwungrad der kleinen Häckselmaschine drehten.
Meine Mutter, Jahrgang 1883, kommt aus dem Glatzer Bergland, aus dem Dorf
Grunau, das mit der Stadt Kamenz später zusammenwuchs. Auch die Heimat meiner
Mutter liegt jetzt in Polen. Mutters Vater, mein Großvater, hieß Joseph Kluß,
war Stellenbesitzer mit zwei Kühen und einem großen Obstgarten, war Gemeindeschreiber
und Dorfkapellmeister und spielte fast alle Instrumente, wie unsere Mutter uns
erzählte. Ich selbst habe ihn aber nie irgendein Instrument spielen gehört oder
gesehen. Nur einmal bei einem großen Parkfest in Kamenz habe ich ihn an der
Spitze einer stattlichen Blaskapelle taktierend auf der Festwiese einmarschieren
und dann den ganzen Tag über dirigieren gesehen. Da haben wir ihn natürlich
sehr bewundert. Er hatte einen starken Bildungsdrang und besaß Meyers Konversations-Lexikon.
Alfred und ich liebten ihn nicht so wie unseren anderen Großvater in
Schalkowitz; er war uns zu ernst und zu streng, hatte starre Prinzipien, die
sich in oft wiederholten Sprüchen ausdrückten, wie: Wie der Mensch zum Essen
ist, so ist er auch zum Arbeiten, oder: Ich brauche mir nur die Schuhe eines
Menschen anzusehen, dann kenne ich den ganzen Menschen. Er nahm aber stark
Anteil an der Entwicklung seiner Enkel und war entzückt, als er merkte, daß
wir schnelle Fortschritte im Geigenspiel machten. Wir mußten auch unsere Geigen
bei unseren Besuchen immer mitbringen und ihm unsere Übungsstücke usw. vorspielen.
Auch unsere Schulzeugnisse und deutschen Aufsätze mußten wir ihm mitbringen.
Er las alles beinahe gierig und lobte uns mit einer gewissen inneren Bewegtheit.
Auch bei diesen Großeltern hatten Alfred und ich große Freuden. Während
das Haus der Großeltern in Schalkowitz auf eine natürliche, uns sehr sympathische Weise verwahrlost war, war in Grunau alles sehr
gepflegt. Das Haus war so sauber, daß man den kleinsten Dreck auf dem Fußboden
nicht übersehen konnte. Im ersten Stock gab es ein gutes Zimmer, auf dessen
Wände ein wahrer Meister von Stubenmaler eine breitgestreifte, seidenimitierende
und mit riesigen Blumenbouquets geschmückte Tapete schabloniert hatte mit so
vielen Farben, daß ich es nicht schaffte, sie zu zählen.
Die Wasserpumpe stand im Hausflur. Wie vieles im Hause war sie für uns
Kinder tabu. Nur die Kücheneimer der Großmutter durften wir vollpumpen. Eine
Bodenkammer, in der eine Menge von Musikinstrumenten aller Art untergebracht
war, hätten wir zu gerne durchstöbert. Aber sie war verschlossen, so daß wir
nur durch die Bretterritzen die Herrlichkeiten ihres Inhaltes bewundern
konnten. Aber eines Tages schenkte uns der Großvater eine Ziehposaune. Die
lärmenden und unästhetischen Töne, die wir diesem Instrument tagelang fast
pausenlos entlockten, führten schließlich dazu, daß es uns wieder abgenommen
wurde. Wir durften es aber mit nach Hause nehmen, wo wir nun mit unseren Spielgefährten,
die natürlich alle einmal blasen wollten, wieder auf der Straße einen solchen
Höllenlärm entfesselten, daß die Polizei gerufen wurde, nachdem die
Erwachsenen die Jagd nach der Posaune aufgegeben hatten, weil sie bei den
Hatzen unserer Behendigkeit nicht gewachsen waren. Von da an war die Posaune
nur noch totes Museumsstück.
Der riesige großelterliche Obstgarten war für uns trotz vieler Verbote
ein Paradies. Zur Zeit der Reife durften die Früchte von uns nicht gepflückt
werden. Nur das Fallobst durften wir sammeln. Essen durften wir so viel wir
wollten, aber abgepflückt wurden die Früchte nur von Erwachsenen. Uns traute
man das Urteil 'reif oder unreif nicht zu. Anders war es zur Kirschenzeit. Da
durften wir den ganzen Tag in den sechs riesigen Kirschbäumen herumklettem und
sie abernten. Tagelang hatten wir dann Bauchschmerzen, weil wir unserer Freß-
lust freien Lauf ließen. Hauptanziehungspunkt war der sogenannte Mühlgraben,
der am Rande des Obstgartens vorbeifloß. Er war ein Abzweig der Glatzer Neisse,
etwa sechs Meter breit, etwas über einen Meter tief, floß ziemlich schnell und
entwickelte glucksende Strudel. Zu den Feldern am anderen Ufer führte ein ein
Meter breiter Steg. Unter diesem arbeitete immer ein kräftiger Strudel, der ein
etwa drei bis vier Meter tiefes Loch ausgeschwemmt hatte, vor dem uns zu warnen
Eltern und Großeltern nicht müde wurden. Denn wir badeten ja auch in dem
Mühlgraben an den seichten Stellen. Die Stelle mit dem Loch reizte uns zu
Mutproben, und so wagten wir immer wieder den Sprung von dem Steg, um uns von
der schnellen Strömung unter der Brücke hindurch über das tiefe Loch in die
seichte Stelle dahinter tragen zu lassen. Wir taten es aber nur, wenn wir
sicher waren, daß die Erwachsenen uns nicht beobachteten.
Einmal im Jahr wurde der Mühlgraben abgesperrt, um den Flußlauf zu
reinigen. Das Wasser floß ab, aber in den großen Löchern blieb es stehen. Aus
ihnen holten zwei Fischer viele Zentner Fische heraus. Das begann immer damit,
daß sie mit einem zweihenkligen Weidenkorb durch das Loch gingen, wobei sie für
einige Sekunden verschwanden, und mit dem fast gefüllten Korb wieder
herauskamen. Wenn sich die Korbfischerei nicht mehr lohnte, holten sie den
Rest der Fische mit einem großen Käschernetz heraus. Weiter flußabwärts saßen
dann immer schon einige Katzen an den kleinen Rinnsalen bereit, um die wenigen
flüchtenden Fische zu erwischen.
Ein weiterer Anziehungspunkt war das von Schinkel erbaute Kamenzer
Schloß, das wie das Kleinstädtchen Kamenz nur zwei Kilometer vom
großelterlichen Haus entfernt war. Es wurde von einem Sohn Kaiser Wilhelms II.
bewohnt, der Landrat des Kreises Frankenstein war. Zum Schloß hinauf, das auf
einem Hügel lag und wegen seiner charakteristischen Form mit seinen vier
Ecktürmen von den Leuten das umgekehrte Billard genannt wurde, zog sich eine große
Terrassentreppe, die reichlich mit Gartenanlagen und Wasserspielen geschmückt
war. An manchen Sonntagen wurden die Wasserspiele in Aktion gesetzt. Wir gingen
dann fein angezogen mit Eltern und Großeltern hin, um dieses Schauspiel zu
bewundern. Auch die Riesenfontäne des Schloßteiches unterhalb der Terrassen war
dann zu bestaunen.
Im Grünauer Großelternhaus wurde das Leben freier, als nach dem Tode des
Großvaters unser Onkel Max mit seiner Familie einzog. Er war mit der Schwester
meiner Mutter - sie hieß Emilie und wurde von uns Milchen genannt -
verheiratet, war Postbeamter, 1,92 m groß und hatte das Fleischerhandwerk
erlernt. Es war für ihn naheliegend, in jedem Jahr für den Hausgebrauch ein
großes Schwein zu schlachten. Wir wurden oft dazu eingeladen. Der Tag des
Schweineschlachtens war in Schlesien von jeher ein großes Familienfest, bei dem
es im Hause von Menschen wimmelte. Den Tag über wurden bei fünf Mahlzeiten
Riesenmengen gegessen. Die Vorbereitungen wie das Kuchenbacken oder das
Reinigen der für das Wurstmachen dazugekauften Ziegendärme waren für uns
Kinder schon interessant genug. Aber besonders gespannt waren wir auf das
Schlachten des Schweines, das meistens drei Zentner wog. Wir standen dazu in
aller Frühe auf, sahen dann, wie das Schwein unter einem einzigen Axthieb
unseres hünenhaften Onkels zusammenbrach, hörten nach dem Stich in die
Halsschlagader das dunkle Blut in die Schüssel sprudeln, sahen, wie das
Riesentier in einen Holztrog gewälzt, dort mit kochendem Wasser übergössen, geschrubbt
und entborstet wurde, erlebten dann noch die Riesenanstrengung von vier
Männern, die benötigt wurden, um das tote Schwein, durch dessen Fersensehnen
eine Wagenrunge gesteckt worden war, hochzuhieven und kopfabwärts an einem
Haken aufzuhängen, und verpaßten natürlich auch das Aufschneiden der Brust und
des Bauches und das Herausquellen der in der frischen Morgenluft dampfenden
Eingeweide nicht. Zwischen den kräftigen Mahlzeiten gab es immer noch viel zu
beobachten: Die Vorbereitung der Wurstfüllungen, das Einfüllen in die Därme mit
Hilfe des plump aussehenden Trichters, das Schließen der Därme mit den Wurst-
speilern, das Zurechtmachen der Fettliesen, das Vorbereiten der Speckseiten,
der Schinken und einiger Wurstsorten zum Räuchern. Die Gäste aßen und tranken
und tanzten. Ein Ziehharmonikamann spielte den ganzen Tag so laut es ging. Die
Gäste, die auch Tante Milchen und Onkel Max bei der Arbeit halfen, ließen
schließlich beim Essen die Hemdsärmel hochgekrempelt und die Schürzen vor dem
Bauch. Sie wurden immer lustiger, sangen und witzelten bis in die Nacht und
machten drastische Pfänderspiele. Auch die Bettler der Gegend erfuhren jedesmal
rechtzeitig von so einem Schweineschlachten, kamen einzeln oder zu zweien über
den Tag verteilt und erhielten reichlich zu essen.
Mein Vater absolvierte seinen Militärdienst in Glatz und lernte dort
meine Mutter kennen, die sich da als Dienst- und Serviermädchen verdingt hatte.
1907 heirateten meine Eltern und wohnten in Lugnian im Kreis Oppeln, wo mein
Vater als Briefträger bei der Post arbeitete. In der Nazizeit wurde Lugnian in
Lugendorf umgetauft. Auch in diesem meinem Geburtsort
sprach die Bevölkerung polnisch.
Meine Eltern waren katholisch und einfache, solide, arbeitsame, äußerst
fleißige Leute. Hauptberuf meines Vaters war der Dienst bei der Post. Zu Hause
übte er das Schneiderhandwerk aus, das er, wie alle seine Brüder, bei seinem
Vater gelernt hatte. Er liebte wohl dieses Handwerk außerordentlich. Meine
Erinnerungsbilder zeigen ihn mir noch heute entweder an seiner Nähmaschine in
der Nähe des Fensters der großen Wohnküche sitzend oder an dem großen, sehr
stabilen Tisch in der Mitte desselben Raumes stehend, wo er die Anzüge und
Mäntel zuschnitt oder mit einem großen schmiedeeisernen Bügeleisen und einem riesigen,
mit Sägespänen gefüllten Kissen hantierte.
Wenn mein Vater zu seinem Dienst in die Post oder zum Bahnhof ging, zog
er kurz vorher seine Postuniform an, wenn er zurückkehrte, zog er sich sofort
wieder um und arbeitete an seiner Nähmaschine. Zeitunglesen und sonntags
Skatspielen mit seinen Freunden oder Kollegen waren die einzigen
Unterbrechungen seiner Arbeit. Mutter war mit Haushalt und mit Handnäharbeiten
wie Knopflöchermachen und Futtereinnähen ebenfalls den ganzen Tag beschäftigt.
Wenn ich heute an sie denke, sehe ich sie in meiner Erinnerung entweder am
Fenster auf ihrem Nähplatz sitzen, oder ich sehe sie am Herd stehen und kochen.
Auch wir Kinder halfen schon frühzeitig mit bei der Schneiderarbeit,
zogen mit einem Pfriemen die Heftfäden heraus, zertrennten alte Anzüge und
Mäntel, die gewendet werden sollten, und lieferten fertige Kleidungsstücke bei
Vaters Kunden ab, was uns fast regelmäßig ein willkommenes Botengeld
einbrachte.
Vier Brüder meines Vaters waren auch Postbeamte, ebenso die Ehemänner der
beiden Schwestern meiner Mutter. Zum Erscheinungsbild dieser sechs Onkel gehörte
für mich die Postuniform, nur der Großvater versah seinen Dienst als Postillon
in seiner Privatkleidung. Da wir fast ausschließlich diese postgebundenen
Verwandten besuchten, glaubte ich als Kind lange Zeit, daß auch alle unsere
anderen männlichen Verwandten bei der Post arbeiteten.
In Lugnian wurde am 12.
September 1908 mein Bruder Alfred geboren, der nach seinem Studium Assistent am
Berliner Heinrich-Hertz-Institut wurde. Nach 1933 wurde er von den Nazis mit
dem jüdischen Präsidenten dieses Instituts fristlos entfernt.
(Anmerkung von Ulrich
Thoma: Karl Willy Wagner war ein Deutscher – die näheren Umstände des Vorfalles
können in der Wikipedia nachgelesen werden: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Willy_Wagner
Ausführliche Informationen unter dem
folgenden Link: http://www.ulrichthoma.de/alfredthoma/).
Er ging als Mathematiker
und theoretischer Physiker zu Telefunken, wo er auch während des Zweiten
Weltkrieges arbeitete. Dann ging er in den höheren Schuldienst und war
schließlich in Fulda Oberstudiendirektor. Er starb 1974.
Ich wurde elf Monate später als mein Bruder Alfred, am 17. August 1909,
ebenfalls in Lugnian geboren. Bei meiner Taufe gab es eine Schwierigkeit. Die
Hebamme hatte meiner Mutter schon alle möglichen polnischen Namen für mich
vorgeschlagen, hauptsächlich aber den Namen Rochus, weil der Heilige Rochus,
wie sie meinte, für den 17. August im Kirchenkalender vorgesehen sei. Meine
Mutter aber wollte den damals noch sehr ausgefallenen Namen Helmut. Der
Ortspfarrer weigerte sich, mich auf diesen Namen zu taufen, weil dies der Name
des "Katholikenfressers" Graf Helmuth von Moltke gewesen sei
(Altkatholikenbewegung nach dem Vatikanischen Konzil 1869). Die Ankündigung
meiner Mutter, mit mir nach Oppeln zu fahren und mich dort taufen zu lassen,
bewirkte aber schließlich, daß er doch den Namen Helmut akzeptierte.
Als ich zwei Jahre alt war, siedelten meine Eltern nach Neisse an der
Glatzer Neisse über. Mein Großvater mütterlicherseits wollte seinen
Bildungsdrang wenigsten in seinen Enkeln verwirklicht sehen und kniete meinen
Eltern so lange auf der Seele, bis sie ihm nachgaben und in einen Ort umzogen,
der eine höhere Schule besaß. So verbrachte ich also meine Jugend bis zu meinem
20. Lebensjahr in der katholischen Kleinstadt Neisse (damals etwa 25.000
Einwohner), im "Schlesischen Rom", wie sie genannt wurde, weil sie
viele Kirchen und Klöster besaß, die auch das Stadtbild bestimmten, äußerlich
und innerlich.
In Neisse war es selbstverständlich, katholisch zu sein. Wir Kinder
wurden früh daran gewöhnt, an Sonn- und Feiertagen zum Gottesdienst und zur
Predigt zu gehen. Um 11 Uhr fand ein Kindergottesdienst statt, der die
Faulenzermesse genannt wurde. Wir gingen aber lieber mit der Mutter ins
Hochamt, weil da auf dem Chor gesungen wurde und vom am Altar viel mehr zu
sehen war. Meine Eltern waren nicht übertrieben fromm, aber sie erfüllten exakt
die Kirchengebote. Wir sprachen selten darüber, weil es eben selbstverständlich
war.
Der spektakulärste Höhepunkt des Jahres in dieser Stadt war das
Kirchenfest Fronleichnam. Es hat bei mir mit seinem festlichen Gepränge einen
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Zur Fronleichnamsprozession war die ganze
Stadt auf den Beinen, auch die Nichtkatholiken. Alle Vereine, Organisationen
und auch die Schulen nahmen in geschlossenen Gruppen daran teil. Die Organisation
und Regie waren bewundernswert. Daß aus dem Durcheinander des wirren
Menschenhaufens auf dem Kirchplatz vor der großen Sankt Jakobs-Kirche sich
schließlich die geordnete und disziplinierte Prozession bildete und sich dann
durch die an manchen Stellen engen Straßen wie ein Riesenwurm schlängelte, war
für mich immer wieder ein Wunder. Als ich an das Realgymnasium kam, brauchte
ich nicht mehr mit der Klasse unter Aufsicht des Lehrers an der Prozession
teilzunehmen. Dadurch kam ich erst richtig in den Genuß dieses eindrucksvollen
Schauspiels. Ich habe das ausgenutzt und lief immer durch Nebengäßchen und
Querverbindungen dorthin, wo am meisten zu sehen war. Ich konnte jetzt auch
den Sinn der Prozession durchschauen, ebenso ihre Gliederung. An der Spitze
gingen etwa 50 bis 60 kleine weißgekleidete Mädchen, die Blumen streuten, dann
kam das Riesenorchester und dahinter der Riesenchor, dann ein Riesenheer von
Nonnen und Mönchen mit langen brennenden Kerzen in den Händen und dahinter das
Wichtigste, der Kern der Prozession: eine große Schar von geistlichen
Würdenträgern in ihren kostbaren Meßgewändern, und in ihrer Mitte ein von vier
Männern getragener Baldachin, unter dem ein Priester in schneeweißem Gewand das
Allerheiligste, den Leib des Herrn, den eucharistischen Gott, die in die
strahlende Monstranz eingeschlossene Hostie feierlich vor sich hertrug.
Dahinter bewegten sich ebenso feierlich die Honoratioren der Stadt im
schwarzen Gehrock mit Zylinderhut und umgehängten Amtsketten.
Dann folgte der Teil der Prozession, der mich am meisten aufregte: die
Handwerkerinnungen. Jede von ihnen besaß nämlich eine Riesenfahne, die von fünf
Männern getragen wurde. Ich wurde nicht müde, diese Männer zu bewundern, die an
windigen Tagen Schwerstarbeit zu leisten hatten. Der Fahnenmast war sicher fünf
bis acht Meter hoch. Die Fahne selbst hing wie ein Bild senkrecht und war oben
und unten mit einem golden glänzenden Querstab aus Metall versehen. Unten
hatte der Mast ein Querholz, das der mittlere Träger mit beiden Händen gefaßt
hielt. Er mußte immer nach oben schauen, um den Mast in der Senkrechten zu
halten. In der Mitte war der Mast mit einem Eisenring beschlagen, an dem an
Scharnieren die eigentlichen vier Trägerstangen befestigt waren, die schräg
nach unten und nach außen auf der ausgepolsterten Schulter je eines Trägers
endeten. Die vorderen Träger mußten rückwärts gehen. Alle fünf Träger ließen
keinen Blick von dem Fahnenmast, damit er immer senkrecht blieb. An den
Schweißperlen auf ihrer Stirn und ihren hochroten Gesichtern konnte man die
Härte ihrer Arbeitsleistung ablesen. Die Fahnenbilder waren Darstellungen aus
der Heiligenlegende, die zu dem jeweiligen Handwerk in Verbindung standen. So
war bei den Tischlern z.B. der Hl. Joseph an der Hobelbank abgebildet. Aber
auch geschichtliche Begebenheiten waren auf den kostbaren Fahnentüchern zu
sehen. So konnte man auf der Fleischerfahne die Hussitenschlacht vor Neisse
bewundern, wie die Fleischer mit Beilen und Messern bei einem Ausfall aus der
umzingelten Festung die schlitzäugigen Belagerer niedermetzelten. Die größte
Fahne gehörte den Bäckern. Sie war als einzige weiß und hatte sechs
Trägerstangen. Sie soll sogar einmal bei einem Windstoß in die Menschenmenge
gefallen sein. Wie durch ein Wunder wurde keiner verletzt. Hinter den Innungen
gingen in Blöcken geordnet die Schüler der katholischen Volksschule
klassenweise unter Führung ihrer Lehrer, zuerst die Mädchen-, dahinter die
Knabenschule. Der Prozzessionszug wurde beendet durch die Schar der kleinen
Bürger und der armen Leute. Schließlich begleiteten die Soldaten der Neisser
Garnison, umgeschnallt und mit Stahlhelm, den langen Zug an beiden Seiten als
Spalier. Alle Häuser waren mit frischem Grün geschmückt. Von den Fenstern
herunter hingen farbige Teppiche und viele rote Decken, und in den
Fensterausschnitten standen Heiligenbilder, Kruzifixe, Leuchter mit brennenden
Kerzen und Blumensträuße. Die Prozession stellte gleichzeitig auch ein in der
Öffentlichkeit gehaltenes Hochamt dar, für dessen Hauptstationen in den Straßen
große, prächtige Altäre mit riesigen Heiligenbildern aufgebaut waren.
In meinem fünften und sechsten Lebensjahr hatte ich einen Traum, der sich
etwa ein Jahr lang fast jede Nacht wiederholte und mich sehr ängstigte. Ich
träumte zunächst die gleiche Situation, in der ich mich tatsächlich befand,
daß ich also im Bett lag. In Blickrichtung lag die Eingangstür des Zimmers. Sie
öffnete sich einen Spalt, und ein seltsames Tier, das trotz seiner Phantastik
einem Fuchs oder Wolf ähnelte, schob seinen Kopf ins Zimmer. Seine Augen
leuchteten grell, auch das Fell leuchtete nahezu bengalisch. Es schlich langsam
ins Zimmer bis zu dem Stuhl an meinem Bett, auf dem meine Kleider säuberlich
lagen und der ein Herabfallen der Zudecke verhinderte. Am Stuhl verharrte das
Tier einige Augenblicke in sitzender Stellung. Dann sprang es erst auf den
Stuhl und sofort anschließend auf meine Zudecke, so daß sein Kopf dicht an
meinem Gesicht war und seine feurigen Augen mich nahezu blendeten. In diesem
Augenblick schrie ich voller Angst auf und wurde wach. Ehe ich aber die Augen
öffnete, sah ich das Tier mit seinem großen buschigen Schwanz vom Bett
herunterspringen und unter dem Bett verschwinden. Inzwischen hatte ich mich
aufgesetzt und schrie so laut ich konnte auf echt schlesisch: "Doas griene
Viech, doas griene Viech!" Tatsächlich war das Tier meistens grün. Ein
Grün hatte es, das dem grünen Licht explodierender Feuerwerkskörper ähnelte.
In manchen Nächten aber hatte es seine Farbe gewechselt und leuchtete rot, aber
mit gleicher feuriger Intensität. Dann schrie ich natürlich: "Doas rote
Viech!"
Meine Mutter, die einen leichten Schlaf hatte, war immer schon wenige
Augenblicke nach meinem ersten Aufschrei an meinem Bett, in der Hand einen Leuchter
mit brennender Kerze. Sie setzte sich auf den Bettrand und versicherte mir
immer wieder, daß ich nur geträumt habe. Mein Traum war aber immer so lebhaft
gewesen, daß ich das gar nicht glauben konnte. Für mich saß das Tier unter dem
Bett und wartete nur darauf, daß meine Mutter das Zimmer verließe. Meine Mutter
hatte viel Geduld, kniete schließlich mit mir vor dem Bett nieder und leuchtete
mit der Kerze darunter, auch unter das Bett meines Bruders, bis ich einsah, daß
ich doch nur geträumt hatte. Ich wunderte mich sehr darüber, daß die
Erwachsenen bezweifelten, daß jemand farbige Träume habe. Mir haben sich diese
Träume, wahrscheinlich durch ihre immer wiederkehrende Monotonie, so eingeprägt,
daß ich noch heute beim Abbrennen von Feuerwerk, ja sogar beim Anblick von
Weihnachtsbaumkugeln an diese Viecher denke, die mich so lange gequält haben.
In Neisse erlebte unsere vierköpfige Familie den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges. Ich war fünf Jahre alt, und ich kann mich noch erinnern, wie wir
unseren Vater am ersten Tag der Mobilmachung zu der Bezirkskommandatur
begleiteten, wie er dann in der Landsturm uniform mit Gewehr wieder herauskam,
in der er für uns fremd und beinahe unnahbar aussah. Mein Bruder und ich
begleiteten ihn, an seinen Händen hängend, noch bis zum Bahnhof, während meine
Mutter ohne Unterbrechung mit ihren Tränen beschäftigt war.
Sehr deutlich in meiner Erinnerung zurückgeblieben sind jene stillen
wehmütigen Abende, wenn meine Mutter an den Vater Feldpostbriefe schrieb. Ich
saß dann neben ihr und malte ein Blatt voll, das dem Brief beigelegt wurde.
Meistens malte ich Dampfer mit vielen dunklen, barock gekräuselten
Qualmwolken. An anderen Abenden saßen mein Bruder Alfred und ich mit der Mutter
auf einem alten Sofa. Sie sang mit uns Volkslieder, erzählte uns Märchen oder
etwas aus ihrem oder des Vaters Leben. Wenn lange Zeit kein Feldpostbrief
gekommen war, weinte sie. Wenn dann endlich wieder ein Brief eintraf, war sie
immer sehr aufgeregt und suchte hastig ein Instrument zum Öffnen. Dabei griff
sie eines Tages - ich schnitt gerade feldgraue Soldaten aus - so heftig nach
meiner geöffneten Schere, daß sie sich die Hand stark verletzte und ihr Blut
auf meinen Modellbogen tropfte, während sie den Brief las.
Unsere Ernährung machte
jetzt meiner Mutter oft große Sorgen. Aber wir hatten durch die
Landbriefträgerzeit meines Vaters einige befreundete Bauemfamilien in den
umliegenden Dörfern. Mein Bruder Alfred und ich machten jede Woche eine größere
Wanderung, um diese Bauern zu besuchen. Wir brachten immer einen Brief meiner
Mutter hin und dann einiges Eßbare im Rucksack zurück nach Hause. Selten kam
meine Mutter mit, denn sie hatte, wahrscheinlich durch die schwere Arbeit in
ihrer Jugend, deformierte Füße und bei längeren Wegen starke Schmerzen. Eines
Tages hatten wir ein schönes Stück rohen Speckes bekommen. Meine Mutter
verarbeitete es sofort zu Griebenschmalz. Als sie das heiße Schmalz in eine
Tonschüssel goß, platzte diese, und das kostbare Fett floß auf den Fußboden.
Kniend, verzweifelt und unter Tränen versuchte sie, die Kostbarkeit durch
Zusammenkratzen zu retten. Ein anderes Mal hatten wir sogar drei regelrechte Speckseiten ergattert. Um sie haltbarer zu
machen, brachte sie meine Mutter zu einem Fleischer zum Räuchern. Wir haben den
schönen Speck nie wiedergesehen. Er sei beim Räuchern in die Glut gefallen und
verbrannt. Die Verzweiflung meiner Mutter in diesem Falle ist nicht zu
beschreiben. Noch viele Jahre später war sie überzeugt, daß der Speck schlicht
geklaut worden sei.
Ostern 1916, fast sieben Jahre alt, wurde ich in der katholischen
Volksschule für Knaben in Neisse eingeschult. Im zweiten Schuljahr hatte ich
eine gefährliche Krankheit zu überstehen, Gehirnhautreizung. Sie wurde von dem
behandelnden praktischen Arzt nicht erkannt. Er behandelte mich auf
Gelenkrheumatismus, weil ich von den gräßlichen linksseitigen Kopfschmerzen,
die sich bis zur Hüfte hinzogen, ganz schief geworden war. Die Rheumasalben,
mit denen ich ständig eingerieben wurde, hatten auf der linken Oberkörperseite
schmerzliche Entzündungen hervorgerufen. Ein Nervenarzt, der sich in der
kritischen Zeit gerade in Neisse im Urlaub befand, wovon meine Mutter zufällig
von Bekannten erfahren hatte, rettete mich schließlich durch heiße Seesalzbäder
und anschließende Schwitzkuren. Drei Wochen lang mußte ich täglich eine Stunde
lang nach dem Bad im Bett schwitzen. Unsere Wohnung hatte kein Bad. Meine
Mutter trieb aber ein Monstrum von Badewanne aus Zinkblech auf, das
holzverstärkt war. Von dieser zu spät behandelten Krankheit sind wahrscheinlich
die fürchterlichen Kopfschmerzen zurückgeblieben, die mich noch bis in den
Zweiten Weltkrieg hinein quälten. Sie kamen jeden zweiten oder dritten Tag
wieder und dauerten dann 5 bis 24 Stunden. Sie waren begleitet von heftigem
Tränen der Augen und schnupfenartigen Anfällen. Ich konnte dann nichts anderes
tun, als mit geschlossenen Augen zu liegen. Ich mußte viele Stunden in der
Schule versäumen, weil diese Anfälle meistens am Vormittag einsetzten, manchmal
aber auch schon während des Schlafes in den Morgenstunden.
Im ersten Volksschuljahr hatte ich einen etwas farblosen Lehrer, im
zweiten eine sehr liebe junge Lehrerin, die uns mit Legespielen den
Rechenunterricht versüßte. Sie besuchte mich während der Hirnhautreizung, die
mich ein halbes Jahr von der Schule fernhielt, in der elterlichen Wohnung und
schenkte mir Süßigkeiten. Sie war die erste Lehrerin, die mich für meine
Zeichnungen sehr lobte.
Im dritten und vierten Schuljahr aber erwarteten mich sehr schlimme
Erlebnisse, die schlimmsten meiner Kindheit. Ich war nach Angaben meiner Lehrer
ein gutartiger und fleißiger Schüler. Trotzdem wurde ich von meinem
Klassenlehrer fast täglich wie jeder andere meiner 60 Mitschüler mit einem
daumendicken Rohrstock über die Hände geschlagen. Diese Prügelexzesse hatten
ein peinlich genaues System, dem keiner entging. Für jede falsche Antwort, für
jeden Fehler, für die kleinste Ungezogenheit wurde man auf die Handfläche
geschlagen, so daß sie sofort anschwoll. Gröbere "Verfehlungen"
trugen zwei bis drei Schläge oder mehr auf das Hinterteil ein, wobei sich der
Schüler über einen Stuhl legen mußte. Bei schriftlichen Arbeiten hatten wir die
Verpflichtung, uns bei selbsterkannten Fehlern oder einem Klecks selbst zu
melden und uns die Strafe vorn am Katheder abzuholen. Hierüber führte der
Lehrer Buch. Bei der Durchsicht der schriftlichen Arbeiten fertigte er eine
alphabetische Liste an, in der die Anzahl der Fehler jedes Schülers aufgeführt
und die selbsterkannten, gemeldeten Fehler abgezogen waren. Bei der Rückgabe
der Hefte wurde die Reststrafe nach der Liste von ihm verlesen, wir mußten in
Schlange antreten und uns die Reststrafe abholen, die dann gewissenhaft auf dem
"Blutzettel", wie wir das mit roter Tinte ausgeführte Register
nannten, abgehakt wurde. Über den Unterrichtsstunden, über dem Schulweg und
über den Schularbeiten schwebte immer eine fast erstickende Angst. Wegen der
Schmerzen, die die Schläge verursachten, habe ich nie geweint. Eines Tages -
mein Vater war gesund aus dem Kriege zurückgekehrt - konnten beim Mittagessen
meine gefühllosen, geschwollenen Hände den Löffel nicht halten, weder die
rechte noch die linke Hand. Ich versuchte es mehrere Male. Schließlich fiel
der Löffel mit auffälligem Klirren in den Teller. Durch dieses Mißgeschick verwirrt,
fing ich an zu weinen. Vater und Mutter fragten nun alles aus mir heraus.
Mein Vater, der sicher nichts von Sadismus wußte, begab sich sofort am
nächsten Tag in die Schule. Während des Unterrichts klopfte es an die Tür
unserer Klasse, sie wurde halb geöffnet, und ich sah meinen Vater in seiner
blauen Postuniform mit den goldenen Knöpfen, den roten Biesen und den goldenen
Litzen. Die Unterredung mit dem Lehrer in dem Korridor dauerte nicht lange.
Seit diesem Tage hat mich Preißner-Kolle, wie wir diesen Lehrer nannten - er
hieß Karl Preißner - nie wieder angerührt.
Ich war zum ersten Mal mit Bewußtsein stolz auf meinen Vater. Er war
stärker als mein grausamer Lehrer. Jetzt wunderte ich mich nicht mehr darüber,
daß nach dem ersten Tage bei diesem Lehrer einer unserer Mitschüler, der sehr
fein und sauber gekleidet war und aus einer angesehenen, vornehmen Neisser
Familie stammte, für einige Tage verschwand, nachdem er für eine Vorwitzigkeit
zwei Schläge über die Hand bekommen hatte. Er tauchte in einer Parallelklasse
wieder auf, die ein sehr gütiger Lehrer leitete. Er hatte sicher, so dachte ich
damals, einen ähnlich starken Vater wie ich. Erst viel später begriff ich, daß
Elternproteste gegen diesen Lehrer in aller Stille geregelt wurden, um jeden Skandal
zu vermeiden.
Die Exekutionen an meinen
armen Mitschülern gingen unverändert weiter. Eineinhalb Jahre lang mußte ich
sie noch mitansehen. Der Unterricht bei diesem Lehrer war pedantisch, phantasielos,
ohne jede Freude. Ich habe diesen Lehrer nie lachen gesehen, ich habe auch nie
die leiseste freundliche Miene in seinem hageren, harten Gesicht bemerkt.
Selbst sein Zeichenunterricht ließ uns nicht die geringste Freiheit. Alles
wurde von ihm an der Tafel vorgezeichnet und von uns mit Hilfe von Zentimetermaß,
Zirkel und Lineal auf den Zeichenblock übertragen. Die Schülerzeichnungen waren
deckungsgleich und unterschieden sich lediglich durch den Grad der Sauberkeit.
Unreparable Dreckstellen wurden bestraft. Er war der einzige Lehrer, der auch
in die Turnhalle einen Stock mitnahm. Dieser Stock war etwas kürzer als die
anderen. Er mußte in den Ärmel des Schülers passen, der ihn in die Turnhalle
transportierte.
Für den Transport der
Hefte besaß dieser Lehrer zwei aufklappbare Pappkästen, in denen je 30 Stück
untergebracht wurden. Diese Kästen mußten reihum zwei Schüler vor der Brust
auf den Unterarmen in seine Wohnung tragen, die etwa zwei Kilometer von unserer
Schule entfernt lag. Dabei war es streng verboten, diese Kästen auf einem
Mauervorsprung abzusetzen, um auszuruhen. Der Lehrer ging hinter uns her. Jede
Zuwiderhandlung wurde am nächsten Tag bestraft. Die Schmerzen in den Armen
waren sehr quälend.
Im fünften Schuljahr bekam ich einen älteren, außergewöhnlich gütigen
Lehrer. Ich ging wieder gern zur Schule, obwohl mich beim Anblick der
Volksschule immer wieder ein bedrückendes Gefühl beschlich.
Auf dem Schulweg begegneten wir oft einem freundlichen, gut gekleideten
alten Herrn, der eine Brille trug und den Kopf etwas schief hielt. Er war ein
Original. Wir glaubten, er sei ein Dichter, weil er mit uns in Versen sprach.
Ob er die Verse schon bereithatte oder sie aus dem Stegreif sagte, wußte
keiner. Um einen solchen Vers aus ihm herauszulocken, fragten ihn die kleinen
Schulgänger irgend etwas, z.B. wie spät es sei. Seine
Antwort war einmal:
Es ist gleich acht. Geh `nur nicht zu sacht.
Sondern geh `recht
schnell,
sonst gerbt Dir der Lehrer
das Fell mit dem Stock und mit der Ell`.
Ein kleiner Junge, der ihn
ein andermal das gleiche fragte und ihm dabei seine ungeputzte Nase präsentierte,
bekam zur Antwort:
Je Josel!
Du hast ja `n rotzig
Nosel.
Ein anderes Original, das wir
Kinder sehr liebten, war der Potschen-Schulze. Dieser hatte in der Breslauer
Straße nahe am Ring, der der unverkennbare Mittelpunkt der Stadt war, in einem
geräumigen zweckentfremdeten Hausflur einen Laden eingerichtet, in dem er
Schuhe, aber hauptsächlich Arbeitsschuhe und Potschen, wie wir in Schlesien die
warmen Hausschuhe nannten, verkaufte. Besonders die Landbevölkerung kaufte gern
bei ihm.
Dieser Hausflurladen war schon dadurch eine Sehenswürdigkeit, weil er
auf eine kaum vorstellbare Weise mit Bergen von Schuhen, mit Pappkartons und
von oben herabhängenden Schuhpaaren vollgestopft war. Seine Türen standen
Sommer wie Winter weit offen und gaben den Blick auf den ganz vorn stehenden
Käfig frei, in dem ein zahmer Marder hauste. Zur Mittagszeit, wenn die Schule
aus war, fand sich dort täglich eine Schar Kinder ein. Wenn sie groß genug war,
ging der etwas behäbige, bei Kälte abenteuerlich vermummte Potschen-Schulze zu
dem schräg gegenüberliegenden Schönen Brunnen, legte in dessen schmiedeeisernen
Käfig ein rohes Hühnerei, kam wieder zurück, öffnete das kleine Käfigtürchen,
und der Marder flitzte in Windeseile über die Straße zu dem Ei, fraß es auf und
kam, so schnell er konnte, wieder in seine Behausung zurück.
Die Grabenstraße, in der wir wohnten, kannten wir in allen Einzelheiten.
Die Häuser waren fast durchweg Mietshäuser, die aus Vorder-, Seiten- und
Hinterhaus bestanden. Jedes sogenannte Hinterhaus grenzte an eine
Parallelstraße und hatte dort auch einen Hauseingang. Infolgedessen gab es
viele Durchgänge zwischen den Parallelstraßen. Wir kannten alle diese
Durchgänge, Höfe und dunklen Korridore, ein wahres Labyrinth für unsere
Versteck-, Verfolgungs- und Räuberspiele, die immer mit einem Riesengeschrei
verbunden waren. Kein Wunder, daß wir dabei von den braven Bürgern und
Handwerkern oft mit kräftigen Schimpf- und Fluchwörtern, auch mit Schlägen,
Fußtritten und Wurfgeschossen vielfältiger Herkunft bedacht wurden.
Unsere Wohnung in der Grabenstraße lag im zweiten Stock und war eine
Zweizimmerwohnung mit Küche. Diese drei Räume lagen in einer Linie
hintereinander. Das Zimmer, das zur Grabenstraße hin lag, war das Schlafzimmer
meiner Eltern mit Ehebett und Kleiderschrank und gleichzeitig eine Art gute
Stube mit einem grünen, plüschbezogenen Sofa, mit einem ovalen Tisch davor,
einem Vertiko, auf dem Nippes und Fotografien standen, und einem Spiegel, der
schräg zwischen den beiden Fenstern über einem zweibeinigen Wandziertischchen
hing, auf dem wiederum ein Spitzendeckchen lag und zwei überschlanke Glasvasen
standen, in denen merkwürdige Puschel steckten. Wahrscheinlich charakterisiert
man diesen Raum als ein ziemlich ärmliches Derivat eines Makart-Zimmers. In ihm
stand auch später ein Hügel, den die Eltern - sicher unter großen Opfern - für
uns gekauft hatten. Eine Tür führte direkt zum Treppenhaus, war aber
verschlossen und mit einem Regal ausgestattet, in dem meine Mutter das Eingemachte
aufbewahrte.
Das andere Zimmer war genauso groß, etwa fünf mal sechs Meter, und lag
zum Hof. Das war das Wohnzimmer, in dem sich unser Leben abspielte. Vor einem
der beiden Fenster stand die Nähmaschine, zwischen den Fenstern der
Schneidertisch, an dem ich auch basteln durfte, an den Wänden standen die
Betten für Alfred und mich, ein Sofa, ein schmaler Geschirrschrank, eine
Kommode und ein Kleiderschrank, in der Mitte vor dem Sofa ein einfacher
Ausziehtisch, der unser Eßtisch und Vaters Zuschneidetisch zugleich war.
Die Küche lag zwischen den beiden Zimmern am Treppenhaus und war mit
ihnen durch Türen verbunden, die je vier große Scheiben aus Milchglas mit
durchsichtigen Blümchenmustern aufwiesen. Die Küche hatte keine Fenster. In
einer ihrer Ecken war ein Holzverschlag, hinter dem sich das Wasserklosett
verbarg, das ein Lüftungsfenster zum Treppenhaus besaß. Außerdem waren in der
kleinen Küche noch ein gekachelter Kochherd, eine Küchenkommode, ein
Speiseschrank und ein Waschständer zu finden und eine Tür, die zum Treppenflur
führte, die also unser Wohnungseingang war.
Aus dem Fenster der Guten Stube erblickte man gegenüber
die Fassade des Stadttheaters und die breite, hohe Mauer mit dem großen
Eingangstor zum Armenhaus, das gleichzeitig auch das Polizeigefängnis enthielt.
Wir erlebten als Kinder oft, wie mit Handschellen gefesselte Männer durch das
große Tor geführt oder auch sinnlos Betrunkene, die oft lauthals johlten, auf
zweirädrigen Schubkarren von Polizisten hineingeschoben wurden. Ich erinnere
mich, daß diese beiden verschiedenartigen städtischen Institute mir als Kind
viel zum "Denken" aufgaben.
Die Fenster des Wohnzimmers sahen zum Hof und zum Seitenhaus, in denen
die Waschküche, der Lokus für die Parterrewohnung, eine Sattlerwerkstatt und
ein Holzschuppen mit Kaninchen- und Gänseställen untergebracht waren. Der Hof
besaß außerdem eine Teppichklopfstange, einen großen Holzklotz zum Holzhacken,
eine Wasserleitung, die Müllkästen und eine Dunggrube, aus der es bei
bestimmter Witterung dampfte. Dreimal am Tag konnten wir vom Fenster aus unten
die alte Buhlen, die Mutter der Buhl-Grete, beobachten, wie sie ihre Gänse mit
Gänsenudeln stopfte.
Unser Wohnhaus hatte im Parterre einen Stall, in dem zwei Pferde,
manchmal auch mehr, gehalten wurden, deren Stampfen man bis in unsere Wohnung
hinauf im zweiten Stock deutlich vernehmen konnte. Die Haustür war breit und
hoch und führte in eine breite Durchfahrt bis zum Hof, damit man leicht den
Dung abholen konnte. In dieser Durchfahrt standen immer zwei bis drei Wagen.
Solange ein Droschkenkutscher in der Einzimmerparterrewohnung mit Frau und zwei
hübschen Töchtern wohnte, standen da zwei Droschkenkupees, deren blitzblank
schwarze Lackierung mit roten Zierstrichen abgesetzt war. Wir sahen diesem Mann
gerne zu, wie er die Wagen, die Pferde und deren Geschirre pflegte und putzte.
Auch der Sattler, der bei gutem Wetter meistens im Hof arbeitete, fand
bei uns großes Interesse. Jede seiner Arbeiten war für mich spannend: wie er
das Sattlergarn an einem Ende aufzwirbelte und mit Pech und Wachs eine
Schweinsborste daran befestigte, wie er mit seinem scharfen Messer das Leder schnitt
oder abflachte, wie er mit seiner Ahle die Löcher stach und mit zwei vorbereiteten
Fäden das Leder nähte, wie er die Federböden für Matratzen und Polsterstühle
herstellte, das Polster aus Jute und Werg machte und schließlich die ganze langwierige
Arbeit mit farbig leuchtenden und gemusterten Stoffen überzog. Beim Arbeiten
konnte er ununterbrochen spannende, skurrile und gruselige Geschichten
erzählen aus seiner Jugend, seiner Lehrzeit und seiner Wanderzeit als
Handwerksgeselle. Er hatte eine starke Phantasie. Wir glaubten ihm nicht alles,
was er heraussprudelte. Oft stellte er seine Erzählung selbst in Frage, indem
er der Geschichte eine überraschende Wendung gab und sie mit einem Witz
beendete, der sehr drastisch sein konnte. Mit seinem Sohn Max, der mit uns
gleichaltrig war, waren wir befreundet, und da er schon als Schuljunge bei
seinem Vater arbeitete, konnte er uns beibringen, wie man schadhafte
Schlagbälle und Fußballhüllen selbst reparierte. Werkzeuge, Lederabfälle und
Garn durften wir der väterlichen Werkstatt entnehmen.
Über uns im dritten Stock wohnten zwei sehr arme Familien. Ihre kleinen
Wohnungen bestanden aus nur einem Mansardenzimmer und einer Küche, die kein
Fenster hatte. Bei der einen Familie, die nur einen Sohn hatte, der die Englische
Krankheit durchgemacht und deswegen einen verwachsenen Brustkorb und krumme
Schienbeine zurückbehalten hatte, kam fast jedes Jahr ein Kind zur Welt, das
aber schon nach einigen Tagen oder sofort nach der Geburt starb. Mehrere Male
habe ich diese kleine Familie zum Friedhof gehen sehen. Die Mutter trug den
winzigen weißen Kindersarg auf den Armen vor sich her, ihr zur Seite ging der
Vater mit dem kleinen Paulchen an der Hand.
Die andere Familie hatte acht Kinder, von denen einige auch körperliche
Fehler hatten. Die Kinder waren tagsüber oft allein, weil beide Elternteile
arbeiteten. Die älteste Tochter war noch schulpflichtig. Sie versorgte, so gut
es eben ging, ihre sieben Geschwister, bis die Mutter von ihrer
Nachmittagsarbeit zurück war. Meine Mutter stieg fast jeden Tag einmal hinauf,
um nach dem Rechten zu sehen. Eines Tages, als sie vom Einkaufen zurückkam,
sagte sie, sie habe im Treppenhaus Brandgeruch bemerkt, sie wolle mal schnell
zu den Ferschkekindern hinaufgehen, es könne ja sein, daß sie mit
Streichhölzern gespielt hätten. Ich ging mit hinauf. Das Wohnzimmer war voller
Rauch. Wir machten beide Fenster auf und suchten nach der Ursache. Meine Mutter
entdeckte einen feuchten Strohsack, den jemand zum Trocknen zwischen den
überheizten Kachelofen und die Wand gestopft hatte. Sie war umsichtig genug,
zuerst mit mir mehrere Eimer voll Wasser bereitzustellen und dann erst den
Strohsack hervorzuziehen. Tatsächlich schlug sofort eine Flamme hoch, die mit
einem Eimer Wasser gelöscht werden konnte.
Die Grabenstraße, in der viele solcher armen Leute wohnten, hatte viel
Interessantes zu bieten. Theater und Armenhaus mit Polizeigefängnis erwähnte
ich schon, dazu kamen noch die Druckerei der Neisser Zeitung, die
Handelsschule, die Bischofsmühle mit ihrem dauernden mahlenden Geräusch im
Innern und dem tosenden fallenden Wasser der Biele, eines Nebenflusses der
Glatzer Neisse, und mit den vielen Bauernwagen vor ihrem Tor, jenseits der
Biele der barocke Bischofshof, die ehemalige Residenz der damaligen Neisser
Bischöfe, dann das Heimatmuseum und das Landgericht, das allerdings seinen
Haupteingang in der Bischofstraße, einer Parallelstraße, hatte. Außerdem gab es
noch zwei Gasthäuser, einen Lumpenhändler, einen Töpfermeister, zwei
Bäckereien, eine Tischler- und Stellmacherwerkstatt und ein
Kolonialwarengeschäft. In der Handelsschule war die katholische
Sankt-Borromäus- Bibliothek untergebracht, aus der wir unsere ersten Bücher
entliehen.
Eine besondere Attraktion war das sogenannte Fleischerfest, auch Hussitenfest
genannt, das die Fleischerinnung alljährlich zur Erinnerung an die Hus-
sitenschlacht bei Neisse, in der die Neisser Fleischer sich besonders tapfer
gezeigt hatten, mit großem Umzug feierte. Anfang des 15. Jahrhunderts war
Neisse von den Hussiten belagert worden. In einem Ausfall der Bürgerwehren
sollen die Fleischer mit ihren berufseigenen Werkzeugen eine beispiellose
Metzelei unter den Belagerern angerichtet und deren Flucht erzwungen haben. Im
Festzug wurden mittelalterliche Kostüme gezeigt und die Beutestücke, wie Waffen
und Fahnen, mitgeführt. Die Mitglieder der Fleischerinnung fuhren in Kaleschen
und Landauern, die jüngeren nahmen hoch zu Roß teil, alle in knallroter
Kleidung mit schneeweißen Schürzen. Selbstverständlich war auch eine große
Bläserkapelle beteiligt. Der Zug entfaltete sich am Gasthof zum Deutschen Haus,
der schräg gegenüber unserer Wohnung lag, so daß wir aus unseren Wohnungsfenstern
dem bunten Treiben genußvoll zusehen konnten.
Auch die Märkte in der Stadt Neisse lagen nur 100 bis 300 Meter von der
Grabenstraße entfernt. Unser Schulweg ging mitten durch den Kartoffelmarkt,
der eigentlich ein Bauernmarkt war und jeden Sonnabend stattfand. Das
lebhafte Durcheinander von Bauern, Pferden, Käufern, das Schreien, Feilschen,
Schimpfen, Rufen zwischen Säcken und Feldfrüchten, das Quieken der jungen
Schweine usw. verzögerte unseren Schulweg jedesmal, so daß wir nach einem Blick
auf die Rathausuhr dann bis zur Schule rennen mußten, um zurechtzukommen.
Anschließend, vor der Fassade der Mädchenschule, fand man den Buttermarkt, wo
die Bäuerinnen Butter und Eier in Körben feilboten. Nicht weit davon auf dem
Ring, dem Mittelpunkt der Stadt, war der alltägliche Gemüsemarkt und einmal
wöchentlich der Geflügelmarkt, auf dem Hühner, Gänse, Enten, Tauben und auch
Kaninchen lebend verkauft wurden. Die Märkte wimmelten immer von Menschen,
manchmal war kein Durchkommen.
Trotz dieser für Kinder
sehr attraktiven Wohngegend besuchten wir mit Begeisterung unsere Großeltern in
Schalkowitz. Den primitiven ländlichen Haushalt, die Tiere, die Feldarbeit, das
Brotbacken, den Holzschuppen mit den Werkzeugen, die Fahrten zum Bahnhof und
zurück in der Postkutsche mit dem Großvater, die Weiten der Felder und die
riesigen geheimnisvollen Wälder, das Beeren- und Pilzesammeln, die
Storchennester auf den strohgedeckten Dächern, die hölzernen Windmühlen
liebten wir mehr als alles, was uns die Stadt bot.
Während meiner Volksschulzeit habe ich viel gemalt. Zum Geburtstag
wünschte ich mir immer sogenannte Malbücher und Farben, später Zeichenblöcke.
Wenn mich meine Eltern zu einem Besuch bei Bekannten mitnahmen, wurde ich von
diesen sofort mit Papier und Farben oder Bleistift versorgt. Bis zum Heimweg
brauchte sich dann niemand mehr um mich zu kümmern. Ich fand auch immer
jemanden, der mir weiterhalf. In der Nachbarwohnung wohnte die Juretzka-Trude,
eine Verkäuferin, die in einem Papiergeschäft arbeitete. Sie schenkte mir oft
angeschmutztes Papier und lädierte Modellbau- und Ausschneidebogen. In der
Wohnung unter uns lebte die Buhl-Grete, eine Schneiderin. Sie brachte mir den
Umgang mit Aquarell- und Pastellfarben bei und half mir bei komplizierten
Basteleien mit Rat und Tat. Ich habe sie sehr bewundert. Ich durfte zu ihr
kommen, wann ich wollte, und immer ließ sie sofort ihre Schneiderarbeit liegen,
um mir zu helfen. Meine verpfuschtesten Basteleien konnte ich unter ihrer Anleitung
wieder in Ordnung bringen. Besonders die Modellbogen machten mir oft Kummer,
weil mir nur Mehlkleister zur Verfügung stand. Das von mir heiß begehrte
Syndetikon, ein Fischleim, war zu teuer. Schwierige Stellen, die nicht halten
wollten, hat sie mir mit großer Geschwindigkeit von Hand zusammengenäht.
Sehr aufregend war es für mich, als mein Vater eines Tages aus Rußland
schrieb, er wohne an der Front im Unterstand mit einem Kunstmaler zusammen, und
dieser habe sich sehr lobend zu meinen Briefmalereien geäußert. Ich wurde,
soweit ich mich erinnern kann, überhaupt sehr gelobt für meine Malereien usw.
Die Erwachsenen fanden, daß ich ein stilles und problemloses Kind sei.
Allerdings verhielt ich mich ganz anders, wenn ich mit Spielkameraden auf der
Straße oder in der Umgebung unserer Kleinstadt unterwegs war.
Mein Bruder Alfred und ich hatten sehr unterschiedliche Interessen.
Während er schon mit sieben Jahren Bücher verschlang, saß ich in einer Ecke der
Wohnung und spielte. In der Vorschulzeit beschäftigte ich mich oft mit einer
Burg, die ich zu Weihnachten bekommen hatte. Sie war sehr klein und unscheinbar,
und die Soldaten und Reiter, die mir gleichzeitig beschert wurden, waren viel
zu groß dazu, größer als die Gebäude der Burg. Ich kann mich nicht erinnern,
was genau in mir vorging, wenn ich mit dieser Burg spielte. Aber es muß sich
damals in meiner Phantasie und meiner Vorstellung viel begeben haben. Das
wirkt sich noch heute aus. Ich kann an keiner Burg vorbeikommen, ohne eine
tiefe Enttäuschung zu empfinden, wenn Zeit oder Gelegenheit fehlen, sie zu
besichtigen.
Noch lieber waren mir die Holzbaukästen. Eigentlich besaß ich nur einen
kleinen, Alfred besaß einen größeren; da er aber lieber Bücher las, konnte ich
mit beiden spielen. Ich baute mit Vorliebe Türme. Ich versuchte, sie immer
höher zu bauen. Je höher sie waren, desto leichter fielen sie um, meistens
schon, bevor sie fertig waren. Das enttäuschte mich nicht. Das Bauen machte mir
anscheinend mehr Spaß als der fertige Turm.
Fertige Spielzeuge liebte ich nicht. Lieber waren mir solche, die ich
verändern, vervollständigen, durch einiges Dazubasteln ergänzen konnte. Mein
Bruder Alfred besaß einen Dampfer mit Schiffsschraube zum Aufziehen, der
tatsächlich im Wasser Fahrt machen konnte. Ein solches Spielzeug interessierte
mich überhaupt nicht. Begeistert war ich, als zwei Glücksfälle zusammentrafen.
Ich fand am Ufer der Neisse einen etwa 60 cm langen Schiffskörper aus massivem
Holz. Und da ich noch etwas früher ein solides Taschenmesser gefunden hatte,
das außer den beiden Messerklingen noch fünf weitere Werkzeuge aufwies, war
mein Glück voll. Der Schiffskörper wurde von mir mit Hilfe dieses Werkzeuges
mit Takelagen phantastischster Art ausstaffiert, mit bunten Segeln und Wimpeln
und Fahnen, und ich konnte kein Ende finden, die Masten mit möglichst vielen
Zwirnsfäden zu verspannen und mit Strickleitern und Fähnchen zu versehen. Als
alles fertig war, ließ ich das Schiff in der leichten Strömung des schmalen
Wallgrabens fahren und lief unermüdlich mit einem langen Stock daneben her, um
es zwischen den Sumpfpflanzen durchzulotsen. Ältere Kinder, die mir dabei
zusahen, kritisierten, daß es so ein Schiff wie meines überhaupt nicht gäbe.
Ich sah ein, daß sie recht hatten. Aber als sie mich deswegen verspotteten,
stand ich ihnen verständnislos gegenüber.
Der Wallgraben - ein kaum zwei Meter breiter, künstlicher Wasserlauf,
der in früheren Zeiten zum Fluten der Festungsanlagen benutzt worden war, zog
mich immer wieder an. Abgesehen davon, daß man in seinem seichten Wasser im
Sommer herumwaten konnte, besaß er eine vielfältige Unter- und Überwasserwelt,
die mich oft sogar mein geliebtes Segelschiff vergessen ließ: Wasserläufer,
Libellen, Blutegel, Salamander, die schönen großen Gelbrandkäfer und große
Fische, Hechte, Neunaugen und Weißfische und ganze Schwärme kleinerer Fische,
aber auch Schlangen gab es da, hauptsächlich Ringelnattern und
Blindschleichen, aber auch große und kleine Kreuzottern, vor denen mich meine
Eltern immer wieder warnten. Und dann das unermeßlich große Volk der grünen und
braunen Wasserfrösche.
Besondere Freude machte es
mir, mit einem älteren Jungen aus der Grabenstraße, er hieß Willi Reu, im
Wallgraben fischen zu gehen. Er fing die Fische mit einer Blumendrahtschlinge,
die an einem etwa 1,50 m langen Stock befestigt war. Wenn wir einen Fisch
entdeckt hatten, der gegen die Strömung, nur mit den beiden Seitenflossen
regulierend, stillstand, fädelte Willi vorsichtig die offene Schlinge von
hinten über die Schwanzflosse bis zur Mitte der Rückenflosse, riß dann
blitzschnell den Stock nach oben und der Fisch flog in hohem Bogen, von der
Schlinge fest umschlossen, ins Gras neben dem Graben. Von diesen Fischzügen -
die Beute betrug meistens nach stundenlangem Lauern und Suchen nur zwei bis
drei Stück - erzählte ich eines Tages meiner Mutter. Sie war entsetzt. Das sei
Diebstahl, was wir da trieben. Sie verbot mir sogar, mit diesem Jungen, den ich
sehr bewunderte, weiterhin mich zu treffen.
Wir kannten eine große Anzahl von Spielen. Im Frühjahr fing es an mit
dem Kreiseln. Die Peitschen machten wir uns selbst. Die Kreisel konnte man kaufen:
Kegel, Eier, Pilze. Die Pilze taugten nicht viel. Wir wußten noch nichts davon,
daß diese bunten Dinger sich beim Drehen durch die Zentrifugalkraft aufrecht
hielten. Aber wir wußten aus Erfahrung, daß die kopflastigen Pilze leichter bei
einem Hindernis umfielen als die Eier und die Kegel. Das Spiel mit den bunten
Reifen, die man in Läden kaufen konnte, verachteten wir; die waren für kleine
Kinder. Wir benutzten richtige Fahrradreifen mit Speichen, natürlich ohne die
Gummibereifung, weil sie so nackt und bloß viel schöneren Krach machten, besonders
auf dem Katzenkopfpflaster. Aber auch kleine und große Kinderwagenreifen, nach
denen wir eifrig auf dem Schuttabladeplatz auf Suche gingen, waren sehr
beliebt. In die Nabe solcher Reifen wurde ein 10 cm langes Holz gekeilt, an dem
man mit einem Stock beim schnellsten Laufen das Rad leicht und sicher vorwärtstreiben
und präzise lenken konnte.
Sowie die sommerliche Wärme sich bemerkbar machte, fing das Schippein an.
So nannten wir das Spielen mit Murmeln um Murmeln. Dieses Spiel war die Börse
der Straßenkinder. Die "Währungseinheit" war die kleine Lehmkugel,
die mit einer stumpfen Farbe überzogen war, die sich beim Spielen bald
abnutzte. Glänzend lackierte Lehmkugeln waren schon 2 bis 3 Einheiten wert, sie
hießen die Zweier und Dreier. Stahlkugeln aus Kugellagern und bunte Glaskugeln
waren je nach Größe sehr wertvoll: Fünfer, Zehner usw. bis Hunderter. Wenn die
Schippelsaison durch Voreilige eröffnet war, ging kein Kind mehr ohne seinen
Schippelsack, in dem die Kugeln verwahrt wurden, auf die Straße. Wer ein solches
Glücks- und Geschicklichkeitsspiel wagen wollte, suchte sich einen Partner und
handelte mit ihm aus, um wieviel Einheiten gespielt werden sollte. Dann suchten
sich beide auf dem Bürgersteig ein Loch. Die Löcher waren noch vom letzten Jahr
vorhanden und lagen nahe an den Häusern. Die beiden Spieler stellten sich nun
in den Rinnstein, und jeder warf seine Kugeln. Wer die meisten dabei ins Loch
getroffen hatte, fing mit dem Schippein an. Die außerhalb des Loches liegenden
Kugeln mußten mit dem Daumen über den Zeigefinger oder umgekehrt ins Loch
geschnipst werden. Traf eine Kugel nicht ins Loch, kam der andere dran.
Gewonnen hatte der, der die letzte Kugel ins Loch bugsierte. Der technische
Vorgang war genau festgelegt. Schieben der Kugeln war nicht erlaubt. Für manche
Kinder war es schwierig, einen Partner zu finden. Das waren die sogenannten
Säckler. Sie waren an den wohlgefüllten großen Kugelsäcken zu erkennen. Die
Mädchen waren geschickter als die Jungen. Aus ihren Reihen kamen die meisten
Säckler. Um einen Partner zu finden, mußte ein Säckler etwas anbieten, z.B.
einen Zwanziger gegen zehn Einer. Man tauschte auch die Kugeln, so wie man Geld
wechselt, z.B. eine Dreißiger gegen drei Zehner. Das alles ging nicht immer
ohne Streit ab. Denn viele versuchten durch Tricks, den anderen zu
übervorteilen. Wir nannten das schlicht "bescheißen". Bei den Keilereien
gab es Tränen, zerkratzte Gesichter, ausgerissene Haare, Beulen und blutende
Nasen. Wir waren eben richtige Straßenkinder in der Grabenstraße. Aber ich muß
auch sagen, unsere Kindheit war dadurch lebendig, daß die Grabenstraße Kinder
in Hülle und Fülle aufwies. Immer fand man einen Partner zum Spielen.
"Pferd und Kutscher" spielten wir oft sechsspännig. Dazu mußten sich
sieben Jungen zusammenfinden.
An Ballspielen kannten wir "Kaiser, König, Bettelmann",
Freiball, Völkerball und natürlich auch Schlagball und Fußball. Alles barfuß
auf Granit-, Mosaik- und Katzenkopfpflaster. Unsere Knie und Fußballen waren
voller Wunden, die oft lange eiterten und, noch nicht ganz verheilt, schon
wieder aufgerissen wurden.
Die Mädchen hatten ihre eigenen Spiele. Bei jedem einigermaßen schönen
Wetter hörte man sie bei ihren Ringelreihenspielen singen: "Häschen in der
Grube", "Kriechel durch, kriechel durch, durch die goldne
Brücke", "Dreh Dich nicht um, der Plumpsack geht um", "Wir
wollen heiraten" usw. Ein Ballspiel, bei dem es um die Ermittlung der
geschicktesten Spielerin ging, war besonders beliebt. Zehn verschiedene Arten,
den Ball an eine Hauswand zu werfen und wieder aufzufangen, steigerten sich im
Schwierigkeitsgrad. Wenn der Ball auf die Erde fiel, kam die nächste Spielerin
dran. Wer zuerst alle zehn Übungen fehlerfrei absolviert hatte, war die
Siegerin.
Am beliebtesten war bei den Mädchen Himmel-und-Hölle-Hopsen, deren
Kästchenfiguren mit Kreide auf die Bürgersteige gezeichnet waren. Überall und
unermüdlich hopsten die Mädchen auf einem Bein, auf zwei Beinen, mit
gekreuzten Beinen, in der Hockstellung oder blind mit geschlossenen Augen über
die gezeichneten Rechtecke und Halbkreise.
Das Drachensteigen kannten wir natürlich auch, aber die Drachen, die man
kaufen konnte, schätzten wir nicht, weil sie durchweg so alberne Gesichter hatten,
nie richtig funktionierten und viel zu viel Geld kosteten. Wir bauten uns
lieber unsere Windspiele selbst, die nicht viel Arbeit machten, eine japanische
Leichtigkeit hatten und uns nicht viel kosteten. Wir brauchten hierzu Zwirn,
Wurstspeiler und farbiges Seidenpapier, außerdem eine Rolle starken Zwirns,
möglichst 150 Meter. Den Köpfen oder Tragflächen gaben wir die Form eines
regelmäßigen Vier- oder Sechsecks. Zwei bis drei Wurstspeiler wurden in ihren
Maßmitten zusammengebunden und bildeten die Diagonalen, um deren Enden mit
Zwirn die Kantenlinien gespannt wurden. Diese federleichten Gebilde wurden mit
Seidenpapier bespannt. Der Schwanz war ein Zwirnsfaden, in den viele 20 cm
lange Papierstreifen und am Ende eine ebenso lange Papierquaste eingeknüpft
waren. Vorn wurde an dem Kopf die Steigeschnurwaage und hinten die Schwanzwaage
aus Zwirn angeknüpft. Nach der Befestigung des Schwanzes wurde mit dem
Windspiel ein Probelauf gemacht, um zu ermitteln, ob noch Korrekturen an den
Waagen und an der Schwanzlänge erforderlich waren. Erst wenn das Windspiel
beim Laufen in einer leicht schräg aufwärts gerichteten Linie dahinschwebte,
den Kopf ruhig hielt und der Schwanz sich sanft schlangenhaft bewegte, konnte
die Freude des Drachensteigens beginnen.
Die primitiven Fallschirmballons oder wie man sie nennen soll, machten uns auch viel Freude, obgleich sie nach einmaligem
Benutzen meistens schon verloren waren. Sie bestanden lediglich aus einem
quadratischen, taschentuchgroßen Seidenpapier und 4 Fäden, die an den Ecken
des Papiers angeknüpft und an ihrem anderen Ende zusammengeknotet und mit einem
kleinen Gewicht, z.B. mit einer Streichholzschachtel, versehen wurden. Bei
Aufwind an den Häuserfronten stiegen sie leicht in die Luft und verschwanden
dann über den Dächern. Unter großem Gebrüll verfolgten wir sie mit Augen und
Beinen, solange es möglich war. Nur selten erlebten wir die Freude, sie noch
einmal zu erwischen. Meistens verfingen sie sich schon beim Aufsteigen an den
Häuserwänden an Blumenbrettern, Haussimsen, Dachrinnen und Telefonleitungen.
Nur wenige machten uns die große Freude, das freie Luftgebiet außerhalb der
Stadt zu erreichen und in weite Ferne zu entschweben.
Meine Mutter hatte mit der Wohnung in der Grabenstraße viel Arbeit und
Kummer. In unserer Toilette, die diesen vornehmen Namen kaum verdiente, war das
Becken mit einem Bretterverschlag umgeben, so daß sich der darunter befindliche Raum jeder Kontrolle entzog. Jedenfalls
vermutete meine Mutter, daß das Mauerwerk um die Abwässerrohre sehr locker und
schadhaft sein müsse. Sie hatte Grund genug für diese Annahme, weil immer
wieder Mäuse in unsere Wohnung gelangten. Nachdem aber eine fangbereite
Mäuseschlagfalle ständiges Requisit unserer Toilette war, kamen sie nur noch
bis zu dieser letzten Station. Meine Mutter hörte im tiefsten Schlaf das
Zuschlagen der Falle. Sie stand dann sofort auf, um die tote Maus durch den
Lokus zu spülen und den Schlagbügel wieder zu spannen. In manchen Nächten ist
sie mehr als fünfmal aufgestanden. Ein weiterer großer Kummer war die
hoffnungslose Verwanzung des Hauses. Meiner Mutter wurde dadurch peinlichste
Sauberkeit abverlangt. Kein Wunder, daß diese brave Frau freudig auflebte, als
wir endlich in eine andere Wohnung umziehen konnten, die allerdings auch nicht vollkommen
war.
Unsere Kinderzeit neigte sich schon ihrem Ende zu, als 1920 unser Bruder
Hans zur Welt kam. Alfred und ich wurden von jetzt an als die Großen
bezeichnet. 1925 kam noch Konrad hinzu, als wir schon in einer anderen Wohnung
lebten. Beide Brüder kamen von Alfred und mir unbemerkt zur Welt. Meine Mutter
war so korpulent, wie sie das selbst nannte, daß ihr niemand ansehen konnte,
daß sie ein Kind trug. Hans wurde nachts geboren. Am Morgen kam unsere Mutter
uns mit offenem Haar - wir sahen sie sonst nur frisiert - wecken; sie hatte
das Frühstück vorbereitet und sagte, sie müsse sich gleich wieder hinlegen, sie
sei heute etwas schwach. Und dann ging sie mit uns an ihr Bett und zeigte uns
den neuen Bruder. Alfred und ich waren damals zwölf und elf Jahre alt. Hans
wurde so etwas wie ein fortschrittliches Spielzeug für uns. Besonders ich nahm
mich des Säuglings an. Ich wußte bald, wie man ein Kleinkind anfassen
und wie man es trockenlegen und in die Windeln wickeln konnte. Auch fuhr ich
den Kleinen mit dem großrädrigen Kinderwagen spazieren, nahm die Schularbeiten
mit und arbeitete auf irgendeiner Bank im Park oder in den Festungsanlagen. Als
dann ein Sportkinderwagen, wie man das damals nannte, für die Ausfahrten
benutzt wurde, fand auch Alfred Gefallen daran. Jedes kleine Gefälle der Wege
wurde von uns ausgenutzt, um selbst mitzufahren. Nach einem kurzen Anlauf
stellte sich der Wagenlenker auf die Hinterachse, und hinunter ging's im
Karacho unter dem vergnügten Kreischen des kleinen Bruders. Zum Leidwesen der
Mutter war die Hinterachse bald verbogen, und die Räder eierten alle vier. Als
Hans laufen konnte, benötigten wir den Sportwagen nicht mehr. Alfred und ich
waren sehr kräftig, so daß unser Schutzbefohlener auf unseren Schultern reiten
konnte, wenn er müde war. Er konnte alle unsere Streifzüge mitmachen.
Einmal - Hans benutzte gerade mich als Pferd - hatte ich am Hals ein sehr
klebriges Gefühl. Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, daß das Brüderchen,
das noch nicht ganz stubenrein war, beim Reiten seinen natürlichen
Bedürfnissen freien Lauf gelassen hatte. Erst waren wir ratlos. Dann ließ ich
ihn einfach wieder aufsitzen und trabte mit ihm nach Hause, wo uns die Mutter
mit kundiger Hand von dem Kleister befreite und wir den Ausritt von neuem
beginnen konnten.
In den Festungsanlagen tauchte oft ein Mann auf, der die Aufgabe hatte,
darüber zu wachen, daß die noch benutzten Wagenhäuser und Kasematten nicht
erbrochen und die verpachteten Grasflächen nicht zertrampelt wurden. Wir
nannten ihn den Schnicksack, weil er ältere Kinder, die er manchmal erwischte,
verschnickte (schlesischer Ausdruck für verhauen). Uns hat er, auch wenn wir
Hans bei uns hatten, nie erreichen können, denn wir konnten mit unserem Reiter
ein gewaltiges Tempo rennen.
Als wir 1924 in die Obermährengasse umzogen, war Hans inzwischen dank
unserer Erziehung ein wilder und temperamentvoller Junge geworden. Wir beiden
älteren waren mit der höheren Schule, mit den Schularbeiten und mit unseren
vielen Stundenschülern voll beschäftigt. Die einzige Extravaganz, die wir uns
noch leisteten, war ein Taubenschlag, den ich in unsere Bodenkammer unter dem
Dach einbaute. Die Tauben besorgte Alfred. Er bekam sie von den Eltern einiger
Stundenschüler geschenkt, die aus den umliegenden Dörfern kamen. Unsere Freude
dauerte nicht lange, weil die geliebten Tierchen, es waren hauptsächlich
Strasser, Kröpfer und Pfauentauben, sich so schnell vermehrten, daß sie zur
Plage wurden. Sie saßen auf den Dächern und flogen um unser Wohnhaus herum,
machten viel Dreck und weckten im Sommer die Bewohner schon früh um vier Uhr
mit ihrem Gurren. Für die kleinen Brüder Hans und Konrad hatten wir nur noch
wenig Zeit übrig. Wir brachten ihnen das Radfahren bei, nachdem wir ihnen ein
Fahrrad von unserem durch Stundengeben verdienten Geld gekauft hatten. Sie
wurden die reinsten Radartisten und fuhren wie die Teufel.
Mein Basteleifer bekam in der neuen Wohnung eine neue Richtung. Ich baute
mehrere Flugzeugmodelle, die mir den Gefallen taten, zu fliegen. Als die ersten
Radiogeräte auftauchten, diese geheimnisvollen Detektorengeräte mit
Kopfhörern, mußte ich natürlich auch so ein Ding haben und baute es selbst. Ich
baute zunächst das primitivste, um dann ein komplizierteres mit
selbstgewickelten Induktionsspulen folgen zu lassen. Ich fand auch einen
Radioeinzelteilhändler, der mir viel beibrachte, so daß ich schließlich große
Apparate mit vier bis sechs Röhren baute, hauptsächlich für die Nachbarn in
unserem Haus. Schließlich baute ich noch einige Apparate, die den Netzstrom für
die Radioapparate transformierten, so daß wir auf den Akku, der immer wieder
aufgeladen werden mußte, und auf die Anodenbatterien, die teuer waren und sehr
schnell leer wurden, verzichten konnten. Ich wurde für diese Radiobasteleien
von meinen Auftraggebern immer fürstlich entlohnt, wie ich meinte, denn alle
bezahlten mehr, als ich verlangte.
Die Obermährengasse lag in der Friedrichstadt, einem Stadtteil nördlich
des Neisseflusses. Die Friedrichstadt war von Friedrich dem Großen
hauptsächlich als Kasernenstadt angelegt worden. Sie besaß daher eine stattliche
Zahl von Kasernenbauten und einen riesigen Exerzierplatz, den Wilhelmsplatz,
auf dem wir herrlich radfahren konnten. Von Friedrich dem Großen zeugte noch
das Rote Haus, ein großer Gasthof, der fast zinnoberrot angestrichen war. In
ihm soll Friedrich der Große gewohnt haben. Nicht weit davon stand das Eichendorffhaus,
in dem der Dichter 1857 gestorben ist. Und wieder nicht weit davon war sein
Grab auf dem Jerusalemer Friedhof, wo auch mein Vater begraben wurde.
Dieser Friedhof war riesig groß. Die Toten wurden in Neisse von ihren
Verwandten hoch in Ehren gehalten, und ihre Gräber wurden fast durchweg
liebevoll bepflanzt und gepflegt. Der Allerseelentag im November war immer ein
zwar wehmütiges, aber strahlendes Fest der ganzen Stadt. Alle, auch die Bürger,
die keinen Verstorbenen auf diesem Friedhof liegen hatten, waren auf den
Beinen, um das eigenartige Fest der Toten am späten Nachmittag mitzuerleben.
Schon tagelang vorher wurde alles in den einzelnen Familien vorbereitet. Aus
bunten, oft knalligen Seidenpapieren und Blumendraht wurden Tausende von
Papierblumen hergestellt, die dann einzeln an Holzstäbchen befestigt oder zu
großen Kreuzen oder Kränzen zusammengefaßt wurden. Am frühen Nachmittag des
Allerseelentages strömten die Familien mit Wäschekörben voller Kunstblumen
und mit den bunten Kreuzen und Kränzen zum Friedhof hinaus, legten die großen
Stücke oben auf die Grabhügel, besteckten die noch freigebliebenen Stellen mit
den Einzelblumen und entzündeten unzählige Windlichter in farbigen Gläsern.
Beim Einfall der Dämmerung wurde das Schauspiel überwältigend: ein Meer von
strahlender Farbe und flackerndem Licht, auf dem sich schwarz gekleidete
Menschen still und ernst bewegten.
Das einstöckige Haus, in das wir umgezogen waren, war ein früheres
Pontonwagenhaus, das nach seinem Umbau 16 Wohnungen besaß. Wir wohnten beinahe
wie auf dem Lande. Hinter dem Hause lagen große Kornfelder, neben ihm stand
auf der einen Seite ein Pferdestall von einem Kavallerieregiment, auf der
anderen hinter einigen Kartoffelfeldern eine Autoreparaturwerkstatt. Sonst gab
es in der Obermährengasse viele Villen und kleinere Wohnhäuser. Hinter dem
Pferdestall lagen ein kleiner Platz für Reitübungen und daneben der Militärfriedhof
mit seiner langen Vergangenheit. Dahinter begannen dann die alten
Festungsanlagen. Um das Wohnhaus herum lagen 16 kleine Gärten von je 50 qm
Größe, für jeden Wohnungsinhaber also einer. Jede Wohnung besaß eine eigene
Toilette, aber die 16 Toiletten waren in einem ebenerdigen Querhaus zusammen
mit zwei Waschküchen untergebracht. Da dieses Häuschen nicht geheizt wurde,
wurde im Winter das Wasser abgestellt. Die Abflußrohre froren oft ein, wenn sie
nicht gewissenhaft mit alten Kleidungsstücken abgedeckt wurden. Das Spülwasser
mußte man sich im Winter in einer Wasserkanne aus der Wohnung mitnehmen. Die
neue Wohnung war etwas geräumiger als die frühere. Sie hatte eine große
Wohnküche, in der sich unser Familienleben abspielte und in der auch zwei
Betten für die jüngeren Brüder standen. Alfred und ich hatten ein Zimmer, in
dem wir ungestört unsere Schularbeiten machen konnten, das andere Zimmer
diente als Elternschlafzimmer. Der kleine Eingangs-Korridor bot nur Platz für
eine Flurgarderobe und einen Vorratsschrank. Die Gute Stube hatte sich selbst
überlebt und war beim Umzug sang- und klanglos verschwunden.
Meine Eltern lebten in dieser Wohnung, bis 1945 mein Vater starb und 1947
meine Mutter nach Königstein im Taunus übersiedelte, wo meine Brüder Alfred und
Hans sich nach dem Kriege schon niedergelassen hatten.
Höhere Schule
Bis zum Ende des fünften Schuljahres hatte ich klare Vorstellungen für
meine Zukunft. Starke Anziehungspunkte in Alt-Schalkowitz waren für mich die
Neubauten. Insbesondere die Holzarbeiten der Zimmerleute und eines Großonkels
(Bruder meiner Großmutter), der neben der kleinen Bauernwirtschaft und einer
Bienenzucht das Tischlerhandwerk ausübte, hatten es mir angetan. Dort konnte
ich stundenlang zusehen, wie eine Treppe, ein Dorflokus, ein Dachstuhl, ein
Sarg, eine Bank entstanden oder wie Fensterrahmen repariert wurden. Überall, wo
es nach Holz roch, wurde es für mich interessant. Noch heute bleibe ich bei
jedem Sägewerk stehen, um mich sattzuriechen. Für mich stand damals fest, daß
ich nach Absolvierung der Schulpflicht Tischler werden wollte. Aber es kam
anders. Meine Eltern gaben sich große Mühe, mich zu überzeugen, daß es besser
sei, auf die höhere Schule zu gehen und später einen akademischen Beruf zu
ergreifen. Ich wehrte mich lange, gab aber schließlich nach, ohne wirklich
überzeugt zu sein. Meine Neigung zog mich woandershin.
Mein Bruder hatte schon die Sexta hinter sich, als ich 1921 an das
Neisser Realgymnasium wechselte. Er hatte inzwischen den Ruf eines hochbegabten
Musterschülers. Er blieb auch konstant der Primus seiner Klasse bis zum
Abitur. Ich hatte in gewisser Weise darunter zu leiden, weil die Lehrer mehr
von mir erwarteten, als ich leisten konnte, obgleich ich immer unter den
ersten fünf der Klasse rangierte. Andererseits bewirkte der Ruf meines
Bruders, daß auch ich für einen Musterschüler gehalten wurde.
Der Anfang an der höheren Schule war allerdings sehr schwierig für mich.
Mir fehlte wohl die innere Bereitschaft. Meine Mitschüler mit ihrem oft sehr
feinen Benehmen waren mir fremd. Vieles, z.B. die Kenntnis von Fremdwörtern,
wurde vorausgesetzt. Ich mußte mir alles erst erarbeiten, wobei mir mein Bruder
Alfred sehr geholfen hat. Aber nach einem Vierteljahr schon waren diese
Schwierigkeiten überwunden. Ich fing an, den Lateinunterricht zu lieben, einige
Jahre später auch die Mathematik. Unser Religionslehrer Prof. Clemens Neumann
war für mich ein begeisternder Mann. Er war Mitbegründer der katholischen
Jugendbewegung Quickborn, konnte hinreißend Klampfe (wie wir die Gitarre
nannten) spielen und dazu viele Lieder singen. Er wanderte mit uns
kilometerweit durch die Landschaft und kochte mit uns das Mittagessen im
Freien, kehrte abends mit uns müde, manchmal vom Regen pitschnaß, aber immer
singend und voller Fröhlichkeit in die Stadt zurück. Prof. Neumann war ein
regelrechter Rattenfänger, dachte ich damals oft, ähnlich wie der von Hameln.
Wenn er am Nachmittag mit zwei oder drei Jungen singend und spielend durch die
Stadt marschierte, vermehrten sich seine Begleiter bis zur Stadtgrenze auf 20
bis 30. Nicht nur katholische, auch evangelische und jüdische Schüler kamen
mit. Er war in der Schule tonbestimmend, und ich glaube, daß er der Grund war,
daß ich mich allmählich in der neuen Umgebung wohlfühlte. Das hörte sofort
wieder auf, als er - ich war in der Quarta - starb.
Mein Bruder und ich waren bald gesuchte Nachhilfestundenlehrer, die gute
Erfolge verzeichnen konnten. Das Geld, das wir verdienten, war uns und unseren
Eltern natürlich willkommen, weil das kleine Einkommen meines Vaters unseren
Bücherhunger und unseren Fahrradverschleiß, auch die Kosten für die Befriedigung
meines Mal- und Basteleifers nicht decken konnte. Wir waren jetzt in das arbeitsreiche
Leben unserer Eltern integriert.
Von elterlicher Erziehung haben wir wenig gemerkt. Die Eltern ließen uns
großzügig gewähren. Sie engten uns niemals ein, vertrauten uns auf eine
selbstverständliche Weise, und mein Bruder Alfred und ich taten, so gut wir
konnten, alles, um sie nicht zu enttäuschen. Nur unsere Spitzfindigkeiten und
unsere verbalen Frechheiten den Erwachsenen gegenüber ließen meine Mutter
manches Mal zornig werden, so daß auch zuweilen ihre Hand ausrutschte. Aber
auch hierbei empfanden wir ihre unendliche Liebe, die bis zu ihrem Tode sich
nicht verminderte. Sie hat aber auch oft herzlich gelacht über unsere Einfälle,
z.B. über die Fixigkeit, mit der wir charakteristische Eigenarten unserer
Bekannten feststellten und bewitzelten. Wenn einer sich mit einem
Lieblingswort zu oft wiederholte, hatte er sofort dieses Wort als Spitznamen
weg. Er war dann für uns eben nur noch der Herr Schnafte (damals ein Modewort
für elegant) oder der Herr Newohr (Nicht wahr, mit sehr auffälliger Betonung
auf der ersten Silbe).
An Erziehungsmaßnahmen meines Vaters kann ich mich nicht erinnern. Er
liebte uns, ohne es uns direkt zu zeigen. Wir hatten oft das Gefühl, daß wir
ihn nicht sehr interessierten, weil er sich nicht einmal unsere guten bzw. sehr
guten Zeugnisse ansah. Meine Mutter mußte sie meistens unterschreiben. Da aber
Vaters Postkollegen uns regelmäßig zu unseren guten Zeugnissen gratulierten,
wenn sie uns zufällig trafen, wußten wir, daß er unsere Zensuren sehr wohl
kannte und von uns vieles erzählte.
Ich liebte die Schule nicht sonderlich. Meine Neigungsfächer Mathematik
und Latein interessierten mich aber stark. Der Unterricht im Zeichnen
langweilte mich nur deshalb nicht, weil ich seit meiner Kindheit gewohnt war,
mich selbst zu beschäftigen. In den Zeichenstunden ließ mich unser
Zeichenlehrer gewähren, ich durfte auch außerhalb des Gymnasiums arbeiten. Die
Natur in der nächsten Umgebung war gut dafür geeignet, und die nur 30 Meter
entfernte Kreuzkirche, ein Hochbarockbau, war für mich sowieso immer wieder
ein Anziehungspunkt. Dreimal in der Woche hatten wir darin unseren
Schulgottesdienst, währenddessen ich mehr Interesse für das riesige, ausgemalte
Tonnengewölbe als für die Vorgänge am Altar hatte. Die neun Jahre währende
regelmäßige Teilnahme an den Gottesdiensten in dieser außergewöhnlich schönen
und strahlenden Kirche hat wahrscheinlich dazu beigetragen, daß viele noch
heute in meinen Bildern einen gewissen barocken Zug entdecken.
Die Kunstgeschichte war im Neisser Realgymnasium kein Unterrichtsfach;
aber einer unserer Englischlehrer hielt jede Woche einen Vortrag mit
Lichtbildern über die Kunst des 19. Jahrhunderts. Ich war voller Erwartung,
als diese Vorträge begannen. Bald wurde ich aber uninteressiert. Courbet,
Leibl, Feuerbach und C.D. Friedrich wurden als die höchsten Spitzen der Malerei
gepriesen, die gewissermaßen den Höhepunkt des Erreichbaren in der
abendländischen Kunst darstellten, jenseits dessen ein Fortschritt nicht mehr
vorstellbar war. Zum Beweis dieser These wurde auch eine Handvoll Bilder von
Impressionisten gezeigt, auch eines von van Gogh. An diesen wurde bemängelt,
daß sie keine Idealvorstellungen, keine Inhalte, ja nicht einmal mehr (wie
Leibl oder Courbet) die Realität spiegelten. Die Deutschrömer wurden in den
Himmel gehoben. Ausgenommen war allerdings Hans von Marees, dem auch wieder
die Inhalte fehlten. Während ich dies niederschreibe, erscheint es mir fast
unglaubwürdig. In gewisser Weise enttäuschte mich die Fertigkeit dieser Maler,
weil ich in ihren Bildern keinen Pinselstrich entdecken konnte, das artistische
Können war nicht durchschaubar und blieb mir rätselhaft. Ich konnte über das,
was mich interessierte, über den Malvorgang, nichts erfahren. Beim einzigen
Bild von van Gogh, das gezeigt wurde, konnte ich jeden Pinselstrich sehen, und
gerade über ihn sprach der Lehrer sehr distanziert und deutete an, daß der
Grund für die merkwürdige Auffassung und Malweise in der Geisteskrankheit des
Urhebers zu finden sei. Und gerade dieses eine Bild von van Gogh hatte mich
tief beeindruckt. Diese Vorträge haben den Zugang zur Malerei für mich eher
verschüttet als freigelegt. Kein Wunder, daß mich von da an die Musik mehr
interessierte als die Malerei. Ich machte jetzt nur noch Linolschnitte,
meistens nach Motiven aus der Stadt Neisse. Der Linolschnitt reizte mich, weil
in den Drucken der Arbeitsvorgang, die Werkzeugspur, klar sichtbar war.
Seit meinem achten Lebensjahr bekam ich Violin- und seit dem zehnten
Klavierunterricht. Ich habe viel Zeit in das Erlernen dieser Instrumente
investiert und war gegen Ende meiner Gymnasialzeit sehr schockiert, als ich
merkte, daß ich trotz großer Bemühungen nicht mehr weiterkam. Ich wollte aber
nicht aufgeben, obwohl ich merkte, daß meine Fingerfertigkeit, meine
artistischen Fähigkeiten, meine bescheidene Virtuosität, die ich durch
fleißiges Üben erreicht hatte, sich nicht mehr steigern ließen. Ich ahnte zum
ersten Mal, daß jedem Menschen Grenzen gesetzt sind, nicht nur geistige,
sondern auch physische Grenzen. Allerlei Fragen tauchten auf. Ist die
Fingerfertigkeit eine unverzichtbare Fähigkeit für einen schöpferischen
Musiker? Braucht sie der Komponist oder der Dirigent? Hätte Chopin seine
Kompositionen fertiggebracht, wenn er sich nicht die Virtuosität seiner Finger
erarbeitet hätte? Kann ein Musiker schöpferisch sein, wenn er nicht ein
Instrument oder mehrere virtuos beherrscht? Und wie steht es andererseits mit
der Malerei? Muß ein schöpferischer Maler virtuos mit dem Pinsel umgehen
können? Ich ahnte nicht im geringsten, daß diese Frage
längst durch die Entwicklung der Kunst in den Zwanziger Jahren beantwortet
worden war. Aber in Neisse wußte man nichts davon.
Der wichtigste Träger öffentlicher Kulturveranstaltungen war in Neisse
das Stadttheater. Alfred und ich besuchten fast alle Sprechtheateraufführungen.
Schulaufführungen liebten wir nicht, sie waren für uns nur ärgerlich. Die
Unruhe einer theaterfüllenden Schar Jugendlicher verhinderte jede
Konzentration. Wir gingen lieber in die Abendvorstellungen, die wir aus unserer
eigenen Tasche bezahlten. Wir haben auf diese Weise neben den Klassikern auch
viele, damals in Neisse noch mit Argwohn aufgenommene Stücke von Hauptmann,
Sudermann, Ibsen und Strindberg kennengelernt.
Das Niveau dieses kleinen Provinztheaters muß beachtlich gewesen sein.
Denn meine Theatererlebnisse während meiner Studienzeit in Berlin haben
keineswegs meine Eindrücke im Neisser Stadttheater verblassen lassen.
Ich stand ein halbes Jahr vor dem Abitur, als ein junger Kunsterzieher
(sein Name ist Werner Grundmann) als Referendar an unser Realgymnasium kam. Ich
hatte keinen Unterricht bei ihm. Er stand eines Tages hinter mir, als ich in
eine Zeichnung vertieft war, und sprach mich an, fragte allerlei und merkte
bald meine Ahnungslosigkeit. Er lud mich zu sich ein. Er zeigte mir Bücher, die
er aus Breslau mitgebracht hatte. Die Maler der Brücke und des Blauen Reiters,
die Expressionisten, die Kubisten. Alles, was sich - von Neisse anscheinend
unbemerkt - im 20. Jahrhundert in der Kunst getan hatte, lag vor mir. Ich war
betroffen, erschüttert, begeistert. Erschüttert, weil ich nicht begreifen
konnte, daß mir das alles unbekannt war. Begeistert, weil ich instinktiv
spürte, daß hier die Lösung aller Fragen, die sich mir in dumpfer
Unbestimmtheit gestellt hatten, zu finden war. Sah nicht alles in dieser
modernen Kunst ziemlich unartifiziell aus? Aber die Bilder strahlten wie exotische
Sonnen. Und welche Vielfalt, welche verschiedenartigen persönlichen Leistungen
und Erfindungen! Ich war geblendet von den vielen Möglichkeiten. Was für eine
neue Welt hatte sich vor mir aufgetan! Ich war überzeugt, daß ich meinen Beruf
gefunden hatte, zumindest ihn aber nun finden würde. Ich nahm mir viele der
Bücher mit nach Hause, soviel mein Fahrrad tragen konnte. Ich durchstöberte die
Buchhandlungen. Ich glaubte, ich hätte versagt, wäre bisher mit geschlossenen
Augen durch die Bücherläden gegangen. Nein, ich fand nichts. Das war im Jahre
1929.
Und doch erinnere ich mich dumpf und undeutlich an eine Ausstellung in der
alten Neisser Stadthalle unter dem Rathausturm, in der moderne Kunst gezeigt
wurde. Das muß in der ersten Hälfte der Zwanziger Jahre gewesen sein. Ich war
damals sicher noch viel zu unentwickelt, um die Fremdartigkeit dieser Bilder zu
verdauen und das Neue, das sie verkündeten, zu begreifen. Ich sah dort ein
Bild, dessen Rahmen bemalt war, so als ob sich das Bild auf dem Rahmen
fortsetzte. Viel Weiß und Blau wies es auf. Ich erinnere mich daran sicher nur
deswegen, weil, als ich dieses Bild betrachtete, jemand neben mir sehr
belustigt war und das Bild für einen Witz hielt. Wenn mich meine an dieser
Stelle wirklich sehr unklare visuelle Erinnerung nicht trügt, könnte dieses
Bild von Segal gewesen sein.
Einmal hat lange Zeit eine farbige Lithographie von Feininger im
Schaufenster des Buchantiquariats der Berliner Straße gestanden. Dieses Blatt
aus der Zeit der prismatischen Städtebilder Feiningers habe ich genau im
Gedächtnis behalten, weil ich seinetwegen oft vor diesem Fenster stehen
geblieben bin. Es muß eine mir nicht bewußt gewordene Anziehungskraft auf mich
ausgeübt haben.
Zu meinen Mitschülern während der Gymnasialzeit hatte ich ein sehr
normales Verhältnis, zu einigen, mit denen ich musizierte, Schach spielte,
Radio bastelte, Fahrradtouren durch Deutschland machte oder durch andere
Interessen verbunden war, entwickelten sich auch lose Freundschaften. Zu fünf
Mitschülern ergaben sich zwei Jahre vor dem Abitur engere Bindungen. Sie zogen
mich eines Tages ins Vertrauen und erzählten mir, sie hätten schon längere Zeit
wöchentlich abendliche Zusammenkünfte, die jeweils im Zeichen eines
vorgegebenen Themas stünden, über das einer der Teilnehmer nach mehrwöchiger
Vorbereitung zu berichten habe, woran sich dann eine Diskussion bis in die
späte Nacht anschlösse. Sie fragten mich, ob ich da mitmachen wolle. Ihnen
fehle jemand, der Referate über bildende Kunst halten könne.
Da ich zu allen fünf ein gutes kameradschaftliches Verhältnis hatte,
stimmte ich zu. Zudem verbanden mich mit einigen von ihnen schon gemeinschaftliche
Erlebnisse. Konrad
Bloch hatte mich schon in den ersten Gymnasialjahren zu seinen Geburtstagen
eingeladen. Auch hatten wir oft mit seinen herrlichen Stabilbaukästen
Maschinen und Apparate gebaut und mit Hilfe eines kleinen Elektromotors in
Bewegung gesetzt. Sein Vater war Rechtsanwalt und Besitzer einer Gardinenfabrik.
Im Eßzimmer der Blochschen Wohnung sah ich 1929 drei Bilder des Malers Martin
Bloch, der Konrads Onkel war. Diese drei Querformate, etwa 70 x 120 cm groß,
waren für mich von einer bisher nie gesehenen, fast erschreckenden
Klarfarbigkeit, Stilleben von großer Einfachheit, die lediglich drei oder vier
stehende Krüge oder Vasen zeigten, die von der hinteren Kante einer
Tischplatte hinterschnitten wurden. Diese Bilder erregten mich, waren mir fremd
und gleichzeitig auf eine unerklärliche Weise bekannt. Sie prägten sich mir so
ein, daß ich sie noch heute vor mir zu sehen glaube.
Mit Carl Kunisch, dessen Vater Pfefferküchler und Hersteller des
"Echt Neisser Konfekts" war, hatte ich schon Jahre vorher im Hof
seines elterlichen Wohnhauses ein Faltboot gebaut - wir haben fast ein Jahr
lang unsere Freizeit dafür geopfert -, mit dem wir dann erlebnisreiche
Wanderfahrten stromabwärts auf der Glatzer Neisse unternahmen. Carls Mutter
erzählte mir des öfteren, daß sie als Mädchen mit dem
späteren Schriftsteller Max Hermann-Neisse in dessen elterlicher Wohnung und
unter seiner Regie Theater gespielt habe.
Rudolf Linich, dessen Eltern die größte Fleischerei unserer Heimatstadt
besaßen und nach ihrem frühen Tod viel Geld hinterließen, konnte sorglos
Philosophie studieren. Ich hatte mit ihm noch bis zum Zweiten Weltkrieg enge
Verbindung, weil wir beide in Breslau und Berlin studierten und nach dem
Studium in Berlin wohnten. Er ist nach Kriegsende an der Ruhr gestorben.
Georg Pietsch, der Sohn eines Lehrers, war unser Adonis, war sehr begabt
und sehr sportlich, war der Schwarm aller Neisser Mädchen, ging nach dem Abitur
zur Kriegsmarine und ist bald danach mit dem Segelschulschiff Niobe untergegangen.
Auch Georg Schmidt, Sohn eines Buchhändlers, soll nicht mehr am Leben sein. Ich
habe ihn nur noch einige Male während meiner Breslauer Studienzeit
wiedergesehen.
Carl Kunisch wurde Jurist und hoher Regierungsbeamter und lebt seit
Kriegsende in München. Wir stehen heute noch in Verbindung, aber besuchen uns
nur selten. Konrad Bloch ist Jude; seine Familie konnte im Anfang der Nazizeit
rechtzeitig in die USA flüchten. Nach ersten schlechten Jahren konnte er sein
Chemiestudium beenden, wurde Universitätsprofessor und bekam den Nobelpreis für
Biochemie. Er war in unserer Klasse durchgehend Primus. Nach dem Kriege erfuhr
ich aus dem 'Who is who?' seine Anschrift. Er kommt alljährlich im Sommer für
einige Monate in sein Haus in Oberitalien. Dort habe ich ihn vor einigen Jahren
von Jugoslawien aus besucht.
Die Kontakte mit Konrad und Carl sind zwar immer noch erfreulich für
mich, aber ich muß auch ehrlich zugeben, daß unsere Berufe weit
auseinanderliegen und wir uns natürlich weit auseinandergelebt haben. Und durch
sporadische Briefwechsel und Besuche kommt ein geistiger Austausch nicht mehr
zustande. Man denkt dann nur wehmütig an die damaligen lebendigen und
diskussionsfreudigen Zusammenkünfte, die abwechselnd in den Wohnungen der
Familien Bloch, Linich und Kunisch mit einem üppigen Essen begannen und nach
eifrigen Debatten über Philosophie, Kunst, Geschichte, Politik und
Weltanschauung bei Alkohol und blauem Dunst schließlich in Übermut und
Fröhlichkeit übergingen, die manchmal auch in einem jugendlichen Schabernack in
der nächtlichen Stadt gipfelten.
Nach dem Zusammentreffen mit Werner Grundmann änderte sich mein Leben.
Ich glaubte zu wissen, was ich zu tun hatte, zum ersten Mal in meinem Leben
besaß ich diese Gewißheit. Ich hatte keinen Berufswunsch mehr gehabt, nachdem
man mir den Tischlerberuf ausgeredet hatte. Um überhaupt etwas nach dem Abitur
anzufangen, wollte ich zur Handelsmarine gehen. Ich wollte viel sehen und
erleben. Heute würde man sagen, mich dürstete nach visuellen Erlebnissen. Geige
und Klavier rührte ich kaum noch an. Die Schule interessierte mich nicht mehr.
Nach dem Unterricht gab ich zwar noch die verabredeten Nachhilfestunden, alle
Freizeit gehörte aber dem Malen und Zeichnen. Abends erst versuchte ich die
Schularbeiten zu erledigen. Ich schlief oft dabei ein. Ich ließ in meinen
Leistungen nach. Das Abitur schaffte ich aber mit Leichtigkeit
Meine Mutter machte sich seit dieser Zeit Sorgen um mich, ein Zeichen
dafür, wie ich mich verändert hatte. Als ich einmal aus irgendeinem Grunde allein
das Mittagbrot aß, vergaß ich über dem Anstarren des neuesten Bildes, das ich
vor mir aufgestellt hatte, das Essen. Meine Mutter, die das bemerkte, kam zu
mir und sagte: "Junge, du wirst mir doch wohl nicht verrückt
werden?!" Sie hatte recht: Ich befand mich in einem Rausch. Mein Leben
hatte einen neuen Sinn bekommen. Ich sah einen verlockenden Beruf vor mir.
Zwei Monate vor dem Abitur bewarb ich mich an der Breslauer Akademie für
Kunst und Kunstgewerbe um Aufnahme für das Sommersemester 1930. Unser junger
Kunsterzieher Werner Grundmann, zu dem ich inzwischen starke Bindungen
empfand, die bis heute gehalten haben, half mir beim Aussuchen der
Bewerbungsarbeiten. Ich wurde aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte für jeden
Bewerber grundsätzlich probeweise. Die endgültige Entscheidung fiel erst nach
dem Probesemester.
Ein langer Abschnitt meines Lebens lag hinter mir: die Kindheit, die noch
heute in ihrem Reichtum an Erlebnissen und in ihrer Vielfalt strahlend in
meiner Erinnerung lebendig geblieben ist, und die 14 Jahre Schulzeit, die ich
in keiner Phase geliebt habe. Das bestandene Abitur war nur deswegen eine
Freude für mich, weil ich die ungeliebte Schule hinter mir hatte. Die Freude
wurde vergrößert, weil mir etwa gleichzeitig die Aufnahme in die Breslauer
Akademie geglückt war. Wozu ich das Abitur benutzen oder gebrauchen würde,
wußte ich allerdings nicht.
Im ganzen habe ich trotzdem die 18 Jahre, die
ich in Neisse lebte, als eine intakte, ruhige, problemlose und geordnete, aber
auch ziellose, fast unbewußt verbrachte, leidenschaftslose Phase meines Lebens
in Erinnerung. Ich fühlte mich geborgen und war zufrieden in der
kleinbürgerlichen, spießigen und frommen Welt dieser Kleinstadt. Aber im
letzten halben Jahre vor dem Abitur staunte ich selbst über meine Veränderung,
die mich bereit machte, einiges über Bord zu werfen. Der feste Halt, den mir
die Stadt Neisse so lange Zeit gegeben hatte, war plötzlich weg.
Heute ist von dieser langen Zeit kaum etwas übriggeblieben. Ich habe
mich auch nicht bemüht, mit meinen Schulkameraden oder meinen Lehrern
Verbindung aufrecht zu erhalten. Mit Werner Grundmann, der jetzt in Oberstdorf
im Allgäu lebt, habe ich noch immer Verbindung. Das ist nicht verwunderlich.
Denn er war ja ein wichtiger Weichensteller in meinem Leben.
Meine katholische Erziehung wirkt noch bis heute nach. Vor allem das
Erlebnis des Eingebettetseins in eine große Gemeinschaft, den Gleichklang
Hunderter von Mitmenschen beim Gottesdienst, vor allem bei den
Kirchenfesttagen, werde ich nie vergessen. Ein gleich tief greifendes
Gemeinschaftserlebnis ist mir in meinem langen Leben anderswo nicht mehr
beschert worden. Meine damalige feste Verankerung im katholischen Glauben
löste sich schon während der ersten Studiensemester. Wie stark mich die
katholische Erziehung aber in meiner Haltung zum Leben und zu meinen
Mitmenschen geprägt hat, spüre ich bis heute deutlich und immer wieder.
Meine Heimatstadt Neisse möchte ich nicht mehr wiedersehen. Ich habe das
Stadtbild von Neisse noch in lebendiger Erinnerung. Die gotische Pfarrkirche
Sankt Jakobus mit ihrem hohen Dach und dem zierlichen, nadelspitzen Dachreiter
und dem wuchtigen, unvollendeten Glockenturm, der gotische, fast hundert Meter
hohe Rathausturm, das bemalte Kämmereigebäude mit dem herrlichen
Renaissancegiebel, die strahlende Kreuzkirche aus dem Hochbarock, der Schöne
Brunnen mit seinem kunstvollen schmiedeeisernen Käfig, die ehrwürdigen
Tortürme der mittelalterlichen Festung, die oft sehr schmalen Bürgerhäuser am
Ring mit ihren schönen, phantasievollen Renaissance- und Barockgiebeln stehen
mir noch deutlich und lebendig vor Augen, obgleich ich sie zuletzt vor über 40
Jahren gesehen habe. Das Wiedersehen mit Neisse fürchte ich, nachdem ich
einige Abbildungen in Büchern und Postkarten vom heutigen Zustand dieser Stadt
gesehen habe. Trotz Wiederaufbaus einiger wichtiger Bauten stehen diese in
einer neuen, mir unbekannten Stadt. Alles sieht auf den Fotos verstümmelt,
amputiert und prothesenhaft aus. Neisse ist für mich verschwunden.
Studium
Ich siedelte nach Breslau
über. Was würde mich dort erwarten?! Schon das Alleinsein im Zuge war ein Genuß.
Ich fühlte mich so frei wie nie zuvor. Keine Schule mehr, keine Schularbeiten, kein
Stundengeben. Nur noch malen! Und zeichnen! Nur noch an meine ureigenste
Arbeit denken, beim Schlafengehen, beim Aufstehen! Ich fühlte mich prall und
angefüllt mit Ideen und Einfällen. Was würde sich davon verwirklichen lassen?
Und ich würde Lehrer haben, die mich anleiten, die gleiches oder ähnliches
denken wie ich. Werner Grundmann hatte mir gezeigt und entsprechende Bücher geliehen,
was für Lehrer ich in Breslau haben würde. So voller freudiger und
hoffnungsvoller Erwartung war ich bisher nie in meinem Leben gewesen.
Breslau war eine
Großstadt, aber ein junger Mensch konnte fast alles zu Fuß erreichen. Mein
erster Weg führte mich natürlich zur Staatlichen Akademie für Kunst und
Kunstgewerbe. Sie sah vielversprechend aus. Die großen Atelierfenster! Sie
blickten alle zur Oder und über die Oder zur Dominsel. Ich suchte in der Nähe
der Akademie ein Zimmer, lief noch ein paar Stunden in der nächsten Umgebung
herum, kaufte zum Essen ein und holte meine Koffer vom Bahnhof.
Breslau war eine schöne
und übersichtliche Stadt, hatte damals über eine halbe Million Einwohner und
war die drittgrößte Stadt Preußens. Es besaß mehrere Theater, ein besonderes
Opernhaus und ein beachtliches Museum. Nach kurzer Zeit hatte ich mich
eingelebt und schwelgte im Breslauer Kulturleben, das mir eine Fülle von
Erlebnissen und Bereicherungen vieler Art brachte. Ich konnte jede Woche, wenn
ich wollte, ein- bis dreimal ein Theater, die Oper oder ein Konzert besuchen.
Das war alles damals billig und kurzfristig zu haben, weil es überall noch
Stehplätze gab. Ich konnte mich immer noch gegen Abend für irgendetwas entscheiden.
In den vielen schönen gotischen Kirchen mit ihrer reichen Barockausstattung
habe ich viel geistliche Musik gehört, die in der kirchlichen Umgebung sehr
eindringlich und nachhaltig auf mich wirkte. Ich habe mich später in Berlin, wo
alles weitläufiger und schwieriger zu erreichen war und Eintrittskarten hart
ergattert werden mußten, manchmal nach Breslau zurückgesehnt. Das Museum, in
dem ich endlich die ersten Originale der modernen Kunst zu Gesicht bekam, bot
jede Woche einen Lichtbildervortrag über einen modernen Künstler an, der immer
durch eine kleine Ausstellung von graphischen Arbeiten, Handzeichnungen oder
Aquarellen bereichert wurde.
Bei meinem ersten Besuch
der Akademie ging ich zufällig zur gleichen Sekunde wie ein anderer junger Mann
durch das Eingangsportal. Wir ahnten beide nicht, daß dies Symbolkraft für
unser ganzes Studium haben sollte. Wir stellten fest, daß wir beide Neulinge
waren, und machten uns miteinander bekannt. Er hieß Hans Berntsch und stammte
aus Oberlangenbielau. Schon nach einigen Tagen war zu merken, daß sich eine
Freundschaft anbahnte. Berntsch war ein sehr konzilianter, arbeitsamer,
zielstrebiger und begabter Mensch. Unsere Freundschaft hielt durch das ganze
Studium. Sie war für beide ein großer Gewinn. Wir haben sehr viel zusammen
gearbeitet. Wir konnten uns unsere schlechten Arbeiten in Grund und Boden
kritisieren und in Begeisterung geraten, wenn einer etwas Gutes zustande brachte,
wir wetteiferten, einander in der Leistung zu übertreffen, um dann den
Unterlegenen durch drastische Selbstkritik wieder aufzurichten. Wir saßen oder
standen in Italien in der größten Mittagshitze vor dem gleichen Motiv,
schleppten uns halb tot an unserem Malkram, um ja immer mit dem richtigen
Material an jedes Motiv heranzukommen. Reisen nach Italien und Jugoslawien
machten wir gemeinsam.
Nach dem Examen ging er in
seinen Heimatort zurück, ich blieb in Berlin. Während der folgenden Jahre haben
wir uns viel geschrieben, bis wir im Krieg die Verbindung verloren. Das
Wiedersehen nach dem Krieg war für mich erschütternd. Als Kind hatte er eine
Mittelohrvereiterung gehabt, der zufolge er schon während des Studiums
Hörbeschwerden hatte. Jetzt war er fast taub. Ich merkte ihm an, daß er an
seinem Leiden schwer trug. Aus dem früher so lebendigen, allseits
interessierten und offenen Menschen war ein Isolierter geworden, der, wie er
selbst sagte, seit Jahren unter einer Glocke lebte. Wir trafen uns noch einmal,
dann erreichte mich bald die Nachricht von seinem Freitod.
Angesichts meiner hochgeschraubten Erwartungen ließen die Enttäuschungen
in Breslau nicht lange auf sich warten. Mein erstes Semester mußte ich in der
Vorklasse bei Paul Dobers absolvieren. Ich habe sehr viel von Dobers gelernt.
Er war der einzige Lehrer meiner Studienzeit, der sich viel Zeit für jeden
seiner Schüler nahm. Er hatte eine großartige Fähigkeit, sich in jede
Schülerarbeit zu vertiefen. Ich hatte das Gefühl, daß er fast jeden Strich beim
Betrachten nachvollzog. Uns schien, daß er sich auf eine naive,
unvoreingenommene Art in jedes Gegenüber versenken konnte. Er hielt dies auch
für eine unverzichtbare Voraussetzung künstlerischer Lehstätigkeit. "Wenn
man ein Kamel zeichnen will, muß man eigentlich selbst ein Kamel werden."
Solche und ähnliche Aussprüche, die sehr naiv waren und sich sehr komisch
anhörten, konnte Dobers mit tiefem Ernst und großer Überzeugungskraft machen.
Sie prägten sich gut ein, gerade weil darüber gewitzelt wurde. Wir spürten den
Ernst dahinter. Wir zeichneten in dieser Vorklasse mit Bleistiften aller
Härtegrade Materialstilleben, die wir vor uns stehen hatten: ein Brettchen, auf
das verschiedene Materialstückchen montiert waren, die wir in zwei großen
Kisten im Atelier vorfanden, als da sind: Blech, Draht, Wolle, Wollstoff,
Leinen, Samt, Holz, Papier, Watte, Kunststoff, Steine, Blätter, Glas, Federn,
Horn, Nägel, Metallspäne usw. Wir lernten die Ausdrucksmöglichkeiten der
Härtegrade des Graphits zu erforschen und anzuwenden. Neigungsmäßig fühlte ich
mich allmählich kaum noch zu diesen Studien hingezogen. Viel lieber fuhr ich in
die Umgebung Breslaus mit dem Fahrrad, um in den Dörfern und in der Landschaft
zu malen und zu zeichnen. Auch diese freien Arbeiten wurden von Dobers
bereitwillig und intensiv besprochen. Das war für mich sehr anregend. Ich hatte
bis zu diesem Zeitpunkt keinen Mentor gehabt.
Ich fand die Arbeit an den Materialstilleben nicht uninteressant. Vor
allem merkte ich bald, daß jedes Werkzeug eigene, aber auch beschränkte
Ausdrucksmöglichkeiten besitzt, auch daß durch diese obligatorische Arbeit
Hand und Auge sensibilisiert wurden. Daß man durch solche Arbeiten aber auch
von dem hohen Roß, auf dem man als junger Mensch naturgemäß sitzt, heruntergeholt
wurde, habe ich erst später gemerkt. Allerdings zweifle ich noch heute daran,
ob das für jeden Studenten gut und richtig war. Manchmal fragten wir uns, ob
unsere Arbeit noch etwas mit Kunst zu tun habe oder ob wir in irgendeiner
abgelegenen Ecke des Kunstbetriebes nach Kniffen suchten, um unseren Bleistiften
eine möglichst zeit- und mühesparende Methode abzuluchsen für eine noch nicht
gefundene Materialdarstellung.
Sehr viel trockener ging es in der anderen Vorklasse zu, in der man das
zweite Probesemester zu absolvieren hatte, in der Vorklasse von Professor
Scheinen. Dort wurden Stilleben aus kleinen Gegenständen, z.B. Streichholzschachteln,
Mokkatäßchen, kleinen Kakteen usw., unter peinlicher Beibehaltung des
Augenpunktes mit ab- bzw. anschwellender Linie genau, auf den halben Millimeter
genau, gezeichnet. Der vorderste Gegenstand mußte natürliche Größe haben. Die
Korrektur wurde etwa so vorgenommen: Wenn die obere Ellipse des vorderen
Kakteentöpfchens richtig ist, muß die untere noch um einen Millimeter in der
senkrechten Achse zusammengedrückt werden. Die vordere Kante der
Streichholzschachtel muß noch einen halben Millimeter höher sein usw.
Lediglich die optische Genauigkeit war dort oberstes Gesetz, das Endprodukt
mußte peinlich sauber aussehen. Viel Radiergummi und sehr gutes Zeichenpapier
wurden verbraucht. Ich gebe zu, daß ich mit Grausen daran dachte, daß ich das
im zweiten Semester über mich ergehen lassen mußte.
An der Breslauer Akademie war es üblich, daß bei Semesterschluß jeder Student,
gleichgültig welchen Alters, seine Arbeiten des verflossenen Semesters dem
Professorenkollegium vorlegen mußte. Der Pedell gab Tag und Stunde bekannt, zu
denen die einzelnen Klassen vor dem Schriftraum aufmarschieren mußten. Im
Schriftraum saßen die Professoren unter Vorsitz von Oskar Moll auf Tischen und
Stühlen. Jeweils ein Student (alphabetische Reihenfolge) ging mit seiner Mappe
nach Aufruf durch den Pedell hinein, legte die Mappe auf den Tisch vor den
Direktor, öffnete sie und verließ den Raum. Nach einiger Zeit wurde er wieder
hineingerufen. Moll gab dann eine kurze Zusammenfassung der Beurteilung, die
darin gipfelte, daß der Student entweder weiterstudieren konnte oder daß ihm
ein weiteres Probesemester gestattet wurde oder daß er aufgefordert wurde, die
Akademie wieder zu verlassen. Im ersten Fall konnte der Student sich
entscheiden, bei welchem Lehrer er im kommenden Semester studieren wollte.
Zuletzt konnte der Student die über die Tische verstreuten Arbeiten in die
Mappe zurückklauben und hinausgehen. Die Prozedur verlief durchaus nicht
zimperlich. Besonders die Mädchen litten darunter und kamen manchmal weinend
mit ihrer Mappe heraus.
Bei diesem Vorgang bekam
ich zum ersten Mal alle damals schon sehr bekannten Maler der Akademie zu Gesicht:
Oskar Moll, Otto Müller, Johannes Molzahn, Alexander Kanoldt, Carlo Mense, Paul
Holz, Oskar Schlemmer und die Bildhauer Bednorz und van Gosen. Als ich nach
Durchsicht der Mappe wieder hineingerufen wurde, hörte ich gespannt das
Urteil: Man sei zufrieden mit mir, ich hätte viel gearbeitet, man wolle mir das
zweite Probesemester in der Klasse Scheinert erlassen, wenn ich die dort
geforderten Arbeiten in den Semesterferien anfertigte, und im kommenden Semester
möchte er, Oskar Moll, mich in seiner Klasse haben.
Ich war sehr zufrieden, hatte mir eigentlich gewünscht, zu Moll zu
kommen, weil ich gehört hatte, daß bei ihm der Student große Freiheit hatte
bezüglich seiner Arbeit. Ich ahnte damals noch nicht, daß diese Freiheit im
Grunde genommen und in meinem Falle ein Alleingelassensein werden sollte. Ich
hatte mich schon während des ersten Semesters in allen Klassen ausreichend
umgesehen. Die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Schülerarbeiten in der
Klasse Moll hatten mir sehr zugesagt. In anderen Klassen schien mir ein zu
straffes und eingeengtes Arbeitssystem zu walten. Bei Otto Müller wurde nur
Kopf gezeichnet, und zwar mit dicker Kohle, mit Temperament, Ton in Ton
gewischt und überlebensgroß. Wir nannten das "Müllern". Die Resultate
sahen zwar sehr lebendig aus, aber wie von einer Hand, nur wenige individuelle
Unterschiede waren zu bemerken. Bei Kanoldt zeichnete man ebenfalls Kopf, aber
mit spitzem Bleistift. Hier waren Lebensgröße, optische Genauigkeit,
Ähnlichkeit und Sauberkeit obligatorisch. Diese Köpfe wirkten steinern. Jede
Emotion war ausgeschaltet. Zu Mense, Molzahn und Schlemmer hatte ich damals
keine innere Beziehung. Zu Paul Holz schon, aber es gab bei ihm nur in den
Abendstunden einmal wöchentlich Tafelzeichnen für die letzten Semester.
Als ich das zweite
Semester begann, war Otto Müller bereits tot. Ich hatte mir vorgenommen, im
dritten Semester bei ihm zu studieren trotz der Aussicht, monatelang Köpfe mit
dicker Kohle zeichnen zu müssen. Von meinem Lehrer Moll, bei dem ich zwei
Semester blieb, war ich bald enttäuscht. Ich fühlte mich verschaukelt. Ich
hatte den Lehrer, den ich mir wünschte, aber er lehrte nicht oder nicht mehr.
In zwei Semestern habe ich ihn fünf- oder sechsmal im Atelier gesehen. Er sagte
nichts zu meinen Arbeiten außer: "Sehr schön, machen Sie so weiter."
Kein Gespräch, kein praktischer Rat. Ich war wieder allein. Immerhin hatte ich
meine Kommilitonen. Später verstand ich die Schweigsamkeit Molls. Die ersten
nationalsozialistischen Studenten waren aufgetaucht, bildeten eine
Aktionsgruppe und versuchten, überall Stunk zu machen. Moll hatte als Direktor
und Jude wohl am meisten darunter zu leiden und war vorsichtig geworden.
Moll hatte zwei Schülerateliers. In dem einen waren Studenten, die sehr
geschmackvoll, anscheinend in der Gefolgschaft des Meisters, malten, aber auch
einige, die, viel bewundert, modernistisch arbeiteten, mir aber wenig
imponierten. Moll hatte wohl sofort aus meinen Arbeiten gespürt, wohin ich
gehörte, und mich in sein zweites Schüleratelier eingewiesen. Dort war ich in
der richtigen Gesellschaft. Alle arbeiteten mit starker Emotion vor der Natur.
Von meinen Arbeiten aus dieser Zeit existieren noch drei: Eine Kohlezeichnung
und ein Aquarell auf grundierter Pappe nach einem Lumpensammler und ein
gespachteltes Ölbild nach einer Marktfrau (drei Portraits). Wir waren sieben
Studenten. Vier davon befanden sich im siebenten und achten Semester, zwei von
ihnen schienen mir in ihren Arbeiten schon stark individuell ausgeprägt.
In einer Ecke dieses Ateliers stand eine große, auf einen Keilrahmen
aufgenagelte Pappe, daneben viele große Packpapierrollen, die mit Kohle
bezeichnet waren. Ich war immer schon um sieben Uhr morgens in diesem Atelier.
Ich empfand es als wohltuend, daß ich bis zehn Uhr allein arbeiten konnte, weil
meine Mitstudenten immer sehr spät kamen. Aber schon nach wenigen Tagen
erschien ein etwas älterer Mann, der aussah, als sei er einem Bild Otto Müllers
entsprungen: Hager, scharfe Gesichtszüge, schwarze Haare. Ich hielt ihn sofort
für einen Zigeuner. Er war aber keiner. Er hatte vor Jahren bei Otto Müller und
Oskar Moll studiert, hatte Hausverbot, weil er nach zehn Semestern sich nicht
mehr von der Akademie trennen wollte. Er befestigte jeden Morgen eine von den
zusammengerollten Zeichnungen oder ein neues Packpapier auf der Pappe und
arbeitete bis zehn Uhr. Dann verschwand er, nachdem er die Spuren seiner
Anwesenheit wieder verwischt hatte. Moll dürfe ihn nicht sehen, sagte er. Sein
Name war John. Er war schwer magenkrank und nährte sich nur von Obst, Zwiebeln
und Nüssen, wie er mir mitteilte. Bei unserer ersten Begegnung guckte er mir
nach der Begrüßung tief in die Augen und sagte: "Sie sind krank." Ich
fragte: "Wieso?" "Ich sehe das in Ihren Augen. Der Feind sitzt
im Dickdarm. Sie müssen sich anders ernähren", war seine lapidare Antwort.
Im Laufe der zwei Semester bei Oskar Moll versuchte er wiederholt, mich zu
seinem Ernährungsglauben zu bekehren. Die großen Zeichnungen, die er mir
liebevoll vorführte, interessierten mich gar nicht. Es handelte sich um
Figurenkompositionen, die sich an Otto Müller anlehnten. Mir erschienen sie
fad und kraftlos. Für mich war die Begegnung mit John deprimierend. So hatte
ich mir einen Absolventen der Breslauer Akademie und einen Schüler Müllers und
Molls allerdings bisher nicht vorstellen können.
Unter dem Dach der
Akademie hatten etwa acht Meisterschüler ihre kleinen Ateliers. Unter diesen
entdeckte ich keinen, der mich interessierte. Um einige von ihnen wurde viel
Wind gemacht. Sie setzten mich aber nur in Erstaunen wegen ihres
unproportionierten Selbstbewußtseins.
Die meisten Studenten in Breslau strebten den Kunsterzieherberuf an.
Allerdings schienen in diesem Beruf die Aussichten schlecht zu sein. Jeder
Student, der sich in der Breslauer Akademie einschreiben ließ, mußte einen
Revers unterschreiben, daß er davon Kenntnis genommen habe, daß keine Aussicht
bestehe, nach der Ersten Prüfung für das Künstlerische Lehramt an höheren
Schulen in den Staatsdienst eingestellt zu werden. Diese Frage interessierte
mich nicht sonderlich. Ihre Lösung kam später von selbst. Nach 1933 wurde in
allen höheren Schulen fakultativer Unterricht in Flugzeug- und
Schiffsmodellbau eingeführt (zwei bis vier Stunden in der Woche), wodurch die
Kunst- und Werkerzieher plötzlich Mangelware wurden.
Das, was in Breslau als Kunsterzieher-Studium neben den künstlerischen
Disziplinen angeboten wurde, schien mir sehr geringfügig und leicht zu
absolvieren: Schrift, Tafelzeichnen, Gestaltungslehre und die Werkstätten für
Holz, Metall, Papier und Weberei. Diese Gebiete interessierten mich ohnehin.
Mir schien unter diesen Umständen das Kunsterzieherexamen leicht erreichbar.
Außerdem wußte ich, daß ich damit meinen Eltern eine große Freude machen konnte.
Noch etwas halbherzig entschied ich mich im zweiten Semester, das Kunsterzieherexamen
anzustreben, und weil dazu auch ein wissenschaftliches Zusatzfach gehörte,
schrieb ich mich sofort in der Universität als Nebenhörer für Mathematik ein
und wanderte jeden Tag für ein oder zwei Vorlesungs- oder Übungsstunden an dem
Oderufer entlang zu den Wissenschaftlern, bei denen ich mich allerdings nie
ganz heimisch fühlte. Der schöne, prächtige und riesige Barockbau der
Universität bildete einen recht drastischen Gegensatz zu dem unpersönlichen
Studienbetrieb im Innern, in dem ich mir wie der kleinste Teil eines
aufgeregten Ameisenhaufens vorkam. Es kostete mich nach der Anfangsbegeisterung
über meinen Entschluß doch einige Überwindung dabeizubleiben. Später in Berlin
wurde es noch schwieriger, weil dort die Entfernung zur Universität größer
war. Ich habe schließlich nur noch An- und Abtestate geholt.
Die Werkstätten der Akademie übten eine starke Faszination auf mich aus.
Am Ende des dritten Semesters entschloß ich mich, in den Werkstätten für Holz,
Metall, Papier und in der Weberei zu arbeiten. Mein alter Basteltrieb war
wieder erwacht. Zu den Werkstattleitern hatte ich sofort ein gutes Verhältnis.
Ich habe in diesem einen Semester durch Selbsttun und Zusehen viele
handwerkliche Fähigkeiten erworben, die mir im Leben sehr geholfen haben.
Holz-, Papier- und Papparbeiten waren mir schon aus der Pennälerzeit sehr vertraut.
Die Metallarbeit und die Weberei waren neue Gebiete für mich. Jo Vinecky, ein
Tscheche, war den Werkstattleitern als Formmeister übergeordnet und war für die
Formgebung der in den Werkstätten entstehenden Gegenstände verantwortlich bzw.
zuständig. Zu ihm und seiner Frau Li Vinecky, die die Weberei leitete, ließ
sich ein freundschaftliches Verhältnis an. Ich habe von diesen beiden vieles
über das Bauhaus und dessen Ideen erfahren. Sie waren mit Oskar Moll und Otto
Müller befreundet und kannten auch einige Bauhausmeister persönlich. Auch
später in Berlin hatte ich noch Kontakt mit diesen beiden interessanten
Menschen. 1935 fand ich ihre Wohnung eines Tages leer vor. Ich habe nie
erfahren, was mit ihnen geschehen ist.
Durch meinen Schulfreund Rudolf Linich lernte ich in Breslau Hede
Symanczik kennen. Sie war seine Tante, die Schwester seiner Mutter, war auf
einem Dorf in der Nähe von Neisse aufgewachsen und hatte sich, obgleich sie nur
über eine Dorfschulbildung verfügte, zu einer hochintelligenten und gebildeten,
hauptsächlich literarisch gebildeten Frau entwickelt. Sie war mit einem Doktor
der Volkswirtschaft verheiratet, der aber, da sein Studium kurz vor der
Inflation in den Zwanziger Jahren endete, in seinem Fach keine Arbeit fand,
deswegen ohne weiteres Studium allmählich in den höheren Schuldienst wechselte
und es dort bis zum Oberstudienrat brachte. Sie hatten einen Sohn im
schulpflichtigen Alter. Die Wände der Wohnung dieser Familie waren mit
Bücherregalen bepflastert, denn auch der Mann war ein Büchernarr.
Die Seele der Familie war die Frau. Sie besaß eine erstaunliche
Weltoffenheit, war diskussionsfreudig, war dabei aber auch eine angenehme und
bereitwillige Zuhörerin, liebte es, junge Leute, also auch die Freunde ihres
Neffen, einzuladen und zu bewirten, machte über ihren Leibesumfang selbst
Witze, fragte schalkhaft, wenn wir mit ihr zusammen ein Konzert oder anderes
besuchten, ob wir uns mit so einem dicken Weib überhaupt sehen lassen wollten,
qualmte Pfeife und rauchte dicke Zigarren, war in meiner damaligen Umgebung der
einzige ältere Mensch, der sich die Mühe machte, mit mir über Kunst zu sprechen
und zu streiten, wurde für mich so etwas wie eine Mentorin in allen wichtigen
Lebensfragen. Sie war im besten Sinne des Wortes unbürgerlich, hatte keine
Komplexe und kannte keine Vorurteile. Sie spielte auch leidenschaftlich Skat.
Fast jede Woche verbrachte ich in dieser Familie einen Abend. Ihre Freundschaft
war für mich ein großer Gewinn.
Die Symancziks sind bei Kriegsende aus Breslau geflüchtet und nach
Bockenem im Harz verschlagen worden, wo ich sie nach dem Krieg mit meiner
zweiten Frau, Cornelia, noch mehrere Male besuchte. Unser letzter Besuch in
Bockenem galt Hedes Grab. Das war vor 25 Jahren.
Am Ende meines vierten Studiensemesters - es war das Wintersemester
1931/32 - wurde durch eine Notverordnung unter Reichskanzler Brüning die Breslauer
Akademie geschlossen. Wo sollte ich weiterstudieren? Da ich mich für das
Kunsterzieherexamen entschieden hatte, war es das vorteilhafteste, an die
Staatliche Kunstschule Berlin-Schöneberg zu gehen, weil diese das Preußische
Zentralinstitut für Kunsterziehung und der Sitz des Künstlerischen
Prüfungsamtes für ganz Preußen war und auch ein Werklehrerseminar besaß.
Daß ich mich dort in das Atelier von Georg Tappert (Worpswede,
Novembergruppe) einschreiben ließ, ist auf meinen Studienfreund Hans Berntsch
zurückzuführen. Mia May, Tappertschülerin und Textildesignerin, die mein
Freund als die einzige künstlerische Persönlichkeit seines Heimatortes gut
kannte, hatte ihm so viel Interessantes über Tappert erzählt, daß unser
Entschluß schnell feststand. Und ich habe dann bei Tappert auch alles gefunden,
was ich bei Oskar Moll vermißt hatte.
Mein erster Eindruck von Tappert, den ich damals registrierte, war so:
klein, untersetzt, unsportlich, Bauch, weiße Haare, halbe Brille mit goldener
Fassung, rosa Hautfarbe, blauer Anzug und das auffallendste: aufmerksame,
flinke, bewegliche, funkelnde Augen, denen nichts zu entgehen schien.
Da es nichts Besonderes ist, wenn jemand raucht, stellte ich erst einige
Tage später ein weiteres Merkmal fest: immer ein Zigarillo im Mund. Dann
bemerkte ich auch die Ausbeulung seiner linken Jackentasche: eine Hunderterkiste
Zigarillos. Während der Korrekturen blieb das rauchende Zigarillo im Mund, die
Asche fiel auf die blaue Jacke und wurde jedes Mal unter Husten und Prusten mit
der Hand abgeklopft. An dem Minimalstummel des zu Ende gehenden Zigarillos
wurde sofort ein neues angezündet. Tapperts Raucherhusten war schon zu hören,
ehe er zur Tür hereinkam.
Diese Äußerlichkeiten
paßten besser zusammen, als man es beschreiben kann. Sie gehörten zu einer
hervorstehenden Eigenschaft Tapperts. Er war im besten Sinne des Wortes
menschlich. Ein Mensch stand da vor einem, der nicht mehr scheinen wollte, als
er wirklich war. Alles Äußere gehörte selbstverständlich zusammen. Nichts war
aufgesetzt, nichts daran war künstlich zusammengebastelt, nichts wurde
versteckt
Auch seine cholerischen Zornanfälle gehörten dazu, sie kamen kurz und
prägnant, aber wenn herausgesprudelt war, was er sagen wollte, war der Zorn
schon verraucht.
Die künstlerische Arbeit der Studenten interessierte ihn lebhaft, aber er
tastete die darin enthaltene persönliche Auffassung nicht an, im Gegenteil, er
tat alles, um sie zu fördern. Seine Korrekturen konnten meistens nicht als
Einzelkorrekturen verstanden werden, sondern als Belehrung allgemeiner Natur.
Aber auch das ist nicht zutreffend. Eher ist das Wort Lehre richtig. Tappert
benutzte die einzelne Schülerarbeit dazu, über ein allgemeines Problem der
Kunst oder der Malerei zu sprechen wie Komposition, Verformung, Abstraktion,
Einheitlichkeit des künstlerischen Ausdrucksmittels, über Valeurs, Tonigkeit,
Stufung, Modellierung, Modulierung usw. usw. Dadurch fühlte sich jeder
anwesende Schüler angesprochen. Tappert sah auch manchmal nur kurz auf eine
Arbeit und sagte nichts. Das - die schon länger bei Tappert arbeiteten,
verrieten es uns - bedeutete Anerkennung: Nicht stören, hier malt einer!
Da Tappert viele Studenten hatte - im Sommersemester 1932 waren es über
dreißig -, hatte der einzelne Student verständlicherweise nur wenig
persönlichen Kontakt zu ihm. Ich wunderte mich darüber, daß die Studenten nie
in das Atelier des Meisters hineinkamen, daß man an der Tür sehr kurz
abgefertigt wurde, wenn man ihn schon einmal störte. Aber immer erschien er in
der Tür mit Riesenpalette und Zigarillo und einem ganzen Bouquet von Pinseln.
Er arbeitete also stets. Daß seine politische Wachheit ihn schon damals
vorsichtig machte und er fürchten mußte, daß sich unter seine Studenten auch
der eine oder andere Nazi mischen könnte, wurde uns schon bald vor Augen
geführt. Und als ich nach zwei Semestern Werkstudium und nach bestandenem Werklehrerexamen
im Oktober 1933 mein für ein Jahr unterbrochenes Malstudium wieder aufnahm,
war Tappert bereits von den Nazis die Hochschultätigkeit untersagt worden, was
aber widerrufen wurde.
Während des kurzen Sommersemesters 1932 hatte ich kein einziges
persönliches Gespräch mit Tappert führen können, auch hatte ich nie ein Bild
von ihm zu sehen bekommen. Keine persönliche Beziehung zu ihm hatte sich
anbahnen lassen - so meinte ich. 1948, 16 Jahre später, wurde ich von ihm eines
besseren belehrt. Er hatte mich sehr wohl in Erinnerung behalten.
Das Sommersemester 1932 und die darauf folgenden Semesterferien
verbrachte der an der Kunstschule Schöneberg lehrende Malprofessor Curt Lahs
mit seinen Studenten auf Istrien in Italien in der kleinen Fischerstadt Pirano
(jetzt Piran, jugoslawisch). Am Ende dieses Semesters, meines fünften, ergab
sich für mich eine Gelegenheit, mit zehn anderen Studenten ebenfalls dorthin zu
reisen. Dieses Vierteljahr in Pirano wurde für mich sehr entscheidend. Die
Intensität, die ich dort beim Malen und Zeichnen entwickeln konnte, überstieg
meine bisherigen Vorstellungen. Und Curt Lahs war ein sehr einfühlsamer Lehrer,
dem ich viel verdanke. Damals kam mir zum Bewußtsein, daß ich wahrscheinlich
mein Leben lang nicht mehr von der Malerei wegkommen würde.
Curt Lahs stellte für uns Studenten einen Einzelfall dar, weil im
derzeitigen Professorenkollegium noch alles mit Vorbehalt betrachtet wurde, was
über den Expressionismus hinausging, der durch Georg Tappert, Willi Jäckel und
Rudolf Großmann würdig vertreten und daher auch respektiert wurde.
Unter den damals außerordentlich lebhaften und debattierfreudigen
Studenten ging das Gerücht, Lahs sei ein Feind alles Gegenständlichen und dulde
nur das Gegenstandslose. Wie unbegründet dieses Gerücht war, stellte sich für
mich sehr schnell heraus. Seine erste Korrektur zeigte mir schon, wie sehr er
mit der sichtbaren Welt vertraut, wie sehr seine Gesamtpersönlichkeit von ihr
durchdrungen war und wie selbstverständlich es ihm war, daß der Künstler seine
Impulse, vielleicht sogar seine gesamte Potenz aus dem Erlebnis der sinnlich
wahrnehmbaren Natur beziehe. Andererseits hörte ich zum ersten Mal in meinem
Studium aus dem Munde eines Professors, daß auch das freie Spiel mit den vom
Gegenstand losgelösten Formen und Farben von den Sinneserlebnissen des Malers
die Kraft zur Gestaltung erhalte und nicht allein vom Verstände. Diese damals
bestimmt nicht selbstverständliche, von ihm bis in seine letzten Lebensjahre
beibehaltene Einstellung zur künstlerischen Gestaltung hat aus ihm eine
Künstlerpersönlichkeit werden lassen, die außerordentlich produktiv, aber auch
gleichzeitig als Lehrer hervorragend geeignet war.
Im sechsten und siebenten Semester stürzte ich mich in das Studium des
Faches Werkerziehung und schloß es durch die Werklehrerprüfung ab.
Das Werklehrerstudium brachte mir unter anderem auch wenigstens ein
Teilerlebnis des Berufes, den ich mir in meiner Kindheit gewünscht hatte.
Endlich konnte ich mich, so viel ich wollte, in der Holzarbeit mit richtigen
Werkzeugen austoben. Ich bin wie ein Handwerker täglich um sieben Uhr morgens
in den Werkstätten gewesen und habe oft bis zum Abend durchgearbeitet Dabei
machte mir die Arbeit in den Werkstätten für Metall und Papier ebenfalls viel
Freude. Die Metallwerkstatt stand unter der Leitung von Wilhelm Wagenfeld,
der damals als Designer schon viel von sich reden machte. Die Papierwerkstatt
leitete Harro Siegel, der zu dieser Zeit ein bekannter Puppenspieler
(Marionetten) war. Er hatte auch in der Kunstschule eine Werkstatt für
Marionettenbau und -spiel eingerichtet. Es war für mich selbstverständlich, daß
ich auch bei ihm arbeitete. Alle diese handwerklichen Disziplinen machten mir wenig Schwierigkeiten. Ich fühlte mich nach diesen beiden
Semestern durch viele neue Fähigkeiten bereichert. Dieses Jahr war für mich ein
glückliches Jahr, auch in ganz anderer Beziehung.
Nach der Werklehrerprüfung, bei Beginn meines achten Semesters, wollte
ich mich wieder vermehrt der Malerei widmen. Ich fand eine vollständig neue
Situation vor. Die meisten künstlerischen Lehrer waren von den Nazis verjagt
worden. Der Januar 1933 lag schon fast ein dreiviertel Jahr zurück. Der
Direktor Heinrich Kamps, Willi Jaeckel und Curt Lahs waren zu "entarteten
Künstlern" erklärt worden, hatten Malverbot erhalten und ihre
Lehrtätigkeit aufgeben müssen. Auch unseren hochgeschätzten Kunsthistoriker Dr.
Oskar Fischel hatte man, wegen seiner jüdischen Abstammung, entfernt. Georg
Tappert hatte zwar im Sommer 1933 seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen dürfen,
aber ich habe nichts davon erfahren, wußte auch nicht, daß er mit seinen
Studenten in der Fränkischen Schweiz arbeitete. Auch habe ich Tappert nach 1933
nicht mehr wiedergesehen. 1937 wurde er schließlich entlassen und erhielt
Ausstellungs- und Malverbot, seine Bilder wurden aus den Museen entfernt.
Noch anderes war in dieser Zeit passiert. Ich war damals erster
Vorsitzender der Studentenschaft der Kunstschule Schöneberg. Eines Tages - bis
dahin (etwa Februar 1933) hatten wir zwar schon gestiefelte Studenten, die sehr
unter unserem Spott zu leiden hatten, sie verhielten sich aber zurückhaltend -
eines Tages also wurde ich auf in der Kunstschule angeklebten Plakaten als
Marxist bezeichnet, der die Studentenschaft nicht länger "führen"
dürfe. Die Plakate wurden von zwei Kommilitonen mit Hakenkreuzbinden am Arm
bewacht.
Einige Tage später - ich arbeitete gerade in dem kleinen Zimmer, das für
die wenige Büroarbeit des Studentenausschusses zur Verfügung stand - wurde die
Tür zu diesem Raum von außen sperrangelweit aufgerissen, und vor mir standen
etwa 20 Hakenkreuzbinden tragende Mitstudenten, ganz vorn mein Stellvertreter,
der sich bis dahin nie als Nazi zu erkennen gegeben hatte. Dieser kam auf mich
zu und sagte mit leiser Stimme, man fordere mich auf, den Vorsitz niederzulegen
und die Schlüssel der nationalsozialistischen Studentenschaft auszuhändigen,
und fügte noch leiser hinzu, er bitte mich, keinen Widerstand zu leisten, weil
man entschlossen sei, dann Gewalt anzuwenden. Die Übermacht war überzeugend.
Proteste waren sinnlos. Der Wechsel wurde schließlich vom Kultusminister sanktioniert,
der sich sogar dazu herabließ, den bisherigen Vorstand zu empfangen.
Im gleichen Frühjahr überfiel ein SA-Sturm, an seiner Spitze der
SA-Sturmführer Otto Andreas Schreiber, die Kunstschule Schöneberg. Schreiber
war ein ehemaliger Student des Hauses, war inzwischen als Assessor im
Schuldienst tätig, galt als eine große Begabung und hatte sogar einmal in der
Berliner Galerie Ferdinand Möller zusammen mit einer Künstlergruppe
ausgestellt, die sich der "Norden" nannte. Während des Überfalls
holten seine SA-Leute die Mitglieder des Künstlerischen Prüfungsamtes aus der
gerade stattfindenden Sitzung und stellten sie auf die Straße, darunter den
Vorsitzenden des Künstlerischen Prüfungsamtes, Philipp Franck, den Direktor der
Kunstschule Schöneberg, Heinrich Kamps, und meine Lehrer Tappert und Lahs,
hißten eine Hakenkreuzfahne auf dem Dach, trieben die anwesenden Studenten
zusammen, schlugen einige, die sich zur Wehr setzten, mit Gummiknüppeln,
suchten sich jüdisch aussehende Studenten heraus, um sie in der Toilette zu
untersuchen, ob sie beschnitten seien. Ein gütiges Geschick hat mich vor diesem
makabren Erlebnis bewahrt, indem es mich kurz vor dem Überfall mit der U-Bahn
zum Straußberger Platz fahren und Holz einkaufen ließ.
Im Sommer 1933 reiste ich mit zwei Studienkameraden - der eine war Hans
Berntsch -, einem Studienassessor (Kunsterzieher), einem Schriftsteller und
dessen Frau nach Jugoslawien. Gideon, der Schriftsteller, war der Initiator. Er
kaufte einen alten Steyr mit sechs Sitzen für 200 Reichsmark,
ließ ihn durchsehen, und wir fuhren los.
Vorher hatte dieser tüchtige Mann den jugoslawischen Gesandten in Berlin
aufgesucht, hatte ihm von unserer Jugoslawienbegeisterung vorgeschwärmt, unsere
geringen Finanzen offengelegt und um Unterstützung gebeten. Er ergatterte ein
Empfehlungsschreiben, das in Serbisch abgefaßt war - wir wissen bis heute
nicht, was darin stand -, und hatte mehrere große, bebilderte Bücher geschenkt
bekommen. Das Schreiben entpuppte sich sofort an der jugoslawischen Grenze, als
wir es zum ersten Mal vorzeigten, als ein Sesam-öffne-dich. In Belgrad begab
sich Gideon mit mir zum Kultusminister.
Das Schreiben verschaffte uns eine Audienz bei ihm. Der Minister stellte
mit uns eine Balkanrundreise zusammen und schickte uns mit einem Brief zur
Bahnverwaltung, aus der wir mit einem Freifahrschein erster Klasse wieder
herauskamen. Die Strecke lautete: Belgrad - Zagreb - Skoplje - Ochrid -
Sarajevo - Dubrovnik - Split - Belgrad. Den Steyr ließen wir in Belgrad.
Dies war eine der herrlichsten Reisen, die ich je mitgemacht habe. Alle
Erlebnisse zu schildern, ist nahezu unmöglich. Ich zähle nur unvollständig auf:
die orientalische Exotik in den südlichen Städten, die abgeschiedenen Dörfer
in den Bergen am Ochrider See, der See selbst mit dem Kloster Sveti Naum,
Bauchtänze, Haremsbesichtigungen, Heiratsmarkt in Sarajevo, in Ochrid ein
riesengroßes Zigeunerdorf, Umtrunk mit dem Primas, eine Leibesvisitation durch
Zöllner mit vorgehaltenen Karabinern in den Ochrider Bergen, weil man uns für
Schmuggler hielt, eine vierstündige Verhaftung in Zagreb aus dem Zug heraus,
weil man uns den Riesenfreifahrschein nicht glaubte und ihn für gefälscht
hielt, und vieles, vieles mehr.
Wir hatten wenig Geld mitgenommen, allerdings alles, was wir auftreiben
konnten. Für Verpflegung hatte jeder nur fünfzig Pfennige täglich zur
Verfügung. Trotzdem konnten wir jeden Morgen ein Täßchen Mokka trinken, für
fünf Pfennige. Für den gleichen Preis konnte man damals ein Kilo Tomaten
kaufen. Alles war sehr billig, und die Gastfreundschaft war überall groß. Auch
die Großherzigkeit gegenüber jungen Menschen war für uns überraschend und kaum
glaublich. In Sarajevo sprach uns z.B. ein Fremdenführer dreimal an. Wir mußten
ihm dreimal einen Korb geben, weil uns das Geld fehlte. Schließlich traf er uns
noch einmal, hatte zwei Herren aus der Tschechoslowakei mitgebracht und
forderte uns auf, an seiner Führung teilzunehmen. Um die Bezahlung sollten wir
uns keine Sorge machen, die beiden Herren hätten schon genügend bezahlt.
Diese Reise war sicher in mancher Beziehung für mein Leben entscheidend.
Sie war meine zweite Auslandsreise. Ich hatte eine - trotz der nur punktuellen
Erlebnisse - sehr beeindruckende Einsicht in diesen außerordentlich
interessanten, vielfältigen, abwechslungsreichen Vielvölkerstaat gewonnen.
Heute liegen 30 Jahre hinter mir, von denen nur zwei oder drei mich nicht in
Jugoslawien sahen.
Während der Durchreise durch die Tschechoslowakei hatte ich mehrere
Slowakendörfer kennengelernt, und ihre freundliche Farbigkeit, man kann auch
sagen, ihre unbefangene Buntheit hatte mich so gefangengenommen, daß ich ein
Jahr später wieder hinfuhr, um dort zwei Monate zu malen.
Im Herbst 1933 trat die
gesamte männliche Studentenschaft der Kunstschule Schöneberg in die SA ein,
d.h. die Vorsitzenden hatten sie, ohne jemanden zu fragen,
"eingetreten". Ich war entsetzt, daß ich nicht daran gedacht hatte,
meinen Austritt aus dieser umgewandelten Studentenschaft zu erklären. Ich habe
schließlich meinen Austritt aus der SA erklärt und, da dieser gerade gesperrt
war, mich bis zur Aufhebung der Sperre beurlauben lassen. Tatsächlich bekam
ich nach vielen Wochen ein Schreiben vom SA-Sturmbann, die Austrittssperre sei
aufgehoben. Der Rest war eine Formalität. Alles ging verhältnismäßig einfach.
Ich glaubte es beinahe selber nicht. Man sagte mir - wahrscheinlich wollte man
mich dadurch umstimmen, daß man mich aus den Büchern so streichen würde, daß
ich niemals würde behaupten bzw. nachweisen können, daß ich der SA angehört
hätte. Man begriff natürlich nicht, welchen Gefallen man mir damit tat.
Ende 1933 hatte sich die
Lage beruhigt. Wir bekamen zunächst einen kommissarischen Leiter und später
Alexander Kanoldt als Direktor und die Maler Schrimpf, Rössing, Schorling als
neue Malprofessoren. Mir waren sie alle verdächtig, weil ich annahm, daß sie
alle Parteigenossen seien, auch ihre Kunst war mir verdächtig, weil die NSDAP
alles, was ich bisher liebte und schätzte, zur "Entarteten Kunst"
erklärt hatte.
Welchen Lehrer sollte ich mir wählen? Tappert war in der Fränkischen
Schweiz, Lahs war entlassen. Ich ging zu Konrad von Kardorff. Ich hatte ihn nur
einige Male gesehen. Er war mir sympathisch, wenn er mit seinem grauen Mops
durch das Kunstschulportal hereinkam, seinen Kamelhaarmantel im Vestibül
auszog, ihn so unter den Arm klemmte, daß er auf dem Fußboden neben ihm
herschleifte. Und immer begann in diesem Moment das gleiche Spiel: Der Mops
verbiß sich mit wütendem Gekläff und heftigem Knurren in ein Mantelende und
ließ sich von seinem großen, stattlichen Herrn, der dabei eine merkwürdig
lässige, aber hoheitsvolle Würde zur Schau trug, in den ersten Stock hinauf-
und den Korridor entlangschleifen.
Zu Kardorff gewann ich bald ein gutes Verhältnis. Auch zu seinem
Privatatelier hatte ich Zugang und konnte mir in Ruhe seine Bilder, auch in
ihrer Entstehung, ansehen. Es entwickelte sich fast eine Vater-Sohn-Beziehung.
Zum ersten Mal hatte ich einen Lehrer, mit dem ich meine geheimsten Gedanken,
z.B. über die Nazis, austauschen und den ich um Rat fragen konnte. Er war mit
Rudolf Großmann befreundet, dem ich oft in Kardorffs Atelier begegnete.
Kardorff und er enthielten sich mir gegenüber nicht ihres bissigen Sarkasmus,
mit dem sie sich über das neue Regime unterhielten. Sie waren auch die letzten
Professoren, die sich in den Prüfungen für die noch vorhandenen jüdischen
Kommilitonen einsetzten. Kardorff war dann auch der einzige beamtete
Hochschullehrer, der den Mut hatte, Liebermann 1935 auf seinem letzten Weg zu
begleiten. Er wurde 1940 vorzeitig pensioniert. Seine Gegnerschaft zum
Naziregime war offensichtlich.
In seiner Malklasse war Kardorff natürlich vorsichtig. Soweit ich das
beurteilen konnte, befand sich kein Hakenkreuzträger unter seinen Schülern.
Andererseits waren sie sämtlich politisch uninteressiert, sie waren sich aber
einig in ihrem Widerwillen gegen den Nationalsozialismus. Die politische
Uninteressiertheit vieler Studenten hatte sich bei der entscheidenden Wahl im
Januar 1933 gezeigt. Viele, sehr viele, waren nicht zur Wahl gegangen. Daß ich
wählen ging, war ihnen unverständlich.
Künstlerisch habe ich von Kardorff viel gelernt. Seine große Erfahrung im
Portraitmalen und im Aktzeichnen befähigte ihn zu einem ausgezeichneten Lehrer.
Beim Aktzeichnen ließ er sich ein Transparentpapier über die Studentenzeichnung
legen und zeichnete über die durchscheinende Zeichnung in atemberaubender
Geschwindigkeit mit einfachster Linie in etwa ein bis zwei Minuten einen Akt,
der uns deutlicher als alle Worte zeigte, was wir übersehen hatten. Von ihm
erfuhr ich auch vieles über Eigenschaften der Ölfarbe und darüber, welche
Farben im Malkasten fürs Portraitmalen unentbehrlich sind.
Im Sommer 1934, am Ende meines neunten Semesters, legte ich die Prüfung
für das Künstlerische Lehramt an höheren Schulen ab. Die Leistungen, die mir
abverlangt wurden, waren bescheiden. In diesem Zusammenhang denke ich mit
großer Hochachtung an die Leistungen, die die Studenten in späterer Zeit, als
ich Leiter des Künstlerischen Prüfungsamtes war (1958 -1969), nachweisen
mußten. Nicht nur das künstlerische Niveau, sondern auch die Breite der
wissenschaftlichen und pädagogischen Ausbildung waren
gegenüber meiner eigenen Studienzeit um ein Vielfaches gestiegen.
Sofort nach Beendigung des Studiums reiste ich für zwei Monate in das
große Slowakendorf Devinska Nova Ves am March-Donau-Zusammenfluß, das ich auf
der Jugoslawienreise 1933 kennengelernt hatte. Mich begleitete eine
Kommilitonin, Marion Weiß, geboren 1907 in Alienstein in Ostpreußen, die später
meine Frau wurde. Sie hatte am Ende des Studiums viel Ärger mit dem
nationalsozialistischen Rassenrummel, weil man hinter ihrem Namen und ihrem
Gesichtsschnitt eine Jüdin vermutete. Devinska Nova Ves mit seinen bunten
Häusern, seiner Riesenrinderherde, der ebenso riesigen Ziegenherde, den vielen
Scharen von Gänsen an der March, mit seiner bunten dörflichen Betriebsamkeit
war für mich der richtige Ort. Ich war damals ein Maler, der den Gehalt seiner
Bilder aus der sinnlichen Freude am optischen Erlebnis bezog und frei war von
jeglichem gedanklichen Ballast.
Im Winter 1934 unterzog ich mich am Provinzialschulkollegium in Breslau
einer wissenschaftlichen Prüfung in Mathematik als Zusatzfach. Ein
wissenschaftliches Zusatzfach wurde überall in Deutschland für den Kunsterzieher
gefordert, weil man ihn angeblich sonst nicht im Schuldienst verwenden konnte.
Während der Gymnasialzeit galt ich als sehr begabt für das Fach Mathematik.
Das Studium hatte mir gezeigt, daß ich kein Mathematiker war. Ich hatte mir in
der Schule die mathematischen Vorgänge immer fast bildlich vorstellen können.
An der Universität war das nicht mehr möglich. Ich kam bald ins Schwimmen und
hatte große Mühe, die vorgeschriebenen Übungen zu schaffen. Auch die Prüfung
habe ich mit Ach und Krach überstanden. Die Mathematik fängt anscheinend dort
erst richtig an, wo sie sich aller bildlichen Vorstellung entzieht.
Nach dieser Prüfung in
Mathematik bekam ich mein Zeugnis über die Prüfung für das Künstlerische Lehramt
an höheren Schulen ausgehändigt. Ich konnte jetzt in den Schuldienst gehen,
wenn ich wollte.
Ich wollte.
Schuldienst
Meine Studienzeit hatte
mich verwandelt. Ich hatte in Breslau und Berlin die Vorzüge der Großstadt
kennengelernt, merkte aber während des gesamten Studiums, daß ich ohne Kontakt
mit ländlichen Gegenden und einfachen Menschen nicht auskam. Die Semesterferien
hatte ich oft in dem primitiven Bauernhaus meines Großvaters in Alt-Schalkowitz
verbracht. Dort, in einer ganz anderen Umgebung, unter ganz anderen Menschen,
in die ich nahezu verliebt war, wuchsen mir mehr Kräfte für meine Malerei zu
als in der Stadt. Andererseits merkte ich auch, daß das Großstadtleben eine
notwendige Ergänzung für meine Entwicklung bedeutete. So wurde ich in der
Studienzeit das, was ich noch heute bin: Ein Hin- und Hergezogener zwischen
Großstadt und Dorf, zwischen Großstadtbetrieb im weitesten Sinne und
dörflicher Stille.
In Berlin wohnte ich
damals mit Marion in der Spichemstraße 16 im Bezirk Wilmersdorf in einem winzigen
Giebelraum unter dem Dach. Wir hatten ein Atelier, zwei solcher Giebelräume,
eine Küche - beim Kochen mußte man einen Gasautomaten mit Groschen füttern -
und eine Toilette gemietet, die alle einzeln von einem Dachbodenkorridor zu
erreichen waren, wohnten aber zunächst sehr bescheiden in dem einen kleinen
Raum, während wir das Atelier und den anderen Raum so vermietet hatten, daß wir
umsonst wohnen konnten. Ende 1934 konnten wir dann das Atelier beziehen, das
eine gewisse Tradition hatte. In diesem Atelier hatte einige Jahre zuvor Bert
Brecht und noch früher Helene Weigel gewohnt. Noch heute besitze ich einen
Tisch, den Brecht für eine improvisierte Bühne angeschafft hatte. (Dieser
ausziehbare Tisch befindet sich heute in der UdK Berlin – Anm. U. Thoma)
Unsere sehr kleine Wohnung
hatte keine waagerechte Decke, so daß zum Aufrechtstehen nur etwa fünf Quadratmeter
zu gebrauchen waren. Alles spielte sich darin ab: Wohnen, Schlafen, Waschen,
Malen und Essen. Zum Heizen benutzten wir im Winter einen kleinen
Petroleumofen, der fürchterlich stank. Aber man konnte auch auf ihm kochen.
Küchen- und Toilettenbenutzung teilten wir mit unseren Untermietern.
Auf dem langen
Dachbodenflur lagen noch zwei weitere Ateliers. In dem einen wohnte und
arbeitete ein alter Maler, der für Pep Eters - einen der größten Berliner
Kitschbilderläden in der Friedrichstraße, Ecke Leipziger Straße, mit dem
trefflichen Werbespruch: "Soll's ein Ölgemälde sein, kauf es bei Pep Eters
ein" - am laufenden Band Stilleben malte. Er besaß fünf Staffeleien, auf
denen immer mindestens drei frische, deckungsgleiche, gleich weit entwickelte
Ölbilder standen. Sie prangten in eß- und trinkbaren Kostbarkeiten wie
Südfrüchten, Fasanen, Auerhähnen, mit Wein gefüllten Karaffen und Weintrauben, alles
in prächtigen Tellern, Gläsern, Schüsseln auf einem kostbaren Teppich oder
Tischtuch. Die fertigen Bilder wiesen eine gewisse vornehme, dunkle, barocke
Tonigkeit auf, aus der die kalten Glanzlichter sich funkelnd abhoben.
In dem anderen Atelier
neben uns wohnte ein Oberkellner mit seiner Frau; er kam immer erst in den
Morgenstunden von seiner Arbeit zurück. Er schien ein leidenschaftlicher
Geiger zu sein. Wenn er mittags ausgeschlafen hatte, stellte er das Radio an
und spielte alles, was aus dem Kasten herauskam, als Solist mit. Die Wand
zwischen seinem schönen geräumigen Atelier und unserem verwinkelten winzigen
Giebelraum war so dünn, daß wir täglich in den vollen Genuß der virtuosen
Darbietungen gekommen wären, wenn wir uns nicht nach kurzer Zeit angewöhnt
hätten, in den frühen Nachmittagsstunden unsere Besorgungen zu machen, spazieren
zu gehen oder sonstwie unsere enge Bleibe zu meiden. Die Frau unseres virtuosen
Nachbarn liebte ihren Mann innig und verehrte ihn aufrichtig. Diese gute Frau
schenkte uns jede Woche einen großen selbstgebackenen Kuchen, weil sie ganz
richtig vermutete, daß es um unsere Kasse nicht zum besten
aussah. Wir brachten es als Gegenleistung nicht übers Herz, uns über die
täglichen akustischen Exzesse ihres Mannes zu beschweren. Als wir später in
unser Atelier umziehen konnten, lag der Giebelraum als akustischer Puffer
zwischen den Konzerten und uns. Unser neuer Untermieter, ein Studienfreund,
hatte gute Nerven. Ihn störte nichts.
1935 unternahm ich einen
Versuch, meine Kopfschmerzen loszuwerden, die seit meiner Kindheit nicht aufgehört
hatten, mich zu quälen. Ich ließ mich in der Berliner Charité kreuz und quer
untersuchen. Der abschließende Befund war ganz und gar negativ. Man schätzte,
daß meine Kopfschmerzen migränoider Natur seien und verschrieb mir eine
einmalige Kur mit 20 Tabletten Lubrokal. Nach zwei Wochen waren die Kopfschmerzen
weg. Achtzehn Jahre hatte ich mich damit gequält. Ich glaubte nicht an dieses
Glück. Und die Schmerzen kamen noch dreimal wieder, zuletzt 1942 während des
Rußlandfeldzuges. Jedesmal wiederholte ich die Kur, dann sind die Schmerzen bis
heute weggeblieben.
Meine Bilder aus der Zeit zwischen Studium und Zweitem Weltkrieg malte
ich immer direkt vor der Natur. Sie waren Nachempfindungen des Sehbildes.
Trotzdem wurden meine Bilder in keiner Ausstellung angenommen. Sie kamen immer
mit einem kurzen, höflichen Begleitschreiben zurück, sie seien für
Ausstellungen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden, zu
problematisch. Ich wußte, was das bedeutete. "Unser Führer" hatte ja
in seiner Rede zur Eröffnung der ersten Großen Deutschen Kunstausstellung im
Haus der Kunst in München gesagt, daß entartete und problematische Kunst im
Tempel der deutschen Kunst keinen Platz hätten. Und ich hatte immer gedacht,
meine Bilder seien harmlos und unproblematisch.
Meine Erfolgschancen als
Maler waren also gleich Null. Unter diesen Umständen fiel es mir gar nicht
schwer, mich Ostern 1935 um Aufnahme in den höheren Schuldienst zu bewerben.
Die prekäre Lage unserer Finanzen erforderte es.
Marion, die das erste
Staatsexamen zur gleichen Zeit wie ich abgelegt hatte, ging nicht in den
Schuldienst. Wir stimmten darin überein, daß es so besser sei. Einer von uns
sollte sich von den Belastungen und Spannungen des Berufstrotts freihalten.
Einige Jahre später, als ich zum Kriegsdienst eingezogen war, hat sie sich dem
Referendardienst doch noch unterzogen und ist schließlich Studienrätin
geworden.
Während der Studienzeit hatte ich meinen Eltern auf der Tasche gelegen.
Sie hatten mir während des gesamten Studiums monatlich 60,— Mark geschickt,
wovon ich je ein Drittel für Zimmer, Malmaterial und Verpflegung benutzte. Ich
kam mit diesem Geld gut aus. Nach dem Examen schien es mir an der Zeit zu sein,
mich finanziell auf eigene Beine zu stellen. Ich schrieb meinen Eltern, mir in
Zukunft kein Geld mehr zu schicken. Außerdem teilte ich Ihnen mit, daß Marion
und ich am 17. Januar 1935 heiraten würden. Ich war mir klar über die
finanziellen Aussichten. Als Studienrefendar hatte man damals keinen Anspruch
auf Entgelt. Die Referendarzeit galt als Ausbildungszeit und mußte von dem
Referendar selbst finanziert werden. Die zwanzig Mark Waisenrente, die Marion
monatlich bekam, fielen nach der Heirat weg. Womit wir unseren Lebensunterhalt
finanzieren würden, war ungewiß. Aber wir waren jung und hatten alle möglichen
Fertigkeiten während unseres Studiums erlernt. Es würde schon gehen. Und es
ging: mit Anstreicherarbeiten, Postaushilfe, Webstuhlbau, Schriftschreiben usw.
Bei Beginn des zweiten Halbjahres der Referendarausbildung ging es uns dann
besser, weil wir auf Antrag einen staatlichen Unterhaltszuschuß von monatlich
50,— Mark, während des zweiten Jahres sogar 80,— Mark und dann 100,—Mark bekamen,
immer abzüglich der zehn Prozent Gehaltskürzung, die aufgrund einer
Notverordnung des Reichskanzlers Brüning auch während der Nazizeit noch
praktiziert wurde. Aber das Geldverdienen durch Gelegenheitsarbeiten ging
weiter bis zum Ende meiner Referendarzeit. Marion arbeitete vor meinem
Assessorexamen ein halbes Jahr als technische Zeichnerin bei Telefunken, damit
ich ungestört meine Hausarbeit schreiben konnte.
Während meiner Tätigkeit als Lehrer hatte ich viel Glück. Mein erstes
Referendarjahr 1935/36 hatte ich im Prinz-Heinrich-Gymnasium in
Berlin-Schöneberg abzuleisten. Dort unterrichtete der mir schon durch mein
Studium bekannte Maler und Kunsterzieher Otto Möller, ehemaliges Mitglied der
Novembergruppe, ein hervorragender Kenner der Kinderzeichnung und ein ebenso
hervorragender Theoretiker des Kunstunterrichts, der lange in dem Berliner
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht als Mitarbeiter tätig war. Er war
mein Tutor und trug durch sein großes pädagogisches Können, durch seine
vorbildliche Menschlichkeit und Güte viel dazu bei, daß sich in mir in kurzer
Zeit Begeisterung für meinen Brotberuf einstellte. Möller verdanke ich fast
mein ganzes pädagogisches Können. Außerdem gewann ich bald in ihm einen
väterlichen Freund und auch einen künstlerischen Mentor, mit dem ich fruchtbare
Gespräche über Kunst und über unsere eigenen Bilder führen konnte.
Eine gründliche Darstellung des Menschen und Malers Otto Möller habe ich
in einem Vorwort für dessen Retrospektivausstellung in der Galerie Nierendorf
im Jahre 1969 versucht. Dieses Vorwort ist in der Nummer 16 der Kunstblätter
der Galerie Nierendorf abgedruckt.
Das Prinz-Heinrich-Gymnasium in der Grunewaldstraße - nur 300 Meter von
der Kunstschule Schöneberg entfernt, wo ich studiert hatte - war ein von wenig
Kunstsinn zeugender roter Backsteinbau. Wenn dieser bei meinem täglichen
Schulweg an der letzten Straßenecke plötzlich vor mir auftauchte, wurde mir
jedesmal übel; wenn ich dann die Haustür und die Windfangtür hinter mir hatte,
verstärkte sich dieses häßliche Gefühl, das mit einem gewissen Angstgefühl
gekoppelt war. Mir war der Vorgang unverständlich, weil verstandesmäßig kein
Grund dafür zu finden war. Nach etwa einem halben Jahr hatte ich mich damit
abgefunden. Aber eines Tages, an der schon erwähnten Straßenecke, tauchte in
meiner Erinnerung ein anderer Backsteinbau auf, die "Katholische
Volksschule für Knaben" in Neisse, in der ich - ich schilderte es schon -
zwei Jahre von einem grausamen Lehrer unterrichtet wurde. Hiernach dauerte es
nur noch kurze Zeit, bis ich von dieser störenden Übelkeit befreit war. In
meinem Unterbewußtsein hatte sich also eine visuelle Assoziation zu dem
Backsteinbau der Neisser Volkschule eingestellt und die Angstgefühle meiner
Schulzeit aktiviert, die dann noch beim Betreten des Hauses durch den Geruch
des Fußbodenöls, anscheinend dem gleichen wie in der Volksschule, verstärkt
wurden.
Die unangenehmen Schulerlebnisse aus meiner Kindheit trugen sicher auch
eine Mitschuld daran, daß ich in diesem ersten Ausbildungsjahr gewisse
Disziplinschwierigkeiten beim Unterrichten hatte. Als ich mich für den
Schuldienst entschloß, hatte ich mir vorgenommen, daß es die Schüler bei mir
besser haben sollten als ich bei meinen Lehrern. Ich war deshalb zu den
Schülern ausnehmend freundlich. Das ließ sich zunächst gut an. Aber im Laufe
des Jahres geriet die Disziplin in einen irreparablen Zustand. Dabei waren die
Schüler keineswegs absichtlich destruktiv eingestellt. Sie waren vielmehr
zutraulich wie verspielte junge Schäferhunde. Ich war froh, als das Jahr vorbei
war und ich in einer anderen Schule einen weiteren Versuch beginnen konnte. Ich
stimmte dort meine Freundlichkeit um erhebliche Prozente zurück, und siehe da,
die Schwierigkeiten waren nur noch unerheblich. Ich hatte den richtigen Ton gefunden.
Die Schüler liebten mich trotzdem.
Zur Ableistung meines zweiten Referendarjahres 1936/ 37 wurde ich an das
Real-Gymnasium in Berlin-Pankow versetzt. Ich fand dort wieder einen sehr
verständigen und versierten Tutor, den Maler Paul Kuhfuß. Er half mir, in
Pankow ein Atelier zu suchen. Wir fanden schließlich eins in der Wolfshagener
Straße Nr. 82, ganz in der Nähe des Realgymnasiums. In jungen Jahren hatte
Kuhfuß dieses Atelier mehrere Jahre selbst bewohnt. Es war als Wohnung ungeeignet,
kostete aber nur 20 Mark Miete und war uns deswegen höchst willkommen. Es
bestand aus dem Atelier (etwa fünf mal sechs Meter) und zwei winzigen
Nebenräumen, einer winzigen Küche und einer winzigen Toilette. Es lag im
vierten Stock unter dem Dach. Die Wände und das Dach waren nicht isoliert. Im
Sommer war es unerträglich heiß, im Winter reichte ein großer Dauerbrandofen
zum Heizen nicht aus. Das Atelier hatte zwei große schräge Fenster, eins nach
Norden mit einem Balkon davor und eins nach Süden.
Kuhfuß wurde für mich zum Beispiel und Beweis dafür, daß man als
Kunsterzieher sehr wohl auch noch viel malen konnte. Schon Otto Möller hatte
mir das erste Beispiel dafür geliefert. Paul Kuhfuß übertraf in dieser Richtung
aber alle meine Vorstellungen. Er hatte sogar in einem Raum neben dem
Zeichensaal eine Staffelei stehen. Dort roch es immer nach frischer Ölfarbe,
genau wie im Atelier seiner Wohnung. In diesem Raum malte er während der Pausen
und während seiner Hohlstunden. Dabei rauchte er seine unvermeidliche Zigarre.
Überall folgte ihm eine Wolke von Zigarrenrauch. Für ihn war ein Kunsterzieher,
der nicht künstlerisch produktiv war, ganz und gar indiskutabel. Im Nebenraum
des Zeichensaals war eine ganze Wand in drei Etagen mit Wechselrahmen
bepflastert. Kuhfuß erwartete, daß jeder Referendar wenigstens einmal monatlich
Beispiele seiner neuesten künstlerischen Produktion dort präsentierte.
Sein praktischer Mal- und Zeichenunterricht beschränkte sich auf rein
technische Ratschläge und Hilfen. Besonders in den unteren Klassen waren
dadurch seine Schüler, die er ansonsten gewähren ließ, regelrechte kleine
Maltiere. Überhaupt war Kuhfuß durch und durch Praktiker. Hatte ich bei Otto
Müller die innere Disziplin des Kunstunterrichts erlernt, bekam ich nun eine
eingehende Lektion in der äußeren Disziplin. Ich verdanke auch ihm viel für
meine spätere Unterrichtspraxis. Wir blieben bis zu seinem Tode
freundschaftlich verbunden.
Paul Kuhfuß hatte die äußere Ordnung im Zeichensaal bis ins kleinste
durchorganisiert. Jeder Schüler brachte zum Kunstunterricht eine Zigarrenkiste
mit folgendem Inhalt mit: Tuschkasten mit Deckfarbennäpfchen, Haarpinsel,
Borstenpinsel, Leinenlappen, schwarze Tusche, Federhalter mit Kugelspitzfeder,
Bleistift, Bleistiftanspitzer, Radiergummi. Dieses Werkzeug genügte, um
jederzeit vom Malen zum Zeichnen und umgekehrt überzugehen, so daß die sonst
nötigen Eintragungen in die Aufgabenbücher und andere Erinnerungshilfen
vermieden wurden. Die Zeichenblöcke - selbstverständlich nur solche, deren
Blätter an drei Rändern perforiert und fest an die stabilisierende Pappe
geheftet waren - blieben im Zeichensaal, waren immer unbeschädigt und
griffbereit, weil jede Klasse ein gesondertes, abschließbares Schrankfach
besaß, in das die Blöcke von Ordnungsschülern eingeschlossen bzw. in der
nächsten Stunde wieder herausgeholt und verteilt wurden. Jedem Schüler stand
zum Malen ein Einliteraluminiumtopf mit Henkel zur Verfügung. Diese Töpfe
standen in einem großen, flachen Ausgußbecken geordnet in fünf Zehnerreihen,
wenn man sie nicht brauchte. Die mit Wasser gefüllten Töpfe wurden in der Pause
vor dem Zeichenunterricht von Ordnungsschülern verteilt, genauso wie die
Zeichenblöcke. Die Schüler brachten lediglich ihre Zigarrenkiste mit den
Werkzeugen mit, und die Arbeit konnte sofort beginnen. In der Pause zwischen
den Stunden wurden die Töpfe von zwei Schülern wieder mit frischem Wasser
gefüllt und Papierschnitzel von den Tischen und vom Fußboden in den Papierkorb
befördert. Die wenigen Abfälle, die beim Malen oder Zeichnen anfielen, konnte
jeder Schüler auf den Fußboden werfen. Auf diese Weise hatte kein Schüler
einen Grund, seinen Platz zu verlassen. Gearbeitet wurde bis zum Pausenzeichen.
Die Blöcke blieben auf den Tischen liegen. Jeder Schüler hatte nur sein
Werkzeug einzuräumen und mit der Zigarrenkiste den Raum zu verlassen. Die
Ordnungsschüler sammelten die Blöcke ein, noch nasse Blöcke wurden an der
Rückwand des Saales auf dem Fußboden abgelegt und nach dem Trocknen von der
folgenden Klasse in das entsprechende Schrankfach eingeordnet. Diese peinliche
Ordnung bewirkte eine Arbeitsdisziplin, die sich auf die entstehenden
Schülerarbeiten fruchtbar auswirkte. Nach einer kurzen unruhigen Phase am
Anfang jeder Stunde waren nur noch die üblichen Arbeitsgeräusche zu hören,
wozu natürlich auch kleine Unterhaltungen der Schüler gehörten. Pflegliche
Behandlung jeder Schülerarbeit war oberstes Gesetz. Vor dem Abtrennen einer
Arbeit vom Block besprach Kuhfuß mit dem betreffenden Schüler genau, ob die
Arbeit schon fertig war oder nicht. So wurde vermieden, daß auf einem lockeren
Blatt weitergearbeitet werden mußte. Es gab nur wenige Schüler, die solche
Notwendigkeiten nicht einsehen wollten.
Nach 1933 war das
Realgymnasium in Berlin-Pankow in Carl-Peters-Schule umgetauft worden, nach dem
Kolonialpolitiker und Afrikaforscher, der 1884/1885 Deutsch-Ostafrika in
kaiserlichen Besitz gebracht hatte. Diesen neuen Namen hatte Paul Kuhfuß klug
und listig ausgenutzt, um in der ganzen Schule Negerkunst auszustellen. Er bekam
auch von allen möglichen Seiten afrikanische Masken, Waffen, Kultgegenstände,
Werkzeuge, Gefäße aus Privatbesitz geschenkt. Außerdem ließ er sämtliche
Korridore besonders von Schülern der unteren Klassen mit Motiven von
Urwäldern, Palmenstränden, Negerdörfern, Tierjagden usw. ausmalen. Die Art und
Weise, wie hier Gestaltungen von Negern und deutschen Kindern zusammenklangen,
war überwältigend. Einwände, die meistens von Erwachsenen erhoben wurden, bei
denen die nazistischen Kunsttheorien schon gezündet hatten, Einwände, die
meist schon Verdächtigungen, wenn nicht sogar schon Anklagen gegen Kuhfuß
waren, wurden von ihm mit überlegener und belehrender Eloquenz abgewehrt.
Dabei war er von einer sehr bescheidenen und beinahe vorsichtigen Höflichkeit,
so daß es fast niemandem schwerfiel, ihm recht zu geben.
Die Carl-Peters-Schule war
durch ihn zu einer regionalen Sehenswürdigkeit geworden. Besichtigungen durch
ganze Klassen anderer Schulen waren keine Seltenheit. Denn die Korridore
enthielten auch viel Wissenswertes über den schwarzen Kontinent, z.B.
Übersichtskarten über Rohstoffvorkommen und Naturprodukte oder über die
Bodenbeschaffenheit usw., außerdem Statistiken und geschichtliche Übersichten.
Alles war augenfällig und einprägsam dargestellt
Paul Kuhfuß war
handwerklich außerordentlich geschickt und technisch versiert. Rahmen zu
machen, sie echt zu vergolden, Möbel zu polieren, japanische Lackarbeiten zu
restaurieren - viele solcher Dinge konnte er. Seine Wohnung war voller
gediegener Möbel und Gegenstände der verschiedensten Epochen. Er kannte sich
auf diesem Gebiet gut aus. Ich hatte das Gefühl, daß nicht der Wert dieser
Dinge für ihn wichtig war, sondern ihre optische Gegenwart. Er mußte solche
Gegenstände immer vor Augen haben. Seine Augen brauchten immer viel Futter.
Auch in seinen Bildern ist ja eine gewisse barocke Fülle zu erkennen. Es
interessierte ihn z.B. nicht, daß die schöne Biedermeierstanduhr nicht mehr
ging, aber sie war wunderschön poliert. Hinter der Tür ihres Ketten- und
Gewichtskastens hingen fein säuberlich hintereinander Hosen an Spannern. Auf
dem herrlichen großen Barockschrank standen zwei große, ausgesucht schöne
Delfter Deckelvasen. Aber nur eine davon war echt. Es war ihm ein besonderes
Vergnügen, seine Besucher und Freunde in Verlegenheit zu bringen. Dazu stieg er
auf einen Stuhl, nahm eine der Vasen unter sichtlicher Anstrengung herunter und
gab sie dem Nächststehenden in die Hand. Das passierte auch meiner Frau
Marion, die die Vase mit einem leichten Aufschrei fallen ließ. Diese Vase war
nämlich unerwartet leicht, weil sie aus Holz gedreht und von Kuhfuß täuschend
genau nach dem Original bemalt und lackiert worden war.
Ich fand Kuhfuß in einem
liebenswerten Sinne absonderlich und skurril. Bei ihm war alles anders als bei
anderen Menschen. Wenn ich eine schriftstellerische Begabung besäße, würde ich
sicher eine ganze Novelle über ihn schreiben können. In tiefster Seele war er
ein Romantiker. Von seiner Wohnung aus malte er oft und zu allen Jahreszeiten
den Amalienpark. Dieser war ein sehr schöner, aber winziger bürgerlicher Platz
mit großen Bäumen und Rondellen. Kuhfuß machte aber einen Urwald daraus, in
dem man vor Überraschungen nicht sicher war. Auch seine geliebten Ferienorte
Rowe und Nidden, die er uns anhand seiner Bilder und Zeichnungen schilderte,
um uns dafür zu begeistern, waren in seinen Arbeiten phantastische,
märchenhafte Orte geworden. Jedenfalls konnten diese Ostseedörfer meinen durch
Kuhfuß hervorgerufenen Erwartungen nicht standhalten; ich mußte erst eine
gewisse Ernüchterung überwinden, als ich diese Orte kennenlernte.
Im Sommer 1938 waren Marion und ich mit Kuhfuß zusammen in Nidden, um
dort zu malen. Eines Tages sahen wir ihn in der Dorfstraße auf einem abgestellten
Bauernwagen sitzen, den Aquarellblock mit einer angefangenen Arbeit neben
sich, den Aquarellkasten mit dem Pinselbündel in der rechten Hand, - er malte
stets mit der linken Hand. Er schien uns sehr traurig zu sein, als habe er
einen großen Kummer. Anteilnehmend fragten wir ihn. Er zog schweigend einen
Pinsel hervor, der sehr mitgenommen aussah. Nach einiger Zeit sagte er:
"Hier, der Pinsel!" Da wir schwiegen, fügte er kummervoll hinzu:
"Der konnte Gras machen." Traurig betrachtete er den Pinsel, den ich
wegen seines Borstenschwundes längst weggeschmissen hätte, und sagte:
"Der hat soeben eine Borste verloren, jetzt kann er es nicht mehr",
und indem er einen anderen Pinsel hervorzog: "Der kann es vielleicht in
14 Tagen, jetzt ist er noch nicht so weit". Als ich ihm vorschlug, diesem
Pinsel einige Borsten auszureißen, schüttelte er mißbilligend den Kopf:
"Das geht nicht, man muß ihm Zeit lassen. Der lernt es von allein".
Dabei ergriff er seinen Block und malte weiter, sprach dazu und zeigte uns, wie
verschiedene Eigenschaften seine Pinsel besaßen; der eine konnte Sand, der
andere Wolken, der dritte Laubwerk machen usw. Es war interessant, ihm
zuzusehen. Seine Geschicklichkeit und die Schnelligkeit, mit der er malte,
waren bewundernswert. Auf dem Heimweg sagte er zu mir, ich hätte es ja
einfacher mit den Pinseln als er, denn ich malte ja nicht Gras oder Wolken oder
Sand, sondern nur deren Farbe. Er hatte recht.
1937, kurz nach meinem Assessorenexamen, bekam ich eine halbe Stelle in
Pankow, wenig später konnte ich im Luisenstädtischen Realgymnasium (Nähe
Spittelmarkt) eine Planstelle antreten. Ich fand dort ein angenehmes
Lehrerkollegium und in Alfred Homeyer einen außerordentlich verständnisvollen
Direktor. Er legte, als er gemerkt hatte, wieviel ich neben der
Unterrichtstätigkeit malte, meine Unterrichtsstunden auf fünf Wochentage, so
daß ich den Montag immer frei hatte. Er begründete das so: Kollegen, die neben
ihrer Unterrichtstätigkeit wissenschaftlich produktiv seien, hätten ein Recht
auf einen freien Wochentag. Das gleiche Recht habe auch ein Kunsterzieher, wenn
er nebenher künstlerisch produktiv sei.
Das war eine große Hilfe für mich. Ich hatte nun in jeder Woche zwei
freie Tage, an denen ich von früh bis abends malen konnte. Unterricht ist eine
schwere Arbeit, selbst wenn sie dem Lehrer Freude macht. Sie kostet viel
Kraft. Ich probierte verschiedene Tageseinteilungen aus, um auch Kraft genug
zum Malen zu haben. Z.B. stand ich im Sommer vor Morgengrauen auf, um beim
ersten Tageslicht an der Staffelei zu stehen. Aber wenn ich das wochenlang
durchgehalten hatte, überfiel mich schon gegen zehn Uhr früh starke Müdigkeit,
was sich sehr negativ auf die Qualität meines Unterrichts und auf die
Disziplin der Schüler auswirkte, so daß ich gezwungen war, den Tag wieder
anders einzuteilen. Marion, die selbst auch viel malte, nahm mir
verständnisvoll alle sonstigen Arbeiten ab. Trotzdem begriff ich, daß es schwer
werden könnte, durchzuhalten.
Es gab aber noch andere Schwierigkeiten. Ich hatte, als die ersten
Unterrichtsresultate vorlagen, die schönsten Arbeiten der Unterstufe in
Korridoren und Klassenzimmern ausgehängt. Etwa drei bis vier Tage später waren
viele Rahmen nach dem Muster der Ausstellung "Entartete Kunst" mit
Sprüchen überklebt wie "Judenkunst", "Demnächst hier Ausstellung
Entartete Kunst" oder "Hier hing ein Bild des deutschen Malers
Albrecht Dürer" usw. Die Urheber vermutete ich in den Schülern der
Oberklassen. Ich hatte ja ständig Mitglieder der Hitlerjugend, auch höhere
Chargen, vor mir sitzen. Ich ließ die überklebten Rahmen abhängen und im
Zeichensaal aufhängen, gab in den nächsten drei Wochen in den Oberklassen nur
Kunstbetrachtungsstunden über "primitive" Kunst und deren
Verwandtschaft zu Kinderarbeiten, über die Kunst vor und nach dem Ersten Weltkrieg,
insbesondere über Impressionismus und Expressionismus und über Kitsch.
Natürlich mußte ich dabei auch auf die "Entartete Kunst" zu sprechen
kommen. Die Schüler waren ja gespannt darauf und fragten danach. "Da hing
früher mal ein Bild im Treppenhaus, hieß wohl Turm der blauen Pferde. Det war
doch wohl entartete Kunst, wa?" sagte einer. Das war eine willkommene
Anregung für mich. Ich holte den sehr schönen, immer noch vorhandenen
Piperdruck aus dem Schrank und analysierte im Frage- und Antwortspiel mit den
Schülern das Bild. Farbsymbolik, psychische Wirkung der Farben, Goethes
Farbenlehre, Zusammenhänge zwischen Farbe und Form, stilbedingte Veränderungen
des Erscheinungsbildes der Natur durch den Künstler usw. wurden erörtert.
Beispiele, besonders aus der mittelalterlichen Kunst, die in ihrer Farbsymbolik
zu dem Marcschen Bild in Beziehung stehen (z.B. zinnoberroter Himmel, blaue und
rote Engel) wurden zum Vergleich herangezogen. Am Ende kamen die Schüler selbst
zu dem Schluß, daß ein so logisch durchdachtes Bild nicht als Entartung
bezeichnet werden könne. Einer fand sogar, daß zum Malen eines solchen Bildes
mehr Grips gehöre, als wenn einer von der Natur einfach abpinsele. Ich muß
gestehen, daß ich selten so interessierte Schüler wie in diesen drei Wochen
gehabt habe. Der von mir beabsichtigte Effekt dieser Kunstbetrachtungsreihe
trat auch ein. Ich ließ die gereinigten Rahmen mit den gleichen Kinderarbeiten
wieder an den gleichen Stellen aufhängen. Es ist dann nichts mehr passiert.
Daß ich dabei viel Glück hatte, erfuhr ich erst später nach dem Kriege,
als ich mit einigen früheren Schülern zusammentraf. Sie sagten mir, daß sie
gerade bei diesen Kunstbetrachtungen sehr deutlich gemerkt hätten, daß ich den
Nationalsozialismus nicht schätzte. Ich hatte auch kein Abonnement auf
irgendein NS-Druckerzeugnis. Jede Woche gingen Fragebogen durch das
Lehrerkollegium wie z.B.: Lesen Sie den Völkischen Beobachter? Wenn nein,
warum nicht? Und schließlich die Aufforderung, ab sofort ein Abonnement zu
bestellen. Ich antwortete immer: Nein, ich halte die Frankfurter Zeitung.
Schließlich erweiterten sich die Fragebogen auf Fragen nach
NS-Kampforganisationen und sonstigen NS-Verbänden. Meine Fragebogen hatten nichts
vorzuweisen. Einige meiner unverdächtigen Kollegen rieten mir, wenigstens in
die NSV (Volkswohlfahrt) oder den NSLB (Lehrerbund) einzutreten. Ich tat es
schließlich.
Die Sommerferien des Jahres 1937 verbrachte ich mit Marion in dem Dorf
Rowe an der Ostsee, das mir durch Erzählungen von Kuhfuß und Bilder von
Brückemalem, vor allem von Max Pechstein, bekannt war. Auch Aquarelle von Karl
Schmidt-Rottluff, die er am Lebasee gemalt hatte, hatten mich auf diese Gegend
aufmerksam gemacht. 1938 und 1939 reisten wir im Sommer nach Nidden auf der
Kurischen Nehrung. Wir verlebten dort glückliche Wochen. Meine Vorliebe für
ländliche Gegenden bekam hier einen neuen Akzent, weil sich in mir eine
merkwürdige Liebe zum Meer, zu seiner Weite und zu seinem waagerechten, geradlinigen
Horizont entwickelte. Ich empfand dort zum ersten Mal stärker als im Süden
(Pirano), daß der waagerechte Verlauf des Meereshorizontes für jedes Bild eine
wichtige Bezugskraft wurde und dadurch die anderen Richtungen und Krümmungen
in ihrer Bildbedeutung leichter ablesbar wurden. Auch die Ruhe, die Beruhigung,
die diese eine Waagerechte einem Bilde gibt, trägt wesentlich dazu bei, die
Spannung zwischen den Bildelementen sofort und fast unmittelbar erkennbar zu
machen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich auch die Empfindung, daß ich
auf so etwas wie einen eigenen Bildstil zusteuerte.
Aber die Zeitläufe waren beängstigend. Jeder sprach nur noch vom Krieg.
Als wir 1939 am Ende der Ferien in abgeschlossenen Bahnabteilen durch den
polnischen Korridor fuhren, sahen wir, wie die polnischen Bauern und Arbeiter,
die in der Nähe der Bahnstrecke arbeiteten, mit erhobenen Fäusten, mit Gabeln
und Sensen in Richtung des fahrenden Zuges drohten und sogar mit Steinen
warfen. Sehr beunruhigt und voller Sorge kamen wir in Berlin an.
Im Frühjahr schon hatten wir den Krieg auf uns zukommen gespürt. Um ihm
auszuweichen, hatten wir den Entschluß gefaßt, ins Ausland zu gehen. Ich hatte
mich daher um eine Stelle als Auslandslehrer in Konstantinopel beworben. Man
hatte mir beim Schulamt große Hoffnungen gemacht, daß ich am 1. Oktober schon
dorthin übersiedeln könnte.
Ein Anruf beim Schulamt sofort nach unserer Rückkehr aus Nidden ergab,
daß ich mir am nächsten Tage Papiere und Anweisungen abholen könne. Voller Spannung
war ich schon früh um acht Uhr dort. Ich bekam die Papiere nicht. Die Deutschen
seien alle aus dem Ausland zurückgerufen worden. Neue Auslandslehraufträge
gäbe es nicht mehr, auch sei die Ausreise ins Ausland gesperrt. Wir wußten
jetzt genau, was uns erwartete.
Gleich zu Beginn des Krieges wurden zwei der Naturwissenschaftler des
Luisenstädtischen Realgymnasiums eingezogen. Ich mußte, da kein Ersatz zu
bekommen war, nur noch Mathematik unterrichten. Die Kunsterziehung fiel weg.
Obwohl ich das Fach Mathematik als begabungsfremd für mich empfand, fiel es mir
kinderleicht, darin bis zur Oberprima zu unterrichten. Der Bildungsplan
schrieb ja für Mathematik den Stoff genau vor, während der Kunsterziehung viel
Freiraum zugestanden wurde, den der Lehrer nach Neigung ausfüllen konnte, so
daß er viel Zeit darauf verwenden mußte, Unterrichtsgegenstände und -einheiten
selbst zu finden und zu planen. Außerdem konnte man im Mathematikunterricht
weltanschaulich oder politisch selbst vom raffiniertesten Schüler kaum in
Verlegenheit gebracht werden. Trotzdem: Ohne den Kunstunterricht schmeckte mir
die Schule nicht mehr.
Ein halbes Jahr blieb ich noch vom Kriegsdienst verschont. Aber der
seelische Zustand, in dem wir nun lebten, war belastet durch das Warten auf
meine Einberufung zum Kriegsdienst.
Abschließend zu diesem Lebensabschnitt, der nur fünf Jahre dauerte, sich
aber wesentlich verlängert, wenn man alles, was ich im Studium als Vorbereitung
dazu brauchte, hinzurechnet, - abschließend muß ich also noch deutlich
aussprechen, daß diese Zeit doch sehr wichtig für mich war. Vor allem hat sie
mich sicherer und unbefangener im Umgang mit Menschen gemacht. Eine Erfahrung
besonders bekam für mein späteres Leben große Bedeutung, nämlich daß eine
natürliche Fähigkeit zum bildnerischen Gestalten in jedem jungen Menschen
steckt, daß vieles davon verschüttet wird durch ahnungslose Eltern und Lehrer,
auch durch schlecht vorbereitete Kunsterzieher. In den beiden Schulen, die ich
in meinen drei Assessorenjahren kennenlernte, kamen in jeder Oberklasse bei
Beginn meiner ersten Unterrichtsstunde einzelne, manchmal ganze Gruppen von
Schülern auf mich zu, um mir zu berichten, sie seien gänzlich unbegabt für mein
Fach, auch mein Vorgänger habe das einsehen müssen und habe sie von jeder
praktischen Arbeit im Kunstunterricht befreit; er habe ihnen gestattet, sich
mit Schularbeiten oder Bücherlesen zu beschäftigen usw. Diese angeblich
Unbegabten notierte ich mir namentlich sorgfältig, drückte ihnen mein Bedauern,
ja Mitleid aus, daß sie so verkannt worden seien, und versprach ihnen, alles in
meinen Kräften Stehende zu tun, um sie von ihrem Komplex zu befreien. Das ist
mir auch immer gelungen.
Die intensive Beschäftigung mit den primitiven Anfängen bildnerischen
Gestaltens, speziell mit der Kinderzeichnung, noch dazu in der engen
Nachbarschaft zu meinen beiden Tutoren Möller und Kuhfuß, hat mir mehr Einblick
in das Wesen und die Grundlagen künstlerischer Arbeit gebracht als die gesamte
Studienzeit. Insbesondere die Anleitung, die ich durch Otto Möller - auch für
die Kunstbetrachtung und die Analyse von Kunstwerken in den Oberklassen -
erfuhr, hat mir feste Fundamente für meine spätere praktische Lehrtätigkeit an
der Hochschule geschaffen.
In meiner Studienzeit hatte ich mich fast gar nicht um Kunsttheorien
gekümmert. Nur im Zusammenhang mit Hans von Marpes, den ich eine Zeitlang sehr
verehrte, stieß ich zunächst auf eine Broschüre: "Aus der Werkstatt eines
Malers" von Pidoll, einem Mareesschüler, und damit auch auf Conrad
Fiedlers Kunsttheorie, zu der ich auch noch die Doktorarbeit des Berliner
Malers Hermann Konnerth aufstöberte. Selbstverständlich kam dann noch Adolf von
Hildebrandts "Problem der Form" dazu. Im Kunstgeschichtsseminar hielt
ich ein längeres Referat über die Kunsttheorien des Mardeskreises.
Für meine Tätigkeit als Kunsterzieher konnte ich davon
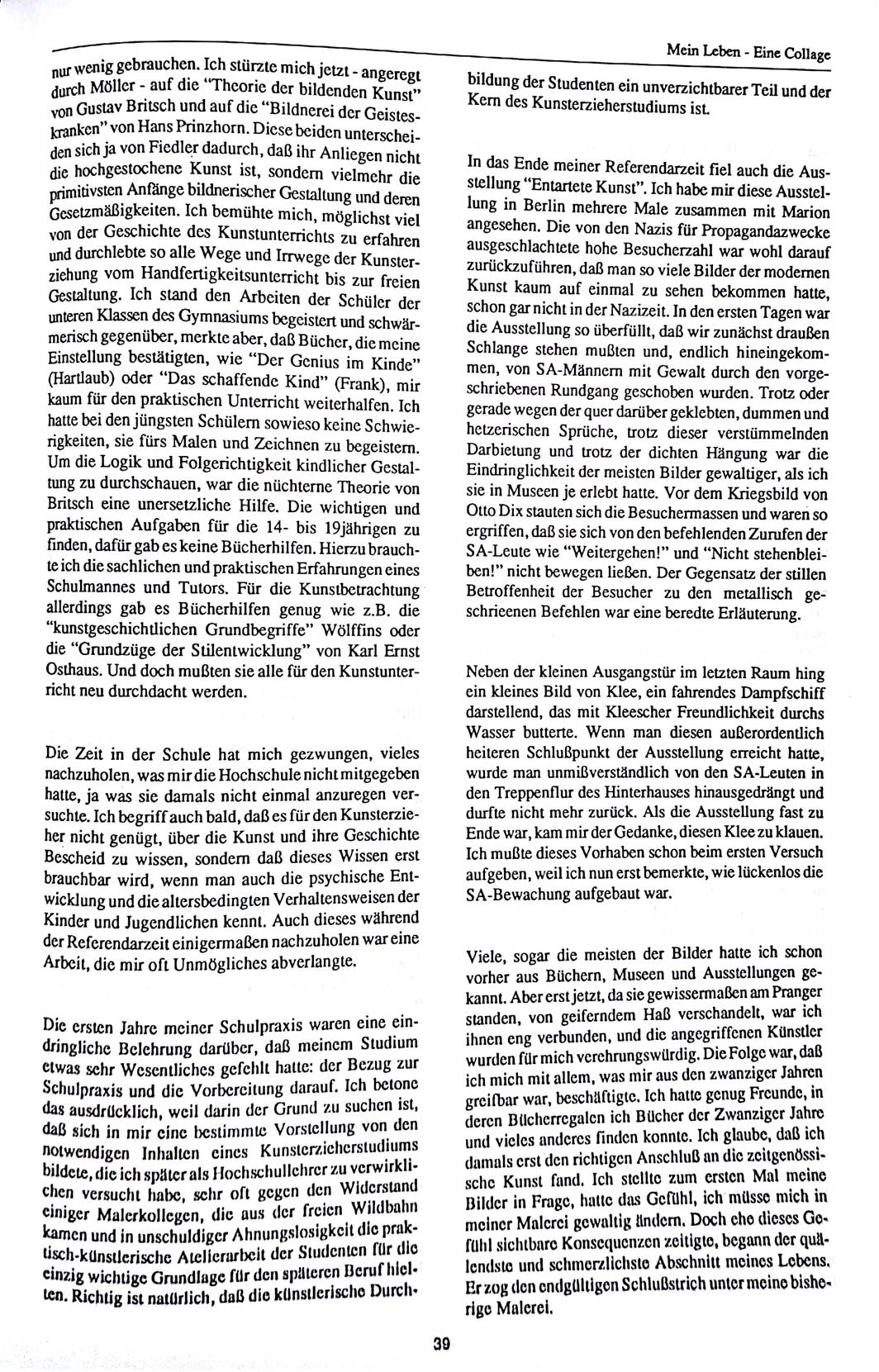
Krieg und Gefangenschaft
Zum 1. April 1940 wurde
ich eingezogen. Ich kam zur berittenen schweren Artillerie, wurde in Küstrin und
in dem kleinen Dorf Bouy in der Nähe von Chalons sur Marne in Frankreich
ausgebildet und überstand dann vom ersten bis zum letzten Tage den
Rußlandfeldzug.
Die Ausbildung mit ihren
schweren Strapazen, mit den gefühlsrohen und in Soldatenstolz aufgeblähten
Vorgesetzten, mit deren unflätigen, meist beleidigenden, dabei entsetzlich
dummen und stereotypen Redensarten, das meistens sinnlose Hin- und Herhetzen
auf dem Kasernenhof, das alles war für mich bisher eine unvorstellbare Welt
menschlichen Zusammenlebens gewesen. Die grausame Wirklichkeit, mit der ich
konfrontiert wurde, gab mir viel zu denken. Hatte das alles einen Sinn? Ich
merkte bald, daß es einen Zweck hatte: den eigenen Willen des Neulings zu
brechen, um ihn den Befehlen des Vorgesetzten und der Kriegsmaschinerie
Untertan, hörig zu machen. Die andauernden körperlichen Strapazen, die bis zum
Schmerz gesteigert wurden, die mechanischen Exerzierbewegungen und -Übungen
ohne und mit Kriegsgerät, die hauptsächlich mit Drill und kaum etwas mit Einübung
von Kriegstechniken zu tun hatten, bewirkten im Laufe weniger Wochen zu meiner
großen Verwunderung einen Solidaritätseffekt unter den Rekruten, den man so
leichthin als Kameradschaft zu bezeichnen sich gewöhnt hat, ein aus der
gemeinsamen Machtlosigkeit und dem gemeinsamen Geschundensein erwachsenes
Zusammengehörigkeitsgefühl, das einen für jedermann hilfsbereit machte, weil
man selbst andauernd des Zuspruchs und der tätigen Hilfe des anderen
bedurfte.
Die vielen Erlebnisse, mit
denen mich der Krieg konfrontierte, will ich nur aufzählen: die Trennung von
meiner Frau, deren letzte Besuche in Küstrin, die endgültige Trennung, die
Isolierung von allen bisherigen Lebensinhalten, die sinnlosen Saufereien der
Soldaten und besonders der Unteroffiziere und auch der Offiziere, die Weite
der russischen Landschaft, die hinreißende Schönheit und quälende Grausamkeit
des russischen Winters mit seiner wahnsinnigen Kälte und seinen entnervenden
Schneestürmen, meine Sympathie mit den russischen Bauern, die mich an das
Heimatdorf meines Vaters erinnerten, der Rückzug im ersten Rußlandwinter mit
den den Weg säumenden Leichen, Pferdekadavern und stehengelassenen Fahrzeugen,
die Leiden der hin- und herflüchtenden Bevölkerung, die brennenden Dörfer, die
Kämpfe und Stoßtruppunternehmen, die Brückenkopfkämpfe mit ihren Trommelfeuern,
die Tieffliegerangriffe, die drei armseligen Urlaube, die ich in dieser Zeit
hatte, mit dem schmerzvollen Wahr- scheinlich-für-immer-Abschiednehmen, die
unerfahrenen Offiziere mit ihren Kriegsgerichtsdrohungen, wenn man sie auf
unsinnige, menschenverschleißende Befehle aufmerksam machte, - all diese
Erlebnisse dieses wahnsinnigen Krieges haben mich wesentlich verändert. Keine
Wandlung in meinem Leben läßt sich damit vergleichen.
Ich verzichte bewußt
darauf, Kampfhandlungen und meine vielen damit verbundenen Erlebnisse zu schildern.
Zu leicht kommt der Erzähler von Kriegserlebnissen in den Verdacht, daß er
sich als Held aufspielen möchte. Ich habe in diesem Krieg kein Heldentum
wahrnehmen können. Junge Männer waren oft unbekümmert, leichtsinnig und
fahrlässig, manche auch abgestumpft und gleichgültig. Wenn alles gut ging,
sahen sie hinterher, an ihrem Erfolg gemessen, wie Helden aus und wurden
dekoriert. Andere wieder führten auf Befehl Himmelfahrtskommandos durch in dem
Bewußtsein, daß eine Weigerung ein Kriegsgerichtsverfahren mit tödlichem
Ausgang zur Folge haben würde. Wieviele bei solchen Kommandos das Leben lassen
mußten, war hinterher an keinem Ritterkreuz abzulesen. Ich habe den Krieg in
seinen schrecklichsten Einzelheiten kennengelernt, besonders in meinen zahlreichen
Einsätzen als vorgeschobener Beobachter bei der Infanterie, und wurde zweimal
verwundet. Oft habe ich mich gewundert, daß ich noch am Leben war, während mein
Nebenmann sterben mußte. Ich halte jedoch diese fünf Jahre, genauso wie die
folgenden drei Jahre Gefangenschaft, für verzichtbar. Denn sie haben mir
nichts eingebracht außer einem gewissen Pessimismus hinsichtlich der
Entwicklung der Menschen, den man auch Hoffnungslosigkeit nennen könnte.
Wie oft habe ich in den
Bedrohungen des Krieges gedacht, daß er vielleicht endlich die Überzeugung
bringen könnte, daß Krieg zur Austragung oder zur Klärung zwischenstaatlicher
Streitigkeiten ungeeignet ist. Diese Hoffnung kann ich heute nur noch mit
meiner damaligen jugendlichen Unbefangenheit und meinem damaligen
unverbesserlichen Optimismus erklären. Heute kann ich nicht mehr daran glauben.
Was ist aus der UNO geworden? Sie war für mich eine ganz große Hoffnung. Jetzt bin
ich schon froh darüber, wenn alle noch miteinander sprechen. Aber die Liste
von kriegerischen Ereignissen und widerrechtlichen Landbesetzungen ist lang,
und das Reden hat nur in wenigen, kaum ins Gewicht fallenden Fällen genutzt.
Hoffen wir, daß meine Befürchtung, das Schicksal des Völkerbundes könnte auch
die UNO eines nahen Tages ereilen, nicht eintritt. Handfeste Gründe für diese
Hoffnung sind nicht vorhanden. Kein Mensch sollte sich darüber wundern, daß in
meinen Bildern keine heile Welt gespiegelt wird. Denn sie existiert nicht, und
ich glaube auch nicht mehr daran, daß es sie je geben könnte.
Zwei Erlebnisse will ich aber doch hervorheben. 1944 bekam ich zum
dritten und letzten Mal Urlaub. Ich hatte inzwischen in Rußland eine große
Anzahl Aquarelle
Mein Leben - Eine Collage
gemacht und wollte sie jemandem zeigen. Meine jüngeren Freunde waren
alle nicht verfügbar oder schon gefallen, die älteren wegen der Bombenangriffe aus
Berlin geflüchtet. Ich war so naiv, nach mir bekannten Künstlernamen im
Berliner Telefonbuch zu forschen und fand den Namen Erich Heckel. Mein Anruf
verlief positiv. Heckel bestellte mich zu sich. Erwartungsvoll suchte ich ihn
mit meinen Aquarellen auf. Er führte mich in einen Raum, in dem kein Bild hing.
Ich fing an zu ahnen, was nun kommen würde. Ich täuschte mich nicht. Er sah
sich meine Arbeiten an, sagte, sie seien sehr schön, ich brauchte keine Hilfe,
ich solle einfach so weitermalen. Ein Gespräch kam nicht zustande, weil er sehr
einsilbig blieb. Als ich von meinem Bedauern sprach, daß ich kein Bild von ihm
an den Wänden sah, sagte er nur kurz, er male nicht mehr. Ich sagte ihm
deutlich, was ich von Hitlers Kunstpolitik und vom Malverbot hielt. Er blieb
dabei, er male nicht mehr und habe auch keine Bilder mehr von früher. Ich
begriff. Er kannte mich nicht und mußte vorsichtig sein. Es blieb mir nur noch
übrig, mich zu verabschieden. Ich ärgerte mich ob meiner Unbefangenheit. Es tat
mir auch leid, daß ich ihn beunruhigt hatte.
Während eines wochenlangen Stellungskampfes entwickelte sich eine
Freundschaft zu einem Zwanzigjährigen. Wir lebten in einem kleinen Bunker und
teilten uns die Scherenfernrohrwache rund um die Uhr. Er war ein Dichter.
Seinen Namen habe ich vergessen. Er schrieb unentwegt an seiner Lyrik, konnte
noch Tage später das, was er geschrieben hatte, aus dem Gedächtnis hersagen.
Wir richteten uns gegenseitig auf in unserem eintönigen, hoffnungslosen Leben
im Graben und im Unterstand und fanden immer genug Gesprächsstoff. Durch unser
Gleichgestimmtsein und gegenseitiges Verständnis fühlten wir uns bald heimisch
in unserem engen Rattenloch. In einer sehr ruhigen Nacht - meine Wachzeit war
abgelaufen - ging ich durch das kurze Grabenstück in unseren Bunker zurück und
weckte den anderen. Er schlief tief auf unser einzigen Pritsche und war kaum
wachzukriegen. In diesem Augenblick deckte uns der Russe mit Trommelfeuer ein.
Ich sagte zu meinem Freund, er solle ruhig liegen bleiben, ging wieder hinaus
und kroch zum Scherenfernrohr. Nach zehn Minuten war die Nacht wieder so ruhig
wie vorher, und ich wartete nun auf die Ablösung; aber mein Freund kam nicht.
Im Bunker fand ich ihn tot auf der Pritsche liegen. Eine Granate hatte den
Grabenrand getroffen, ein Splitter hatte das winzige Fenster durchschlagen und
war meinem Freund in die Brust gedrungen. Das weitere war, wie immer im Kriege,
wenig pietätvoll. Ein Infanterist half mir im Morgengrauen, den Toten aus dem
Bunker zu tragen und ihn über den Grabenrand zu wälzen. In der nächsten Nacht
nahm unser Verpflegungswagen den Leichnam mit zum Troß.
Mehrere Tage nach
Kriegsende - die Truppe hatte sich schon aufgelöst - geriet ich in der
Tschechoslowakei in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Nach drei Wochen im Freien auf dem Flugplatz in Deutsch-Brod ging es im
Fußmarsch bei großer Hitze nach Preßburg, wo wir mit einer handbetriebenen
Schafschurmaschine kahlgeschoren wurden. Auf dem Marsch schössen uns die
sowjetischen Wachmannschaften mit Warnschüssen die Brunnen und Pumpen frei,
weil die tschechische Bevölkerung uns mit allen möglichen Mitteln und mit
Waffen in der Hand am Trinken hindern wollte. Die Verpflegung unterwegs bestand
hauptsächlich aus Wehrmachtskonserven, einer Art Erbsenpüree in Pulverform,
und aus Kartoffeln, die auf Anordnung der Wachmannschaft aus den am Wege
liegenden Kartoffelmieten entnommen und bei der Mittagsrast in Wäldern
gekocht wurden. Von Preßburg ging es mit der Bahn in Viehwagen nach Focsani in
Rumänien in ein Lager, in dem ich einen Totentanz erlebte, der mir schlimmer
als der Krieg vorkam, weil ich Muße zum Beobachten hatte. Hunderte von
Gefangenen starben an der Ruhr. Ihre Leichen wurden auf zweirädrigen Bauernkarren
mit Menschenkraft abgefahren, während die noch Lebenden an kleinen Feuern
hockten und mit ernsten, teilnahmslosen Gesichtern Eichenrinde kochten, um den
Gerbsäuresud zu trinken. "Gut gegen Ruhr", sagen sie. Von Focsani
fuhren wir nach Constanza am Schwarzen Meer, wo uns der sowjetische Lagerkommandant
zur Marschmusik einer Zigeunerkapelle jeden Abend im Stechschritt und mit
angelegten Kriegsauszeichnungen - sonst war es verboten, sie zu tragen - an
sich vorbeimarschieren ließ. Dann ging es nach Odessa auf einem großen
Passagierdampfer, der gefährlich überladen war. MitFußtritten und Gewehrkolben
Stößen wurden wir bis in die letzten Ecken des Schiffes zusammengepfercht Ich
landete unten im Kiel des Schiffes in einem Laderaum, in dessen glühender Hitze
wir wie halbtote Fische nach Luft schnappten und uns die schweißdurchnäßten
Kleider vom Leibe rissen. Die Massenlatrine war auf dem obersten Deck
eingerichtet, die Fäkalien wurden auf Rutschbahnen aus Brettern schräg über
die unteren Decks ins Meer geleitet. In Odessa wurden wir wiederum wie eine
geliebte Herde wertvoller Tiere in ein schönes, trockenes Lagerhaus am Hafen
gesperrt, wurden bei Tage an den Sandstrand geleitet und durften stundenlang im
Meer baden und in der Sonne liegen.
Von Odessa gelangten wir nach einer endlos langen Bahnfahrt nach Mordwinien
(500 km südostwärts von Moskau) und wurden in einem Massenlager untergebracht,
das in ein Hauptlager und zehn Nebenlager gegliedert war, wovon jedes etwa 2000
Gefangene beherbergte.
Inzwischen war schon ein Vierteljahr seit Kriegsende vergangen. Unser Lager,
ein Nebenlager, stand in einem riesigen Wald- und Sumpfgebiet, das von Nachtigallen
wimmelte, deren liebliches Quietschen und
Helmut Thoma
Zwitschern, Pfeifen, Flöten und Schluchzen keineswegs unser trostloses
Dasein versüßte. Es lag dicht an einem Verbanntendorf mit etwa 25 Panjehütten,
durch das ein eingleisiger Bahnstrang führte, der auch gleichzeitig die
Dorfstraße darstellte. Das Dorf hieß auf Russisch RB AC (sprich Jawas). Mit
den Verbannten kamen wir in Berührung, wenn der eine oder andere von uns mit
einem Posten wegen irgendeiner Besorgung in der Bahn zum Hauptlager fahren
mußte. Unser Lager war rechteckig angelegt und von einem inneren Stacheldrahtzaun
und einem äußeren vier Meter hohen Palisadenzaun begrenzt, zwischen denen ein
sogenannter Todesstreifen mit immer frisch geharktem Sand lag. An den Ecken des
Palisadenzaunes standen Wachttürme. Diese Lager waren gut geführt, die
Verpflegung war gut und regelmäßig, aber für größere Menschen nicht ausreichend.
In unserem Lager wurde das Holz der umliegenden Wälder verarbeitet. Wir
besaßen Werkstätten für Tischler-, Böttcher-, Holzschuhmacher-, Stellmacher-
und Drechslerarbeiten, ein Sägewerk, eine Leim- kocherei und eine
Holztrocknerei. Den elektrischen Strom lieferte ein alter Traktor.
In den großen Wohnbaracken , in denen wir auf
zweistöckigen Pritschen saßen und schliefen, herrschte ein bestialischer
Gestank. Die Unterkünfte waren so verwanzt, daß viele der Gefangenen erst nach
mehreren Monaten richtig schlafen konnten, als wir gegen diese Insekten immun
geworden waren. Die Wanzen fielen uns manchmal beim Essen von der Decke in die
Suppe. Und wenn am Abend nach dem Essenfassen das Licht ausfiel, löffelte man
sich diese stinkenden Biester, die genau wie ihr Geruch schmeckten, in den
Mund. Nichts wurde dagegen unternommen, weil es aussichtslos war, denn die
Baracken waren aus Holz. Läuse hatten wir nicht. Wir waren alle gegen
Fleckfieber geimpft. Wenn bei Gesundheitsbesichtigungen eine Laus gefunden wurde,
wurde die gesamte Belegschaft einschließlich Wachmannschaft in der folgenden
Nacht durch die Sauna gehetzt. Wir besaßen auch ein eigenes, etwa 80 Betten
fassendes Lazarett.
Noch lange Zeit nach meiner Heimkehr waren mir Menschenansammlungen in
geschlossenen Räumen zuwider. Im Theater, im Kino oder im Flugzeug konnte mir
unbehaglich, sogar übel werden, weil mich meine Erinnerung, angeregt durch die
Anwesenheit vieler Menschen, in die eklig stinkenden Gefangenenbarak- ken
zurückversetzte.
Als wir für die Lagerwerkstätten eingeteilt wurden, entschied ich mich
für die Drechslerbrigade. Wir fingen mit Holzschalen an. Die verwendeten
Birkenstämme waren frisch und feucht. Die Drehspäne zischten bis zu zwei Meter
hoch. Das dabei sprühende Birkenwasser durchnäßte unsere Kleidung bis auf die
Haut - ein unangenehmer Nebeneffekt in den kalten Wintern. Zuerst hatten wir
etwa eine Woche Zeit, um uns einzuarbeiten, darauf wurde eine Norm festgesetzt.
Sie betrug zunächst fünf Schalen (ca. 10 cm Höhe und 15 cm Durchmesser) am
Tag. Sowie diese Norm von uns mühelos und regelmäßig erreicht wurde, setzte man
die Norm höher. Nach eineinhalb Jahren drehte jeder von uns 15 Stückan einem
Tag. Das Erreichen der Norm bedeutete, daß wir am nächsten Tag eine Prämie von
200 Gramm Brot zu der normalen Verpflegungsration bekamen. Aber: Wer 15 Schalen
drehen wollte, mußte wegen des frischen und ästigen Holzes mit 20 bis 40
Prozent Ausschuß rechnen. Wir mußten also 20 bis 25 Stück pro Tag drehen. Die
fertigen Schalen wurden von anderen Gefangenen, die im Trockenraum arbeiteten,
in Tonschlick getaucht und zum Trocknen aufgestellt. Dadurch, daß das Holz die
Feuchtigkeit zunächst an die dünne Tonschicht und nicht direkt an die Luft
abgab, wurde das Reißen der Schalen vermieden. Die trockenen Schalen wurden in
Leinöl getaucht, bis sich das Holz damit gesättigt hatte, und dann in größerer
Hitze so lange getrocknet, bis sich das Leinöl zu einem wasserundurchlässigen
Lack verfestigt hatte.
Die Produktion von Holzsohlen, Wagenrädern, Fässern und Schemeln
(wohlgemerkt: alles aus noch feuchtem oder nicht normal ausgetrocknetem Holz
hergestellt) nahm gigantische Ausmaße an. Die Wagenräder und Schemel wurden in
Kellern untergebracht, die anderen Gegenstände wurden zu hohen Quadern im
Freien aufgeschichtet und mit Planen provisorisch zugedeckt. Als dann eines
Tages ein Güterzug vorfuhr und alles eingeladen wurde, zeigte sich, daß die
Holzsohlen schon Schimmel angesetzt und in den unteren Lagen sogar verfault
waren und daß die Räder und Schemel sehr vorsichtig transportiert werden
mußten, damit sie nicht auseinanderfielen, bevor sie im Waggon landeten. Wir
haben nicht daran gezweifelt, daß die von uns geleistete Arbeit kaum noch einen
Dreck wert war. Die kleinen Arbeiten der Drechsler allerdings, die Holzschalen
und Schachfiguren, waren verwendungsfähig. Wenn ich im Zusammenhang damit daran
denke, mit wieviel Mühe und Arbeit z.B. die Arbeitsvorgänge bei der Holzsohlenherstellung
durch selbsterfundene große Hebelmessermaschinen und Fließbandarbeit rationalisiert
worden waren, mit welchem Ernst dies alles mit russischen Technikern
besprochen und geplant worden war, kann ich heute diese Arbeit der Gefangenen
nur noch als Folge einer geistlosen Beschäftigungstaktik verstehen.
Immerhin hat diese sinnlose Arbeit doch bewirkt, daß wir nicht untätig im
Lager herumsaßen. Beschäftigungslos in Gefangenschaft zu sein ist
wahrscheinlich schlimmer als sinnlos zu arbeiten. Wir haben das gemerkt, als
der Russe am Anfang noch nichts Rechtes mit uns anzufangen wußte. Wir hatten
damals zur Selbsthilfe gegriffen, organisierten die vorhandenen Möglichkeiten,
um mehrere Vorträge über die verschiedensten Gebiete am Tage hören zu können.
Dies lief aber nur
Mein Leben - Eine Collage
zwei Wochen, dann wurden die Ansammlungen, wie der Russe das nannte,
verboten und durch die Wachmannschaften auseinandergetrieben, wenn sich einmal
zufällig 10 oder 15 Mann zusammenfanden. Eine Zeitlang
wurden Trupps von 15 Mann mit nur einem Posten in den Wald zum Himbeerensammeln
für die Kranken geschickt. Dazu konnten sich die Gefangenen freiwillig melden.
Ich habe das gerne mitgemacht. Allerdings mußte man dabei sehr aufmerksam sein,
damit man sich nicht in den unermeßlichen Wäldern Mordwiniens verirrte.
Einigen ist das passiert. Sie kamen dann meistens halb verhungert nach mehreren
Tagen in einem anderen Lager an, von wo sie dann zu unserem Lager zurückgebracht
wurden.
Das Hauptlager hatte ein großes Orchester und eine große Theatergruppe.
Mehrmals im Jahr wurden von diesen eine Oper oder eine Operette oder auch ein
Konzert in unserem Lager aufgeführt. Ich erinnere mich, "La
Traviata", "Die lustige Witwe" und zwei Konzerte mit
Beethovensymphonien erlebt zu haben. Frauenrollen waren natürlich mit Männern
besetzt. Wir besaßen einen primitiven Theatersaal mit Bühne, der auch zum Essen
benutzt werden konnte. Er faßte etwa 500 Personen. Auch Schachmeisterschaften
wurden ausgetragen, immer natürlich an Sonntagen oder nach Feierabend.
Unsere antifaschistische Bibliothek war voller primitiver
Umschulungsschriften, die eigens für die deutschen Gefangenen entwickelt worden
waren. Ich fand sie außergewöhnlich geistlos. Einige Schriften und Bücher von
Marx, Lenin, Engels und Stalin waren in mehreren Exemplaren vorhanden. Ich fand
auch Romane von Zola. Andersen-Nexö war mit seinen Werken anscheinend
lückenlos vertreten.
Der Stumpfsinn konnte trotzdem nicht ausbleiben. Schlimmer wurde es für mich,
als ich mit einem zerquetschten linken Zeigefinger ins Lazarett kam. Als ich
vom deutschen Ambulanzarzt ins Lazarett geschickt wurde, war der Finger dick
geschwollen und vereitert. Die Fingerkuppe wurde mit einer Nagelschere aufgeschnitten
und der Nagel mit einer kleinen Flachzange entfernt. Betäubungsmittel gab es
nicht. Der oberste Fingerknochen faulte später heraus. Das einzige Heilmittel
war Seifenwasser, Medikamente waren Mangelware. Einige Leidensgenossen starben
nur deswegen. Mein Lazarettaufenthalt dauerte etwa ein Vierteljahr. Auch eine
Ruhrepidemie erlebte ich dort. Sie wurde aber gemeistert, weil rechtzeitig
Medikamente eintrafen. Der deutsche Ambulanzarzt verschwand eines Tages, weil
sich herausstellte, daß er gar kein Arzt war, sondern dies nur vorgegeben
hatte, um nicht arbeiten zu müssen. Was ihm passiert ist, weiß ich nicht.
Das Lager betrieb auch Landwirtschaft. Dafür wurden im Frühjahr und im
Herbst viele Gefangene von den Handwerkerbrigaden für die Feldarbeit
abkommandiert. Im Herbst trugen wir mit Rucksäcken Kartoffeln, Krautköpfe und
Mohrrüben in die bunkerartigen Keller des Lagers. Die Wege gingen durch
sumpfige und morastige Stellen. Mit Wagen war es unmöglich durchzukommen. Es
war uns sehr angenehm, zu diesen Trägerkolonnen abkommandiert zu werden. Man
konnte sich während der Märsche unbemerkt mit frischen Feldfrüchten
vollfressen. Wir stopften alles, was wir runterkriegten, in uns hinein, auch
rohe Kartoffeln. Etwas ins Lager zu schmuggeln war unmöglich, weil wir am Lagertor
abgetastet wurden wie heutzutage vor jedem Flug.
Die Drechslerbrigade, der ich angehörte, hatte einen großartigen
Brigadier. Ich habe heute noch Verbindung zu ihm; wir sehen uns fast in jedem
Jahr einmal. Er war ein einfacher Mann, der seinen Verstand am richtigen Platz
hatte. Er war sehr praktisch veranlagt, wußte mit jedem Werkzeug umzugehen und
konnte sehr schnell und sicher arbeiten. Außerdem war er sehr findig. Als eines
Tages Kartoffeln einen ganzen Tag lang von Waggons an unserer Werkstattür vorbei
in die Keller getragen wurden und die Träger mit den vollen bzw. mit den leeren
Säcken einige Male schon hin- und hergependelt waren, holte er sich einen ihm
bekannten Träger herein, steckte ihm einige Zigaretten zu, nahm ihm den Sack ab
und ging selbst Kartoffeln holen, nicht ohne mich vorher genau informiert zu
haben. Als er mit dem vollen Sack in unsere Werkstatt zurückkam, hob ich mit
einer Axt zwei Dielenbretter unserer Werkstatt hoch, und er schüttete seine
Last in die Öffnung. Der niedrige Hohlraum unter den Brettern war zum Keller
geworden, in dem nach kurzer Zeit etwa drei Zentner Kartoffeln lagen. Diese
Kartoffeln zu kochen war allerdings gefährlich. Wer dabei erwischt wurde,
wanderte drei Tage in Arrest bei 300 Gramm Brot und Wasser. Wir rieben daher
die Kartoffeln mit Hilfe selbstgefertigter Reiben in unsere Eßgeschirre und
ließen uns die heißen Suppen beim Essenempfang daraufgießen, wodurch wir einen
dicken Pamps erzielten, der herrlich sättigte.
Unser Brigadier - sein Vorname war Wilhelm - besaß eine gehörige Portion
Zivilcourage. Er hatte öfter kleine Plänkeleien mit dem russischen Technika-
unseres Lagers, der die Arbeit der Gefangenen in den Werkstätten überwachte und
in Begleitung eines Dolmetschers täglich kontrollierte. Wir nannten ihn
Potschemu (Akzent auf der letzten Silbe, auf Deutsch: Warum), weil er jede
Kritik mit diesem russischen Wort eröffnete. Eine Tages hatte er an unserer
Produktion besonders viel auszusetzen und hatte schon mehrere Male
Potschemu-Sätze gesprochen, die reichlich aggressiv klangen. Das war unserem
Wilhelm plötzlich zuviel. Er nahm - wir hatten gerade Holzschalen gedreht -
eine Schale nach der anderen, schleuderte sie einzeln mit immer wiederholtem
Potschemu dem Techniker vor die Füße, daß sie
Helmut Thoma
schließlich sämtlich zerbrochen auf dem Fußboden lagen. Potschemu war
währenddessen Schritt für Schritt rückwärts gegangen, drehte, da er Wilhelm
ohne Munition sah, sich schnell um und verließ mit dem Dolmetscher den Raum,
während Wilhelm noch seine Werkzeuge hinterherfeuerte.
Wir mußten natürlich an diesem Abend auf die 200 Gramm Brot verzichten,
die wir für die Erfüllung der Arbeitsnorm hätten bekommen können. Glücklicherweise
ist unserem Wilhelm nichts passiert wegen seines Ausfalles. Immerhin hatte er
sich eine nicht gerade geringfügig zu nennende Disziplinlosigkeit geleistet und
durch die Zerstörung der Tagesproduktion seiner Brigade Sabotage begangen. Aber
es geschah nichts. Potschemu war also anscheinend ein grundgütiger Mensch. Wir
konnten ihm seither unsere Achtung nicht mehr versagen.
Im Winter 1946/47 wurde ich mit 200 anderen Gefangenen nach Kaluga
verlegt. Wir sollten dort so etwas wie eine Autofabrik aufbauen. Wir wurden bei
30 Grad Kälte in einem leeren Betonschuppen untergebracht und bekamen sechs
Wochen Zeit, um ihn wohnlich einzurichten. Das schien zunächst unmöglich, aber
es wurde geschafft. Die darauf folgende Arbeit war sehr verschiedenartig und
nicht so stumpfsinnig wie die im vorherigen Lager. Aber unsere Verpflegung, die
sowieso meist verspätet kam, wurde zum Teil vom Lagerkommandanten an die
Bevölkerung von Kaluga verschoben. Wir haben dadurch oft mehrere Tage nichts
zu essen gehabt, nachdem der Koch schon Tage vorher das noch Vorhandene zu strecken
versucht hatte. Einige Male gelang es mir, erfrorene Kartoffeln zu klauen und
in den Hosenbeinen ins Lager zu schmuggeln. Sie waren schon matschig und
stanken nach Alkohol. Gekocht schmeckten sie mir trotzdem. Außerdem verkaufte
uns der Kommandant nach Arbeitsschluß an Privatleute, die immer schon am
Lagertor warteten. Wir gingen ganz gern mit ihnen, weil sie uns mit dem, was
sie gerade hatten, fütterten. Wir arbeiteten auch in der Gasanstalt. Dadurch
bekamen wir Kohlen zum Heizen unseres Betonschuppens. Soviel wir tragen
konnten, durften wir mitnehmen.
Ich bekam bald Hungerödeme und konnte nicht mehr arbeiten. Eine etwa
sechsköpfige russische Kontrollkommission besuchte eines Tages unser Lager und
stellte innerhalb von drei Tagen die Mißstände ab. Die Wachmannschaft
einschließlich des Kommandanten wurde abgelöst. Die Zustände waren durch Ärzte
eines Kalugaer Krankenhauses aufgedeckt worden, nachdem dort zwei unserer
Leidensgenossen eingeliefert worden waren. Sie hatten einen Fluchtversuch
gemacht, waren wieder ins Lager zurückgebracht worden und von Wachmannschaften
so mit dicken Knüppeln geschlagen worden, daß sie schwere Blutergüsse und
Knochenbrüche davontrugen. Vor der Exekution hatten sie sich nackt ausziehen
müssen. Von da an ging es uns wieder besser, aber wenige Wochen später war die
Autofabrik hergerichtet, und wir wurden im Winter 1947/48in ein Erholungslager
in der Nähe von Moskau gebracht. Dort erholten sich viele sehr schnell und
wurden wieder in Arbeitslager verlegt.
Meine Wasserbeine blieben, so daß man mich in ein Entlassungslager nach
Brest-Litowsk abschob. Dieses Lager war ein Erdbunkerlager. Obgleich wir alle
nicht mehr gesund waren, wurden wir dazu benutzt, die Fracht der aus
Deutschland eintreffenden Güterzüge von der deutschen Normalspur auf die
russische Breitspur umzuladen. Das war natürlich eine schwere Arbeit. Ich
entschloß mich daher, mich bei sich bietender Gelegenheit für eine andere
Arbeit zu melden. Eines Tages wurde beim Morgenappell ein Maler gesucht. Ich
meldete mich zusammen mit vielen anderen. Aber die anderen waren alle
Stubenmaler. Ich blieb übrig und wurde einem Maler aus Berlin-Charlottenburg
zugeteilt, der mir die Arbeit, die vor uns stand, erläuterte. Vor dem
Lagereingang waren zwei Riesentafeln geplant. Die eine sollte ungefähr 24
lebensgroße Brustbilder der bekanntesten und wichtigsten sowjetischen
Generäle, die andere die gleiche Anzahl von Mitgliedern des Obersten Sowjets
zeigen. In der Mitte jeder Tafel sollte Stalin als Ganzfigur überlebensgroß
stehen, einmal als Generalissimus in Generalsuniform, auf der anderen Tafel als
Vorsitzender des Obersten Sowjets in grünem Joppenanzug. Oben sollten die
Tafeln von einem Arrangement aus Fahnen, Lorbeerzweigen, Trompeten, Waffen und
natürlich auch der Weltkugel mit dem Sowjetemblem mit Hammer und Sichel gekrönt
werden.
Wir hatten bald einige Portraits fertig. Sie wurden nach Zeitungs- und
Illustriertenausschnitten gemalt. Der russische Politruk, dem wir unmittelbar
unterstanden, war ein sehr netter Mann. Er besuchte uns fast jeden Tag, um sich
mit uns über alles Mögliche zu unterhalten. Er sprach ein flüssiges, mit
Jiddisch vermischtes Deutsch. Ihm ging unsere Arbeit zu langsam. Als ich ihm
sagte, das ginge nicht schneller, antwortete er: "Größeren Pinsel, schnelleren
Arbeit".
Nach drei Wochen Malerarbeit wurde das Lager nachts geweckt. Feueralarm!
Der Bunker, in dem wir malten, brannte. Mein Kollege und ich, aus Sorge,
unseren körperlich erträglichen Job zu verlieren, wenn unsere Farben
verbrannten, waren sofort zur Stelle. Wir drangen in den verqualmten Bunker
ein, um unsere Farben zu retten. Wir konnten nur auf allen Vieren vorwärts
kommen. Plötzlich wurden wir mit Füßen getreten und zur Tür gewaltsam
hinausbefördert. Stark mitgenommen von dem eingeatmeten Qualm, waren wir
dankbar für die frische Luft und sahen erst jetzt, daß ein Feuer-
Mein Leben - Eine Collage
wehrwagen am Bunker stand.
Nach einigen Minuten kamen auch die mit Gasmasken versehenen Feuerwehrleute heraus.
Sie hatten unsere Farben gerettet. Gott sei Dank! Sie trugen die Farben
allerdings zum Fahrzeug, schlössen sie sorgfältig ein und begannen nun erst in
aller Ruhe mit der Löscharbeit. Die Farben haben wir nicht mehr wiedergesehen.
Wider Erwarten bekamen wir sofort einen neuen Platz für unsere große
Aufgabe, ein leerstehendes kleines Privathaus außerhalb des Lagers, nur 150
Meter vom Lagertor entfernt. Neue Farben wurden von den auf dem Bahnhof
arbeitenden Leidensgenossen in Gasmaskenbüchsen in großer Menge mitgebracht,
aber wahllos: Ölfarben, Lackfarben, Spiritusfarben, Beizen, Pulverfarben,
Metallfarben usw. Für die dortigen Ansprüche kamen wir gut damit aus. Zu dieser
Zeit etwa erhielten wir einen neuen, einen sehr geschickten, technisch
versierten und liebenswerten Kollegen zugeteilt, Professor Blasius Spreng aus
Nürnberg.
Uns drei Malern ging es gut Die sowjetischen Wachmannschaften entdeckten
bald unsere Fähigkeiten. Sie bestellten bei uns lebensgroße Portraits
(Schulterstük- ke) nach Fotos von ihren Freundinnen und Bräuten, die sie seit
Kriegsbeginn nicht mehr wiedergesehen hatten, ließen uns auf ihre
Zigarettenschachteln auf russisch: "Raucht
Kameraden!" aufmalen. Viele von ihnen hatten Frauen und Kinder im Lager,
wir haben auf etwa zehn Kinderkackstühlchen Blümchen gemalt usw. Alles wurde
von unseren Auftraggebern gewissenhaft und reichlich mit Lebens- und
Genußmitteln bezahlt. Wir bekamen Milch, Fische, Brot, Margarine, Speck, Zigaretten,
ja sogar einmal einen kleinen Ballen Tabakblätter, aus dem Blasius Spreng
ausgezeichnete Zigarren für uns drehte. Diese russischen Soldaten sind in meinem
Leben meine einzigen Kunstmäzene gewesen.
Lager isoliert, wir gaben unsere alte Kleidung ab und wurden, nachdem wir
gebadet und entwest waren, fast nagelneu eingekleidet. Erst einige Tage später
ging der Transport tatsächlich ab, als ich schon nicht mehr an mein Glück
glaubte.
Bei der Reise im Viehwagen bekamen wir gute Verpflegung, unsere
Pritschen hatten Matratzenauflagen. Während der Fahrt durch Polen wurden wir
sehr scharf und lückenlos bewacht. Keiner von uns durfte aussteigen. Erst in
Frankfurt an der Oder stiegen wir nach 5 Tagen Fahrt aus und wurden deutschem
Abwicklungspersonal übergeben. Diese Abwicklung dauerte wieder mehrere Tage,
und wieder fing ich an zu zweifeln. Aber endlich bekamen wir den
Entlassungsschein.
Nach acht Jahren Krieg und Gefangenschaft machte ich wieder eine Reise
als Privatmann. Ich war sehr sauber angezogen: Auf dem Kopf eine russische
Militärmütze mit hochgebundenen Ohrenklappen, am Körper russisches
Militärunterzeug, darüber russische Militärwattekleidung, an den Füßen
amerikanische Militärschnürstiefel, dazu trug ich einen nagelneuen deutschen
Militärmantel mit Koppel und Brotbeutel. Ich kam mir sehr gepflegt und gut
angezogen vor.
Am 25. März 1948 erreichte ich am späten Mittag das Wohnhaus Wolfshagener
Straße 82 in Berlin-Pankow und klingelte schließlich im 1. Stock an der Tür der
Familie Schneider. Der achtjährige Sohn öffnete mir, sah mich mit großen, fast
entsetzten Augen an, ließ die Tür offenstehen, rannte in die Wohnung zurück und
schrie: "Mammi, ein Russe, ein Russe!"
Eines Tages kamen wir im Gespräch
mit unserem Politruk aufgerechte und ungerechte Kriegsführung", wie er es
definierte und wie wir es aus den in allen Lagern angebotenen penetrant
langweiligen Antifa- Schriften auch hinreichend kannten, zu sprechen. Dabei
entschlüpfte mir, weil ich an die gemeinsame Besetzung Polens durch
Deutschland und Rußland bei Beginn des Krieges dachte, eine hämische
Bemerkung, über die ich selbst erschrak. Der Politruk verstand aber den
Unterton nicht, faßte die Bemerkung sehr positiv auf, umarmte mich spontan und
konnte mich nicht genug ob meiner antifaschistischen Einstellung, die ich ja
ohnehin seit 1933 hatte, loben. Ich habe mich gehütet, sein Mißverständnis
aufzuklären. Einige Tage später erfuhr ich, daß ich zum nächsten
Entlassungstransport gehörte. Ich konnte es kaum fassen: Ich sollte frei sein!
Ich wurde mit den anderen
Glücklichen vom übrigen
WEITER?
Heimkehr
Was würde mir der
Lebensabschnitt bringen, der nun beginnen sollte? Er schien mir wie eine weiße
Leinwand, auf der ich ein Bild entwickeln sollte, von dessen Aussehen ich
nicht die geringste Vorstellung hatte. Am 17. August 1947, an meinem
Geburtstag, war Marion an Krebs gestorben. Die Nachricht hatte mich in Kaluga
erreicht. Ich muß damals sehr stumpf gewesen sein, so daß ich die Schwere der
Nachricht gar nicht begriff. Als aber ein paar Stunden später ein
Leidensgenosse, zu dem ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, den Versuch
machte, mir beizustehen und mich zu trösten, brach ich zusammen, meine Beine
versagten mir den Dienst, und ich weinte.
Bei meiner Heimkehr schien
ich mich in besserer seelischer Verfassung zu befinden. Eine Freundin meiner
Frau, Ellen Marie Erika Schneider, geb. Wechselberg, die ich gar nicht kannte,
hatte dafür gesorgt, daß das Atelier in Berlin-Pankow, in dem Marion bis zu
ihrem letzten Krankenhausaufenthalt gewohnt und gearbeitet hatte, frei
geblieben war. Das Wiedersehen mit dem Atelier ging ohne Erschütterung für mich
ab. Als ich aber einige Tage später den Kleiderschrank meiner Frau öffnete und
mir der unvergessene charakteristische Duft ihrer Kleider entgegenkam,
passierte das gleiche wie in Kaluga. Ich brach zusammen. Der erste Besuch des
Grabes meiner Frau verlief dagegen ohne Erschütterung, traurig und still. Ich
begriff, daß das Glück mit Marion, im Bewußtsein dessen ich Krieg und Gefangenschaft
bis zur Todesnachricht seelisch gut überstanden hatte, Vergangenheit war. Ich
bekam aber bald zu spüren, daß hier verstandesmäßiges Begreifen nicht
ausreichte.
Marion hatte bis in die
letzten Tage vor ihrem Tod ein Tagebuch geführt. Sie hatte es schon 1945
begonnen, als ich nicht aus dem Kriege zurückkehrte und sie nicht wußte, ob sie
mich je wiedersehen würde. Dieses Tagebuch wurde mir einige Wochen nach meiner
Heimkehr von Ellen Schneider gebracht. Ich fing sofort an, begierig darin zu
lesen, ich verschlang es beinahe. Aber schon nach einigen Seiten waren die
Erschütterungen, die ich dabei durchmachte, so groß, daß ich immer öfter die
Lektüre unterbrechen mußte. Die Liebe, die mir hier entgegenströmte, die Trauer
um den fernen Lebensgefährten, die große und starke Hoffnung, daß am Ende doch
noch alles gut und wie früher werden könnte, die Verzweiflung, als ihr die
Diagnose Krebs bekannt wurde, schließlich das Sich-fügen in das unvermeidliche
Schicksal und der letzte Hoffnungsschimmer, daß sie mich vielleicht noch kurz
vor ihrem Tode wiedersehen könnte, dann endlich noch der Verzicht auf diese
letzte Hoffnung und der sehnsüchtige Wunsch zu sterben, bevor ich heimkehrte,
damit das strahlende Erinnerungsbild an sie, das ich vom letzten Urlaub in den
Krieg mitgenommen hatte, nicht von dem Anblick der vom Tode Gezeichneten
getrübt werde - all dies breitete das Tagebuch innerhalb weniger Stunden vor
mir aus. Hilflos, voller Schmerz und voller Erschütterungen stand ich in
meinem Pankower Atelier herum und war unfähig, irgendetwas zu tun, um mich
abzulenken. Ich war wohl nie im Leben so betäubt.
Seitdem sind über dreißig
Jahre vergangen, und ich habe in dieser langen Zeit zwar das Tagebuch oft in
der Hand gehabt, aber nicht mehr gewagt, darin zu lesen. Jetzt, da ich mit
meiner Niederschrift beschäftigt bin, habe ich es wieder aufgeschlagen, um das
Datum der ersten Eintragung festzustellen. Die vertrauten Schriftzeichen, die
mich durch die fünf langen Jahre des Krieges ständig begleitet hatten, nahmen
mich sofort gefangen. Aber schon nach einigen Seiten mußte ich aufhören zu
lesen, weil mich die gleiche starke Erschütterung wie bei der ersten Lektüre
wieder lähmte.
1944, in meinem letzten
Urlaub, habe ich Marion zum letztenmal gesehen. 1948 las ich das Tagebuch zum
erstenmal. Heute, mehr als dreißig Jahre später, ist mir eine Distanz zu diesen
Aufzeichnungen immer noch nicht möglich. Ich fürchte, daß ich sie nie wieder
lese, obgleich ich mir wünschte, es einmal in Ruhe und ohne Aufregung tun zu
können. Ich begreife mich dabei selbst nicht.
Ich habe in Marions
Freundin meine zweite Frau gefunden, und die beiden Ehen gleichen sich nach
der langen Zeit in meinem Bewußtsein so, daß ich keinen Unterschied empfinde.
Das geht so weit, daß ich beinahe glaube, nur eine einzige Ehe eingegangen zu
sein. Meine beiden Frauen sind zu einer einzigen Person in meinem Bewußtsein
verschmolzen. Die Existenz und die Kraft des Tagebuches sind jedoch stark und
korrigieren mich. Trotzdem will es mir immer wieder scheinen, als stamme es
aus einem anderen, einem früheren Leben, das ich noch in meiner Erinnerung
habe, das aber mit den letzten Eintragungen des Tagebuches von meinem jetzigen
Leben abgetrennt wurde, jedoch durch geheimnisvolle Fäden, die ich nicht mehr
ganz begreife, mit meinem jetzigen Leben verbunden bleibt. Der Krieg und
Marions Tod haben mein Leben in zwei Teile gerissen. Diese verstandesmäßig
wieder zusammenzufügen, übersteigt anscheinend meine Erinnerungskraft und mein
Vorstellungsvermögen.
Trotz allem stellte sich nach meiner Heimkehr bald eine gewisse
Zufriedenheit ein. Ich war frei und voller Erwartung. Ich war bereit, in einem
Erdloch ein Königreich zu eröffnen. Ich hatte mein Atelier, in dem ich schon
nach drei Tagen zu arbeiten anfing. Ich hatte Marions Freundin, die im gleichen
Haus wie ich wohnte und einen achtjährigen Sohn hatte, jemanden, der mir
Mein Leben - Eine Collage
sofort half, das Äußere meines Lebens in Ordnung zu bringen. Ich besuchte
sogleich meine Tutoren aus der Referendarzeit, Otto Möller und Paul Kuhfuß. Ein
Brief des Direktors einer Reinickendorfer Schule war schon mehrere Wochen vor
meiner Heimkehr angekommen. Ich fand ihn in meinem Atelier und erfuhr, daß die
Studienratsstelle meiner verstorbenen Frau Marion noch vakant sei und für mich
freigehalten werde. Ich spürte, wie mich dieses Angebot verlockte, auf diesem
einfachen Wege - sozusagen von heute auf morgen - für mich geordnete
Verhältnisse zu schaffen. Dagegen gesehen, schien mir der Weg des freien
Künstlers sehr viel beschwerlicher. Was mich dabei erwartete, konnte ich nicht
übersehen, aber ich ahnte, daß ich als Maler vor einer hoffnungslos schwierigen
Aufgabe stehen könnte. Ich hatte acht Jahre nicht mehr intensiv und regelmäßig
künstlerisch gearbeitet. 15 Jahre lang, von 1933 bis 1948, in der Zeit der
Naziherrschaft, des Krieges und der Gefangenschaft, hatten mir Informationen
über die Entwicklung und den Stand der europäischen Kunst nicht mehr zur
Verfügung gestanden. Es war nicht schwer, meinen Riesennachholbedarf zu
erkennen und daraus zu schließen, daß ich viel Zeit dafür brauchen würde. Und
diese Zeit mußte auch finanziell überstanden werden. Sollte ich hierzu die
Studienratsstelle annehmen? Ich wußte jedoch aus Erfahrung, daß die
Erziehungs-, Lehr-, Lern- und Arbeitsvorgänge in der Kunstpädagogik zwar anhand
künstlerischer Phänomene praktiziert werden, im wesentlichen aber doch auf
pädagogische Ziele gerichtet sind. Die Entscheidung für den Schuldienst würde
mich also zwingen, wieder wie vor dem Kriege ein Leben zwischen Kunst und
Pädagogik zu führen, wobei der Pädagogik naturgemäß ein hoher Stellenwert
zugestanden werden mußte. Seit Beginn des Krieges hatten mich solche Gedanken
nicht mehr beschäftigt. Und jetzt, kaum daß ich mein Pankower Atelier wieder
betreten hatte, tauchten sie auf.
Der Gedanke, daß ich mich entscheiden müsse, beunruhigte mich
schließlich. Wichtige Entscheidungen für meine Zukunft hatte ich seit 1940
nicht mehr zu treffen brauchen. Ich war nie so frei gewesen wie jetzt. Krieg
und Gefangenschaft waren beendet, für das weitere Leben lag nichts fest Nur
zwei Möglichkeiten waren zu sehen: Schuldienst oder freier Künstler. So sah also
die Freiheit aus: Je vollkommener die Freiheit, desto zwingender muß man sich
entscheiden, eine Bindung einzugehen. Im Leben gibt es anscheinend keine
absolute Freiheit. Man weiß immer nur, wovon man frei sein möchte. Ich war frei
von den Zwängen des Krieges und der Gefangenschaft. Aber schon unterlag ich
einem neuen Zwang, nämlich zu entscheiden, was ich nun tun sollte. Und wenn ich
mich jetztauch frei entschied, nach meiner Neigung entschied, sah ich schon den
Zwang auf mich zukommen, den gewählten und eingeschlagenen Weg konsequent zu
verfolgen bis zu seinem Ende, bis zu einer Wegegabel oder zu einem Wegekreuz,
wo man wieder die Freiheit und den gleichzeitigen Zwang hat, sich zu
entscheiden. Diesmal wurde mir die Entscheidung beinahe abgenommen. Ich bekam
ein verlockendes Angebot. Ich konnte es nur erleichtert annehmen.
Mein Lehrer aus der Studienzeit, Georg Tappert, war inzwischen an die
frühere Kunstschule Schöneberg zurückgekehrt, hatte sie als Abteilung
Kunstpädagogik an die Hochschule für bildende Künste angeschlossen, fungierte
als Abteilungsleiter und war gleichzeitig stellvertretender Direktor der
Hochschule. Er hörte von meiner Rückkehr durch Möller, der auch inzwischen an
dieser Abteilung als Professor Malen und Zeichnen lehrte. Tappert, der sich
sein Leben lang sehr engagiert um die Kunsterziehung gekümmert hat, suchte
gerade einen Kunsterzieher für einen Zweijahreskursus für Volksschullehrer. Er
bestellte mich zu sich, und wir wurden sofort einig. Ich wurde dann einen Monat
später rückwirkend zum 1. April 1948 im Angestelltenverhältnis eingestellt. Um
Geld brauchte ich mich nicht zu kümmern. Einer meiner Schüler vom
Luisenstädtischen Realgymnasium, der inzwischen ein gutgehendes Antiquitätengeschäft
besaß, besuchte mich kurz nach meiner Rückkehr. Er bot an, mir Geld in
beliebiger Höhe zu leihen oder auch zu schenken. Ein Kriegskamerad, der in
Hamburg eine Brotaufstrichfabrik aufgemacht hatte, erfuhr bei einem
geschäftlichen Besuch in Berlin von meiner Rückkehr, besuchte mich und schenkte
mir eine Riesenbeutel Fischeiweiß, mit dem ich jede
Mahlzeit anreicherte. Innerhalb von drei Wochen waren dadurch meine schweren
dicken Wasserbeine, dieses sehr beunruhigende Mitbringsel aus der sowjetischen
Gefangenschaft, verschwunden. Mein Leben hatte sich beinahe von selbst
normalisiert. Ich kam zur Ruhe.
Ich hatte drei Jahre nicht mehr gemalt. Zuletzt hatte ich während des
letzten Kriegsjahres an einem Weichselbrückenkopf und später in den Beskiden
aquarelliert. Alle Aquarelle, die während des Krieges entstanden, hatte ich zu
Marion geschickt. Meine Briefe waren fast immer mit Zeichnungen versehen. Diese
Briefe und auch die Aquarelle, ebenso alle Arbeiten der Vorkriegszeit, die ich
für gut hielt und in meinem ersten Rußlandurlaub aussortiert hatte, wurden,
als die Fliegerangriffe auf Berlin gefährlich wurden, von Marion zu meinen
Eltern nach Neisse gebracht. Als sich die Front Neisse näherte, brachte meine
Mutter die Arbeiten mit einem Handwagen in ein kleines Dorf. Nachdem die Kriegswalze
Neisse überrollt hatte, wollte meine Mutter die Arbeiten wieder abholen, fand
aber nur noch Reste davon in den Pfützen der regendurchweichten Dorfstraße.
Russische Panzer und Troßkolonnen fuhren darüber weg. Russen hatten Quartier
gemacht und kurzerhand meine Arbeiten aus dem Fenster auf die Straße geworfen.
Ich wunderte mich kaum darüber. Ich hatte noch in den Beskiden gesehen, wie
deutsche Soldaten in einer Dorfkirche die Holzschnitzereien der Ikonostase zerhackt
hatten - zum Feuermachen.
Helmut Thoma
In der Gefangenschaft hatte ich auch erfahren, daß mein Vater gestorben
war. Jetzt erfuhr ich Näheres darüber. Er war am 14.5.1946 gestorben.
Meine Eltern hatten sofort, nachdem die Kriegsereignisse um Neisse
abgeebbt waren, wieder angefangen zu schneidern. Sie hatten alsbald alle Hände
voll zu tun, um aus alt neu zu machen. Ein Jahr nach Kriegsende konnten sie
schon wieder sorgenfrei leben. Ihr einziger Kummer war, daß sie von ihren vier
Söhnen noch kein Lebenszeichen bekommen hatten. Eines Nachts wurden in ihrer
Parterrewohnung mit Äxten die Fensterscheiben und -kreuze zerhauen, und zwei
mit Pistolen bewaffnete, polnisch sprechende Männer drangen in die Wohnung ein,
zerrten meine Eltern aus den Betten, schlugen meine Mutter besinnungslos und
mißhandelten meinen Vater, der sich wehrte, mit Fußtritten, bis er wehrlos
liegenblieb. Dann plünderten sie die Wohnung, luden den mitgebrachten LKW voll
und verschwanden. Kein Mensch weiß, wer die Rowdies waren, keiner war zu Hilfe
gekommen, weil solche Barbareien zur Tagesordnung gehörten und es
lebensgefährlich war, sich einzumischen.
Mein Vater hatte schwere innere Verletzungen an Leber und Galle erlitten.
In seinen Todesphantasien hatte er manchmal die Halluzination, daß seine vier
Söhne aus dem Krieg zurückgekehrt seien und sich in seiner Wohnung befänden.
Sie sollten an sein Bett kommen, wünschte er sich in hellen Momenten. Meine
Mutter hat mir später mehrere Male tränenreich berichtet, wie sie ihn immer
wieder mit der Notlüge, wir seien nur für kurze Zeit in die Stadt gegangen, zu
beruhigen versuchte. Er starb einige Tage nach dem Überfall.
Meine Mutter siedelte 1947 nach Königstein im Taunus über, wo sich meine
Brüder Alfred und Hans bereits niedergelassen hatten. Dort besuchte ich sie
noch einmal. 1950 starb sie an einem Herzschlag. Auch sie hat nicht mehr
erlebt, daß sich das Leben ihrer vier Söhne wieder in geordnete Bahnen fand.
Wenn mir auch nach meiner Heimkehr das Leben sofort wieder lebenswert
schien, in meiner Malerei wirkte sich mein Hochgefühl nicht aus. Ich stand
unter sehr gegensätzlichen Zwängen. Einerseits wollte ich sofort arbeiten und
versuchte, an meine unbefangene Art der Vor- kriesgzeit anzuknüpfen, reiste
nach Hiddensee und auf die Insel Rügen, um mich von Landschaftserlebnissen
anregen zu lassen. Andererseits merkte ich, daß sich nicht nur mein Weltbild
durch die Kriegserlebnisse verändert hatte, sondern daß auch viele
Veränderungen in der zeitgenössischen Kunst, besonders in Frankreich und den
USA, aber auch in Deutschland vorgegangen waren, die ich überhaupt nicht hatte
registrieren können, weil die unsinnige Kunstpolitik der Nazizeit, der
Krieg und die Gefangenschaft jede Einsicht in die in- und ausländische
Kunstentwicklung unterbunden hatten. Ich hatte also vieles nach- und
aufzuholen, was in den letzten 15 Jahren passiert war. Ich mußte dies tun, um
meinen eigenen Standort als Maler zu finden. Ein langer Weg lag vor mir,
länger, als ich ahnen konnte.
Schon in dem kleinen Skizzenbuch, das ich im letzten Jahr der
Gefangenschaft aus zufällig gefundenen Papieren zusammengebastelt hatte und in
dem nur unbedeutende Zeichnungen enthalten sind, sind einige Blätter zu
finden, die meinem früheren so selbstverständlichen, unproblematischen
Verhältnis zur sichtbaren Natur widersprachen. Jetzt, wo ich wieder über
normale Arbeitsbedingungen, ein Atelier und hinreichend Farben und Material
verfügte, wurde die in mir vorgegangene Veränderung in jedem Bild sichtbar. Ich
fing an, den Gegenstandzu zerstückeln und in verschiedenen Aspekten
darzustellen. Der Raum, in dem die Dinge stehen, wurde zugunsten der Fläche
zurückgedrängt Jede Scheinwirklichkeit wurde verbannt. Die Realität des Bildes
wurde mir wichtig. Auch die menschliche Figur, die mich immer sehr interessiert
hat, wurde zerlegt und schließlich nur noch geometrisch-symbolhaft dargestellt.
Sie verfestigte sich schließlich im Zeichenhaften. Die sichtbare Natur war mir
verdächtig geworden.
Sicher hat zu dieser Entwicklung auch eine gewisse Abscheu vor jeder
naturalistischen Einstellung beigetragen, eine Abscheu, die sich in mir
gebildet hatte, als ich in Brest-Litowsk im Gefangenenlager die beiden
Schauwände mit der russischen Generalität und dem Obersten Sowjet zu malen
geholfen hatte. Dort wurde uns ein ganz und gar penetranter Naturalismus abverlangt.
Eine seit 1955 auftretende Wendung zum Malerischen, die schließlich in
Bildern kulminierte, die nur noch aus Farbflecken bestanden, ja sogar
tachistisch wirkten, bahnte eine Entwicklung zu Bildern an, die nur noch von
schriftzeichenartigen Pinselzügen und sehr zurückhaltenden Farben lebten.
Mein Atelier lag in Berlin-Pankow, also im Ostsektor Berlins. Zwei Wochen
nach meiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft nahm ich Verbindung mit dem
Pankower Kunstamt auf. Ich erfuhr dort einiges, z.B. daß eine
Arbeitsgemeinschaft für Aktzeichnen bestand, an der ich sofort teilnahm, daß
jede Woche ein Diskussionsabend stattfand und daß auch Ausstellungen gemacht
wurden. Die Diskussionsabende drehten sich immer um den Sozialistischen
Realismus. Als ich begriffen hatte, was darunter zu verstehen war, beteiligte
ich mich mitEifer an dieser Diskussion, um meinen Teil dazu beizutragen, daß
sich dieser Unsinn nicht allzuweit ausbreitete. Es war mir klar, daß hier
ähnliche
Mein Leben - Eine Collage
Nichtkunst propagiert
wurde wie in der Nazizeit mit der völkischen Blut-und-Boden-Kunst. Ich eckte an
und fand auch viel Zustimmung und sogar einige Freunde. Dann kam die Spaltung Berlins.
Ich hatte schon einige Bilder zustandegebracht und gab sie zu einer Ausstellung
in einer Pankower Schule. Ausstellungsbesucher sollen sich vor meinen Bildern
in die Haare geraten sein bei der Frage, ob man heutzutage überhaupt so malen
dürfe. In den Kunstdiskussionen wehte ein zunehmend schärferer politischer
Wind, und ich wurde zum Reaktionär gestempelt, der gegen den
"Fortschritt" war. Das tat mir weiter nicht weh, aber ich sah, daß
auch hier wieder die Politik die Kunst bestimmte. Nur inhaltlichpolitische
Argumentation war gefragt, formal-gestalte- rische Aspekte schienen nicht zu
existieren, wurden auch gar nicht verstanden. Die Diskussionsleiterin, eine
Altkommunistin namens Gärtner-Scholle, schwadronierte alles nieder, was nicht
in die Parteilinie paßte. Es war das beste, Pankow zu
verlassen. Ich hatte dazu noch einen zweiten Grund, die große Entfernung zur
Abteilung Kunstpädagogik in Berlin-Schöneberg. Ich beschloß umzuziehen.
Aber das war damals keineswegs einfach. Ich brauchte für West-Berlin eine
Zuzugsgenehmigung, die ich auch bekommen konnte, weil ich dort einen
Arbeitsplatz hatte. Aber diese Genehmigungen waren kontingentiert und überhaupt
nicht zu bekommen. In den zuständigen Dienststellen wurde ich gefragt, ob ich
in Ost-Berlin unter politischen Pressionen oder ähnlichem zu leiden hätte. Man
legte Wert darauf, daß möglichst viele solcher Leute wie ich drübenblieben.
Zuzugsgenehmigungen waren vom Nachweis einer Wohnung in West- Berlin abhängig,
eine Wohnung andererseits wurde nur dann zugewiesen, wenn man im Besitz einer
Zuzugsgenehmigung war. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen gelang mir erst,
als ich erfahren hatte, daß man Zuzugsgenehmigungen für zweihundert Mark pro
Stück "kaufen" konnte. Der Umzug ging glatt.
neues Domizil war eine Wohnung in der Regensburger Straße 29 in
Wilmersdorf, die aus einem großen Atelier und drei winzigen Räumen bestand. Für
uns drei begann hier ein neuer Lebensabschnitt. Wir sind sehr schnell zu einer
Familie zusammengewachsen. Und ich kam nun endlich wieder zur Ruhe und fühlte
festen Boden unter den Füßen.
Das Atelier in der
Regensburger Straße ist ausreichend groß mit seinen 38 Quadratmetern, seiner
Höhe von sechs Metern und seinem mehr als 3x4 Meter messenden senkrechten
Fenster. Es liegt im dritten Stockwerk. In ihm führt eine Treppe zur Wohnung im
vierten Stock.
Die Wohnung war zu klein
und zu primitiv. Die drei kleinen Dachräume besaßen nur kleine Dachluken als
Fenster. Ein Badezimmer existierte nicht Die Toilette war in einem primitiven
Verschlag in den angrenzenden Bodenräumen untergebracht, zusammen mit der einzigen
Wasserleitung mit Ausguß. In zwei Räumen und im Atelier standen primitive
Kanonenöfen, die viel Arbeit und Gestank machten.
Wenige Jahre nach unserem Einzug haben wir die Wohnung in die
anschließenden Bodenräume erweitert, so daß jetzt ein weites Wohnzimmer, ein
Bad mit Toilette, eine geräumige Küche, ein ausreichendes Schlafzimmer, eine
Werkstatt, sogar ein sechs Quadratmeter großer Balkon und große, schräge
Dachfenster vorhanden sind. Im Parterre haben wir viel später noch zwei Räume
als Bilderlager hinzumieten können. Sie sind für mein Atelier, das immer
zuzuwachsen droht, eine wohltuende Entlastung. Die Kanonenöfen sind schon lange
abgeschafft. Wir heizen mit Gas. Wir fühlen uns sehr wohl und zufrieden in
dieser Wohnung, und obwohl das Haus keine Fahrstuhl
besitzt, wünschen wir uns keinen Umzug mehr.
Zuvor hatte ich noch einen Entschluß zu fassen, der mir leichtfiel. Zu Ellen
Schneider, der Freundin meiner verstorbenen Frau Marion, hatten sich inzwischen
enge Bindungen ergeben. Aus einer Laune heraus hatte ich sie einmal Cornelia
genannt. Wir sind bei diesem Namen geblieben, so daß viele unserer Freunde
ihren Taufnamen gar nicht kennen. Cornelia also wollte auch nach West-Berlin
mit ihrem Sohn umziehen, auch ich war dafür. Aber sie konnte keine
Zuzugsgenehmigung bekommen, weil sie in West-Berlin keine Arbeitsstelle hatte.
Das einfachste war also, daß wir heirateten; dann konnten wir, sobald ich meine
Zuzugsgenehmigung hatte, zusammen umziehen. Wir
heirateten am 13. September 1950. Am 27. Dezember bekam ich die Genehmigung,
die bis 31. Dezember befristet war. Am Silvestertag zogen wir bei 20 Grad Kälte
um. Am Brandenburger Tor wurden wir nicht einmal kontrolliert, wahrscheinlich
wegen der klirrenden Kälte. Unser
Helmut Thoma
Darm, das sich selbst geöffnet hatte. Nach der Rückkehr nach Berlin
unterzog sich Cornelia einer Operation und konnte sich anschließend rasch
erholen.
Cornelia, meine zweite
Frau, geboren am 7.7.1913 in Rehdorf bei Königsberg in der Neumark, ist
approbierte Apothekerin und hat diesen Beruf bis zu ihrer Arbeitsunfähigkeit
ausgeübt. Bald nach unserem Kennenlernen erzählte sie mir, daß sie von Geburt
an an einer Aortenstenose litte, die nicht operativ beseitigt werden könne, und
unter der sie sehr zu leiden habe. Ihre Lebenserwartung betrage nach Meinung
der Ärzte nur noch wenige Jahre. Die Ärzte wunderten sich darüber, daß sie noch
arbeiten konnte. Auch nach unserem Umzug nach West-Berlin arbeitete sie bald
wieder in einer Apotheke.
Ihr Vater war bis zur
Flucht Verwalter eines großen Gutes in Rehdorf. Cornelia verbrachte ihre
Kindheit in diesem Dorf, wurde zusammen mit ihrem Bruder von einer
Privatlehierin unterrichtet, bis sie 1926 nach Berlin zu Verwandten
übersiedelte, um die höhere Schule und die Universität zu besuchen. Sie war in
erster Ehe mit dem Apotheker Kurt Schneider verheiratet, verbrachte einen
großen Teil der Kriegszeit mit ihrem Sohn Heinz- Jürgen wegen der
Bombenangriffe in ihrem Heimatdorf und hat schließlich die Flucht mit ihrer
Familie und die Einnahme von Berlin überlebt. 1945 starb ihre Mutter an Krebs.
Ihren Vater haben wir 1958 begraben. Ihr Sohn lebt seit 1974 als freier
Schriftsteller mit Frau und Tochter auf Teneriffa. Ihr Bruder ist Landarzt in
Ardorf in Ostfriesland in der Nähe von Aurich.
In den Bombennächten hatte
Cornelia im Luftschutzkeller Marion kennengelernt. Im letzten Kriegsjahr hatte
sich zwischen ihnen eine innige Freundschaft entwickelt. Marion hat während
ihrer langen Krankheit viel Hilfe und seelischen Beistand von Seiten Cornelias
und ihres ersten Mannes erhalten. Die erste Nachricht von Marions Tod erhielt
ich von Cornelia.
1954 erkrankte Cornelia an
einer Sepsis, deren Ursache nicht erkannt wurde. Sie wurde nur dadurch vor dem
Tode gerettet, daß schon das Penicillin entdeckt war. Nach vielen Wochen Krankenhausbehandlung
war sie so geschwächt, daß sie nicht mehr gehen konnte.
1955 hatte sie sich wieder
etwas gekräftigt und äußerte den Wunsch, in irgendeinen südlichen Ort zu
reisen. Unser Hausarzt, den ich um Rat fragte, meinte, ich solle ruhig mit ihr
reisen, es sei vielleicht ihr letzter Wunsch, den ich ihr noch erfüllen könne.
Wir reisten dann im Sommer nach Cres auf die Adria-Insel gleichen Namens, von
der später noch ausführlich zu berichten sein wird, und verlebten dort drei
sehr schöne Monate unter südlicher Sonne am Meer. Dort wurde auch der Grund für
Cornelias Krankheit entdeckt - ein Geschwür im 1960 hatte sich Cornelias
Gesundheitszustand jedoch wegen der Aortenstenose wiederum sehr verschlechtert.
Wir mußten einen Facharzt konsultieren. Unsere Wahl fiel auf Professor Dr. Otto
Bayer, Internist und Chefarzt im Moabiter Krankenhaus, der uns seitdem, also
schon seit 25 Jahren, beide ärztlich betreut, so daß wir mit ihm nahezu
unzertrennlich verbunden sind. Durch seinen Rat, eine Operation vornehmen zu
lassen, hat er Cornelia sicher das Leben gerettet. Die Operation unter der
Herz-Lungen-Maschine wurde 1961 im We- stend-Universitäts-Klinikum von Prof.
Dr. Lindner ausgeführt. Sie war inzwischen möglich geworden, weil die
medizinische Forschung Aortenprothesen aus Kunststoff entwickelt hatte. Nach
dieser Operation trat eine erhebliche Besserung in Cornelias Gesundheitszustand
ein, so daß sie sogar im darauffolgenden Jahr eine Apotheke pachtete und sie
schließlich kaufte. Ihr war dabei die Apotheke weniger wichtig, als daß sie
sich selbst den Beweis erbringen wollte, daß sie wieder voll arbeitsfähig war.
Aber allmählich verschlechterte sich ihr Zustand wieder so erheblich, daß sie
die Apotheke verpachtete und sich 1973 nochmals zu einer Operation entschloß.
Die Untersuchung ergab, daß sich eine ihrer Herzklappen verformt hatte, so daß
diesmal eine Aortenklappenstenose vorlag. Auch diese wurde - unter noch
schwierigeren Umständen - durch eine Operation behoben, die die Professoren
Bücherl und Nassari - wieder im Westend-Universitäts-Klinikum - durchführten.
Cornelia trägt seitdem eine künsüiche Herzklappe und einen Schrittmacher.
1977 waren wir wieder wie
allsommerlich auf der Insel Cres. Eines Tages ging es Cornelia schlecht. Sie
stellte fest, daß der noch ziemlich neue Schrittmacher nicht mehr voll
arbeitete. Er war kaputt. Innerhalb von zwei Stunden hatten wir das Nötigste
ins Auto gepackt und waren eineinhalb Tage später in Berlin im Moabiter
Krankenhaus, wo der Schrittmacher ausgewechselt wurde. Nun trägt sie schon den
vierten, und es ist erstaunlich, wie gut es ihr heute noch geht
Für mich ist Cornelia
immer wieder erstaunlich und bewundernswert. Sie hat viel durchmachen müssen,
aber sie hat immer ein festes Durchstehvermögen bewiesen und einen erstaunlichen
Mut und Instinkt gezeigt, sich in scheinbar aussichtslosen Situationen richtig
zu entscheiden. Dadurch hat sie es mir auch immer leichtgemacht, ihr zu helfen.
Ich habe nie ernsthaft gefürchtet, daß eine ihrer Operationen negativ ausgehen
könnte.
Als ich aus der Gefangenschaft zurückkehrte, war
Mein Leben - Eine Collage
Cornelia 35 Jahre alt. Seitdem sind wieder 35 Jahre vergangen. Eine
lange Zeit, eine lange gemeinsame Zeit. Und das Schönste daran war, daß wir
fast alles gemeinsam tun konnten, wie wir beide meinen. Und da ich hier meinen
Lebenslauf zu beschreiben versuche, muß ich auch deutlich sagen, daß in dieser
langen Zeit mein Leben mit Cornelias Leben so eng verbunden war, daß
rückblickend nichts, gar nichts ohne Cornelia mir vorstellbar ist. Das gilt
sogar für meine Malerei. Gerade meine künstlerische Arbeit verdankt ihr viel.
Ich kann nur arbeiten, wenn mein äußeres Leben in Klarheit, Übersicht und Ruhe
verläuft Cornelias Stetigkeit hat mir da sehr geholfen, ebenso ihr Verständnis,
mit dem sie meine Eigenarten und Schrullen hingenommen, den Haushalt geführt
und auch die häusliche Büroarbeit mir abgenommen hat. Sie kann mit Geld
umgehen, ich nicht. Ich habe in beiden Ehen gespürt, daß es nicht ganz einfach
ist, mit mir zu leben. Schuld daran ist dieses dauernde Doppelleben, das ich
geführt habe. Ich habe immer mit meiner Zeit gegeizt, weil ich nie von der
Malerei gelebt habe, also neben meinem Beruf als Maler immer noch einen
Brotberuf zum Geld verdienen haben mußte. Ich muß freimütig zugeben, daß diese
Brotberufe (Kunsterzieher, Hochschullehrer) nicht unbedingt neben meinen
Neigungen lagen, aber die Zeit für die künstlerische Arbeit schien mir immer zu
knapp zu sein. Das hat sich auch bis heute nicht geändert, wo ich doch jetzt im
Ruhestand von meinem Brotberuf befreit bin und Zeit genug für die Malerei haben
müßte. Aber eben deswegen, weil ich Freizeit im landläufigen Sinne nie gekannt
habe, fällt es mir selbst im Ruhestand schwer, mich auch nur zeitweilig von der
künstlerischen Arbeit zu trennen. Und das kann einen leicht in den Verdacht
bringen, die Arbeit höher zu schätzen als die Gemeinsamkeiten mit den
Mitmenschen. Ich weiß das, kann aber oft nichts dagegen tun. Auch zum Reisen
verspüre ich meistens wenig Lust. Erholungsreisen, wie sie jeder normale Mensch
durchführt, verabscheue ich, und wenn sie schon nötig sind, nehme ich mir meine
Arbeit mit. Cornelia reist gern, sieht gern Museen und Ausgrabungen, wie ich
auch. Aber wenn sie nicht energisch die Initiative ergreift, wäre es nicht zu
solchen gemeinsamen Reisen gekommen, wie nach Paris, nach London, nach Italien,
nach Kreta, nach Sizilien usw., die mir selbstverständlich dann auch viel
Freude machten.
In Marion, meiner ersten Frau, hatte ich eine Lebensgefährtin gefunden,
mit der das Zusammenleben so harmonisch war, daß ich mir nichts Vollkommeneres
vorstellen konnte. Die Erinnerung daran hat mir über Krieg und Gefangenschaft
hinweggeholfen, bis ich 1947 die Todesnachricht erhielt. Meine Abgestumpftheit
zum Zeitpunkt meiner Heimkehr war sicher größer, als ich selbst wahrnehmen
konnte. Wieviel Cornelia mir geholfen hat, meinen physisch und psychisch
desolaten Zustand zu überwinden und wieder festen Boden unter meine Füße zu
bekommen, ist nicht hoch genug anzusetzen. Durch sie scheint die Zäsur, die
mein Leben durch Krieg, Gefangenschaft und Marions Tod erfuhr, so weitgehend
ausgeglichen, daß ich die davor und danach liegende Zeit nicht mehr
unterschiedlich empfinde. Meine erste und meine zweite Frau, Marion und
Cornelia, sind mir zu einer zeitlichen, ja sogar zu einer physischen
Kontinuität zusammengewachsen. Dabei sind sie sehr verschieden, nicht nur vom
Habitus und von ihren Berufen her.
An meiner Arbeit hat Cornelia immer starken Anteil genommen. Sie hat aber
nie den Versuch gemacht, zu zeichnen oder zu malen. Ich wundere mich selbst
darüber, daß ich es nie geschafft habe, sie davon zu überzeugen, daß auch sie
gestalterische Fähigkeiten wie jeder Mensch besitzt. Schließlich habe ich in
meinem Leben vielen Jugendlichen und Erwachsenen über diese Klippe
hinweggeholfen. Aber eines Tages fand Cornelia doch einen Einstieg. Sie hatte
plötzlich den Wunsch, weben zu lernen. Sie lernte es sehr schnell. Sie fand in
meiner Hochschulkollegin Marianne Meyer-Weißgerber eine hilfreiche Mentorin,
die ihr die Technik schnell und sicher beibrachte und ihr eine Übersicht über
die Möglichkeiten der Weberei verschaffte. Nach einiger Zeit des Übens wollte
Cornelia schließlich Bilder weben. Die Entwürfe sollte aber ich machen.
Da ich in meiner Studienzeit in Breslau die Weberei bis zu einem gewissen
Grade erlernt hatte, kenne ich die Schwierigkeiten der Bildweberei, auch ihre
gewisse Fragwürdigkeit. So beneide ich z.B. nicht die Weber, die die Entwürfe
großer Maler sklavisch textiltechnisch kopieren und gleichzeitig vergrößern
müssen. Das ist eine stumpfsinnige Arbeit, die durch das Resultat nicht immer
gerechtfertigt wird. Die Entwürfe sind oft sogar textilfeindlich.
Ich habe mich bemüht, den Entwurf immer unter Berücksichtigung des
webtechnischen Vorgangs zu entwickeln. Das Motiv wurde mit Cornelia gemeinsam
gefunden, indem ich ihre Vorschläge zunächst in flüchtigen Bleistiftskizzen
realisierte, um dann einen davon auch farbig zu entwerfen. Allerdings habe ich
diese farbigen Entwürfe niemals bis zur Endgültigkeit getrieben, sondern sie
im Sinne einer Arbeitsanweisung, eines Planes angefertigt, so daß die Form der
Farbfelder festlag, der Farbton aber weitgehend offenblieb. Nach Fertigstellung
dieser Anweisung - die immer in Originalgröße erfolgte - besprachen wir dann
zusammen die Farbigkeit und suchten die Farbtöne für die einzelnen Felder aus.
Das Material hat Cornelia zusammen mit ihrer Mentorin ausgewählt und
gekauft. Sie hat ein Wollsortiment von insgesamt etwa 100 Farbtönen, mit denen
man gut auskommen kann.
Helmut Thoma
Erstaunlich sind die
Resultate der Arbeitsteilung. Ich kenne meine unbedeutenden Entwürfe nicht
wieder. Die Webereien sind von einer überzeugenden Farbigkeit. Außerdem kommt
schon durch die Gemeinsamkeit der Arbeit eine gewisse andere Mentalität in die
Entwürfe, und ihr Durchgang durch die Hände der Weberin verwandelt sie
vollends.
Auf diese Weise sind wir nun
auch durch einen kleinen Zipfel der Kunst miteinander verbunden, und wir haben
oft eine diebische Freude daran, daß die Webereien vielen unserer Freunde mehr
zusagen als meine Bilder.
1981 hat Cornelia ihre
Apotheke verkauft Für den Erlös erstand sie in San Andres auf Teneriffa ein
Haus. Dort wohnt auch ihr Sohn aus erster Ehe, Heinz-Jürgen Schneider, mit
seiner Frau Elke und der Tochter Anja.
San Andres ist noch ein echter spanischer Ort ohne Tourismus, hat ca.
4000 Einwohner und ist ein originelles Gemisch aus Kleinstadt und Dorf. Es
gehört verwaltungsmäßig zu Santa Cruz, liegt aber sechs Kilometer davon
entfernt am Ausgang zweier Barancos. Es besitzt einen großen Badestrand und
einen kleinen Fischereihafen.
gezeichnet bekommen, obgleich wir im Haus und im Garten viel Arbeit zu
leisten hatten. Besonders auf Cornelia hat sich das Klima gut ausgewirkt. Ich
habe sie noch nie so lange Zeit so beschwerdefrei und gesund erlebt wie auf
Teneriffa. Das ist eine wichtige Feststellung. Sie könnte in einigen Jahren
große Bedeutung bekommen.
Die Insel Teneriffa ist nahezu exotisch, wenn man sie mit Cres
vergleicht. Sie ist auch in einem anderen Sinne anregend als Cres. Der
ausgeglichene Jahresablauf, die geringen Luftdruckschwankungen und die nahezu
immer gleiche Farbigkeit der Landschaft wirken auf uns sehr beruhigend, fast
heilend. Die Anregungen dieser Insel sind infolgedessen vergleichsweise sanft,
nur die sichtbaren Spuren der vulkanischen Vergangenheit, die Berg- und
Gesteinsformationen und die riesigen Lavafelder, strahlen Aggressivität aus.
Wenn der Himmel bewölkt ist, zeigt er oftmals weiße Schönwetterwolken und
dunkle bis schwarze Regenwolken gleichzeitig. Diese für mich neue Welt von
Teneriffa hat sich sofort verändernd auf meine Arbeit ausgewirkt, und ich
zweifle nicht daran, daß auch diese Insel für meine Arbeit fruchtbar werden
kann.
Unser Haus liegt nahezu neben dem Haus unseres Sohnes. Ein Grundstück von
500 Quadratmetern Größe, das uns noch trennte, hat Cornelia ebenfalls gekauft
und unserem Sohn geschenkt. Beide Häuser sind jetzt durch Wege und Treppen
miteinander verbunden. Da unser Haus mit allem Inventar erstanden wurde, haben
wir es verhältnismäßig schnell nach unseren Wünschen verändern können. Von den
Fenstern und von der Terrasse aus können wir das Meer, das Dorf und einen
Baranco mit seinen bizarren Bergzügen sehen. Jeden Morgen und Abend sehen und
hören wir die Ziegenherde durch das Tal zotteln und bimmeln. Früh hört man
viele Hähne krähen. Wir leben tagsüber in einer gedämpften Geräuschkulisse,
bestehend aus Kindergeschrei, Hundegebell, Eselsschreien, Handwerkerlärm,
Verkehrsgeräuschen usw. Dieses Lärmgemisch kann durch seine gewisse
Natürlichkeit als akustischer Ausdruck menschlichen Zusammenlebens
widerspruchslos hingenommen werden. Es stört gar nicht.
Das Haus ist geräumig. Es
besitzt einen großen Wohnraum, eine große Wohnküche, zwei Doppelschlafzimmer,
zwei kleine Zimmer und zwei Toiletten mit Bad und eine große Terrasse. Eines der
kleinen Zimmer habe ich mir als Arbeitsraum eingerichtet. Ich kann gut darin
arbeiten.
Unsere ersten Aufenthalte
in San Andres sind uns aus-
Mein Leben - Eine Collage
Die Insel Cres
Unsere erste Reise nach Cres
im Jahre 1955 sollte - ich berichtete es schon - Cornelias Erholung dienen. Wir
lasen in einem Reiseführer, daß die Insel "trotz ihrer herben Schönheit
nur selten von Fremden besucht wird". Wir ahnten damals nicht, daß diese
Insel einen Teil unseres Lebens bestimmen würde.
Cres machte wirklich den
Eindruck, daß es von Fremden überhaupt nicht beachtet wurde. Jedenfalls schienen
wir die ersten und einzigen Erholungsuchenden zu sein. Noch heute nennen uns
die Einheimischen die ersten Touristen von Cres. Wir wohnten im größten Ort der
Insel, in der Stadt Cres, in einem möblierten Zimmer. Schon in Berlin hatten
wir uns vorgenommen, den ganzen Tag am Meer zu verbringen und am Strand auch zu
kochen. Ganz ungestört waren wir und hatten den kilometerlangen Felsenstrand
mit den Oliventerrassen für uns allein. In der ungewöhnlichen Stille, in der
guten Luft, in der Ungestörtheit erholte sich Cornelia schnell von ihrer
Krankheit, und ich malte viele, viele Aquarelle und merkte bald, daß mich die
fremdartige Insel anregte.
Der Grundcharakter der
Insel ist rauh. Sie besteht aus einem felsigen Bergmassiv, dessen höchste
Erhebung der Sis (638 m) ist. Der Kalkstein, der ja leicht zerfällt, prägt ihr
Erscheinungsbild. Überall stößt man auf rutschige Steinhalden, die sich teils
selbst gebildet haben, teils von den Inselbauern aufgeschüttet wurden, um die
Terrassen für Olivenpflanzungen steinfrei zu bekommen. Auf den Höhen des
Inselmassivs hat sich eine Karstlandschaft gebildet, die nur aus Steinen und
Wacholderbüschen besteht. Dort gibt es größere Erdeinbrüche, die von den
Bauern als Wein-, Gemüse-, Mais-, Getreide- und Kartoffelfelder ausgebaut
worden sind.
Die Pfade von den Dörfern zu diesen Feldern sind lang, steinig und
anstrengend. Alles muß mit Eseln oder Mulis hinauf- und hinuntergetragen
werden. Die Bestellung der Felder erfolgt von Hand mit der Zappa, einer
schweren, breiten Hacke. Der Boden ist meistens trocken und hart wie Beton. Man
kann ihn nur bearbeiten, wenn es mehrere Stunden geregnet hat. Andererseits
ist der mit Bauxit vermischte Lehmboden nach längerer Regenzeit schwer und
klebrig und bleibt an der Zappa hängen. Was nicht Acker ist, ist Weideland oder
Wald. Die unbewaldeten Berghänge sind mit Salbei- und Lavendelsträuchern
bewachsen, die in der Sommerhitze einen belebenden Duft verbreiten. Auch gibt
es große Mengen von Ginsterbüschen, die an günstigen Stellen mehr als 3 m groß
werden können. Während ihrer Blüte sind weite Teile der Landschaft mit großen
gelben Klecksen übersät. Der Wald besteht aus Pinien,
Unterholz und
verschiedenen, zum Teil immergrünen Eichen. Ihr Holz ist außerordentlich schwer
und hart und ist ein hervorragendes, vielbegehrtes Heizmaterial. Die Eichen
werden nicht gefällt, sondern nur ihre Äste werden, wenn sie Oberarmstärke erreicht
haben, abgehauen oder heute auch mit einer Motorhandsäge abgeschnitten und in
etwa 80 cm langen Stücken auf Eseln an die Straße getragen. Die Eichenbäume
bekommen im Laufe der Jahre dicke Stämme und ein ähnliches Aussehen wie bei
uns die Kopfweiden, wirken aber sehr viel gewaltiger und charaktervoller.
Dieses Holz und die Schafzucht sind die Haupteinnahmequellen der Bauern,
während die Landwirtschaft selten mehr als den eigenen Bedarf deckt. Eine
Ausnahme bildet der Wein, der aber auch nur in kleinen Mengen weiterverkauft
wird. In den am Meer gelegenen Orten sind die Bauern gleichzeitig auch Fischer.
Die Strände sind meistens
steil und immer steinig. Flache Strände findet man bei der Stadt Cres und im
südlichen und mittleren Teil der Insel. An diesen Stellen hat sich der
Tourismus seit 1960 sehr störend entwickelt und hat uns dreimal von unserem
Standort vertrieben. Schon im Sommer 1963 kamen so viele Fremde in die Stadt
Cres, daß wir keine Lust mehr verspürten, weiterhin in unserem Privatquartier zu
bleiben. Mit Hilfe unserer jugoslawischen Freunde erreichten wir, daß wir in
einer einsamen, kleinen Bucht zelten durften. Die Bucht trug den Namen
Nedomisce, was so viel wie Nicht-zu-Hause-Bucht bedeutet. Dieser Name soll in
früheren Zeiten entstanden sein, als noch Segelschiffe in dieser windstillen
Bucht ankerten, um das begehrte Eichenholz zu laden, und manchmal tagelang
wegen der gefährlichen Adriastürme liegenbleiben mußten. Nur dreimal zelteten
wir dort und hatten hierfür ein kleines Plastikboot für Versorgungsfahrten
mitgebracht. Die Einsamkeit begeisterte uns, jedoch war das Leben im Zelt zu
primitiv und beengt. Vor allem konnte ich unter diesen Verhältnissen nur kleine
Aquarelle und Zeichnungen machen, ich wollte aber endlich in der unmittelbaren
Beziehung zur Insel auch größere Bilder malen.
Wir wußten bald, daß wir wahrscheinlich jedes Jahr diese Insel aufsuchen
würden. Denn die Anregungen, die ich dort fand, hatten meine Malerei stark
mitgeformt, und die dauernde unmittelbare Berührung mit der unverfälschten
Natur bewirkte schließlich 1964, daß ich den Gegenstand wieder in meine
Arbeiten einbezog. Im gleichen Jahr hatte ich mit Collagen begonnen, die die
menschliche Figur spielerisch zerlegten und die einzelnen Teile wieder
zusammenfügten. Bei diesem Versuch, zu einer anderen Darstellung des Menschen
zu kommen, entstand eine Art Gliederknoten, in dem der Kopf eines Tages wie
von selbst verschwand. Ich versuchte dann im Sinne dieser Collagen Bilder zu
malen und Zeichnungen zu machen. In ihnen verbanden sich die Gliederknoten wie
selbstverständ-
Mein Leben - Eine Collage
mit Wegwerfflaschen den Strand verdreckten. Sogar das kristallklare Meereswasser
hinderte sie nicht, direkt in der Bucht das verbrauchte Motorenöl abzulassen.
Dann wurde 1967 zum ersten Mal in unserer Abwesenheit unser Haus aufgebrochen
und zum Teil demoliert, in den folgenden Jahren ebenfalls. Und jedesmal, wenn
wir hinkamen, fehlte dann nahezu alles, was wir brauchten. Wer die Frage
stellt, warum ich in meinen Bilder keinen heilen Menschen mehr zustande bringe,
kann vielleicht unter vielem anderen auch hier eine gewisse Erklärung finden.
Uns blieb nach drei herrlichen und drei oft schon sehr getrübten Jahren
nur noch die Flucht. Ein Korrespondent der Rijekaer Zeitung Novi List hatte
recht, als er über mich schrieb, vor den Touristen liefe ich weg wie der Teufel
vor dem Weihwasser.
Von Sveti Blaz aus konnten wir die Stadt Cres mit dem Boot in einer
halben Stunde erreichen, zu Fuß brauchte man bis Cres über Stock und Stein, auf
Schafspfaden und nur selten ausgebauten Wegen, auf halber Berghöhe und
parallel zum Strand etwa zweieinhalb Stunden. Das nächste Dorf, Vodice, war
über die Berge in Richtung Osten in ca. zwei Stunden zu Fuß zu erreichen.
Dorthin lud uns jedes Jahr der Hirte Bandera zum Rosenkranzfest am ersten
Sonntag des Oktobers ein.
Bei diesem Fest zeigte uns unser Gastgeber im Jahre 1970 ein Haus, das
ihm von einem nach Amerika ausgewanderten Bauern zu treuen Händen übergeben
worden war. Er durfte es nutzen wie er wollte, wenn es nur erhalten bliebe. Da
er sich immer für unser Haus verantwortlich gefühlt hatte und es ihm sichtlich
unangenehm war, daß dort jedes Jahr eingebrochen wurde, schlug er uns vor,
nach Vodice umzuziehen, zumal sich zwischen ihm und uns ein freundschaftliches
Verhältnis entwickelt hatte. Nach einigen Tagen Bedenkzeit stimmten wir zu.
Die Einbrüche in dem einsamen Sveti Blaz waren wirklich zu einem Problem
geworden, weil jedes Mal bei unserer Ankunft wichtige Dinge, vor allem die
notwendigsten Werkzeuge und die Bettwäsche, fehlten. Außerdem hatte ich mir
1969 bei einem Sturz das linke Handgelenk gebrochen. Dabei hatten wir die
Erfahrung gemacht, daß es im Notfall schwierig werden könnte, Hilfe zu holen.
Zufällig tobte an diesem Tage ein heftiger Scirocco, der eine Fahrt mit unserem
kleinen Boot unmöglich machte. Aber auch bei ruhigem Wetter hätten wir infolge
der gebrochenen Hand das Boot nicht ins Wasser ziehen können. Nachdem mir
Cornelia Hand und Unterarm notdürftig mit einem Keilrahmenschenkel geschient
hatte, mußte ich mich zu der Wanderung nach Cres aufmachen. Ein Motorschaden
der Fähre, die die Insel mit dem Festland verbindet, und andere widrige
Umstände bewirkten, daß mein Handgelenkbruch erst nach dreieinhalb Tagen in
Rijeka ärztlich versorgt werden konnte. Dieses Erlebnis war ein wichtiger
Grund, uns für das Dorf Vodice zu entscheiden, das nahe an der Landstraße liegt
Noch ein vierter Grund kam hinzu. 1968 war in unserer Abwesenheit die
Kapelle des Heiligen Blasius zusammengefallen. Ein kroatischer Bautechniker,
den wir zufällig am Strand kennengelernt hatten, riet uns, unser Haus möglichst
bald zu verlassen. Es könne vielleicht noch Jahrzehnte halten, könne aber auch
sehr bald zusammenfallen, weil es in der gleichen Zeit wie die Kapelle, vor ca.
200 bis 250 Jahren, erbaut worden sei. Der Kalkmörtel habe sich schon zersetzt,
und die unbehauenen Natursteine seien weitgehend ihres Haltes beraubt
Der Umzug wurde im November 1970 von den Hirten zusammen mit unserem
besten jugoslawischen Freund, Professor Nikola Sucic, durchgeführt Professor
Sucic, heute fast 80 Jahre alt, der vor seinem Ruhestand Direktor der Schule in
Cres und Schulinspektor gewesen war, besitzt ein geräumiges Segelboot. Er hat
uns, solange wir ihn kennen, mit einer bewunderungswürdigen und selbstlosen
Hilfsbereitschaft bei vielen Gelegenheiten geholfen. Wir sind ihm zu großem
Dank verpflichtet. Bei Fahrten mit seinem Boot hat er uns die Schönheiten der
Insel gezeigt, die man anders nicht erreichen kann. Auch brachte er uns nach
Sveti Blaz, wenn wir uns aus irgendeinem Grunde nicht selbst versorgen konnten,
alles Nötige, z.B. als ich den Arm gebrochen hatte. Bei starkem Sturm konnte er
nicht anlegen und warf dann die Lebensmittel auf den weißen Felsen, nachdem er
uns durch lautes Rufen auf seine Ankunft aufmerksam gemacht hatte. Beim Umzug
brachte er unsere Habe auf seinem Boot in die Stadt Cres, von wo sie in einem Lastwagen
nach Vodice weiterbefördert wurde.
Nun lebten wir mitten unter Bauern und Hirten. Das Dorf Vodice erhielt
seinen Namen nach einer der wenigen Quellen auf Cres, die unterhalb des Dorfes
noch heute fließt, aber nur noch als Tiertränke benutzt wird (kroatisch: voda =
Wasser, vodice = die Wässerchen). Es liegt in der nördlichen Hälfte der über 70
km langen Insel am Nordosthang des Inselmassivs in ca. 300 m Höhe. Hinter dem
Dorf steigt das sehr steile Gelände bis 543 m hoch. Etwa 7 km nördlich ist die
charakteristische kegelige Bergform des Sis zu sehen. Von unserem Haus schaut
man auf den Kvarner hinab, wie dieser Teil der Adria heißt, genauer gesagt, auf
die Srednja vrata. Die Adria wird hier durch die Inseln Cres und Krk in drei
Teile zerlegt, die Vela vrata, Srednja vrata und Mala vrata heißen (Großes,
Mittleres und Kleines Tor). Von Vodice aus sieht man über die Srednja vrata,
über die Insel Krk und über die Mala vrata hinweg bis zum
Mein Leben - Eine Collage
mit Wegwerfflaschen den Strand verdreckten. Sogar das kristallklare
Meereswasser hinderte sie nicht, direkt in der Bucht das verbrauchte Motorenöl
abzulassen. Dann wurde 1967 zum ersten Mal in unserer Abwesenheit unser Haus
aufgebrochen und zum Teil demoliert, in den folgenden Jahren ebenfalls. Und
jedesmal, wenn wir hinkamen, fehlte dann nahezu alles, was wir brauchten. Wer
die Frage stellt, warum ich in meinen Bilder keinen heilen Menschen mehr
zustande bringe, kann vielleicht unter vielem anderen auch hier eine gewisse
Erklärung finden.
Uns blieb nach drei herrlichen und drei oft schon sehr getrübten Jahren
nur noch die Flucht. Ein Korrespondent der Rijekaer Zeitung Novi List hatte
recht, als er über mich schrieb, vor den Touristen liefe ich weg wie der Teufel
vor dem Weihwasser.
Von Sveti Blaz aus konnten wir die Stadt Cres mit dem Boot in einer
halben Stunde erreichen, zu Fuß brauchte man bis Cres über Stock und Stein, auf
Schafspfaden und nur selten ausgebauten Wegen, auf halber Berghöhe und parallel
zum Strand etwa zweieinhalb Stunden. Das nächste Dorf, Vodice, war über die
Berge in Richtung Osten in ca. zwei Stunden zu Fuß zu erreichen. Dorthin lud
uns jedes Jahr der Hirte Bandera zum Rosenkranzfest am ersten Sonntag des
Oktobers ein.
Bei diesem Fest zeigte uns unser Gastgeber im Jahre 1970 ein Haus, das
ihm von einem nach Amerika ausgewanderten Bauern zu treuen Händen übergeben
worden war. Er durfte es nutzen wie er wollte, wenn es nur erhalten bliebe. Da
er sich immer für unser Haus verantwortlich gefühlt hatte und es ihm sichtlich
unangenehm war, daß dort jedes Jahr eingebrochen wurde, schlug er uns vor,
nach Vodice umzuziehen, zumal sich zwischen ihm und uns ein freundschaftliches
Verhältnis entwickelt hatte. Nach einigen Tagen Bedenkzeit stimmten wir zu.
Die Einbrüche in dem einsamen Sveti Blaz waren wirklich zu einem Problem
geworden, weil jedes Mal bei unserer Ankunft wichtige Dinge, vor allem die
notwendigsten Werkzeuge und die Bettwäsche, fehlten. Außerdem hatte ich mir
1969 bei einem Sturz das linke Handgelenk gebrochen. Dabei hatten wir die
Erfahrung gemacht, daß es im Notfall schwierig werden könnte, Hilfe zu holen.
Zufällig tobte an diesem Tage ein heftiger Scirocco, der eine Fahrt mit unserem
kleinen Boot unmöglich machte. Aber auch bei ruhigem Wetter hätten wir infolge
der gebrochenen Hand das Boot nicht ins Wasser ziehen können. Nachdem mir
Cornelia Hand und Unterarm notdürftig mit einem Keilrahmenschenkel geschient
hatte, mußte ich mich zu der Wanderung nach Cres aufmachen. Ein Motorschaden
der Fähre, die die Insel mit dem Festland verbindet, und andere widrige
Umstände bewirkten, daß mein Handgelenkbruch erst nach dreieinhalb Tagen in
Rijeka ärztlich versorgt werden konnte. Dieses Erlebnis war ein wichtiger
Grund, uns für das Dorf Vodice zu entscheiden, das nahe an der Landstraße liegt
Noch ein vierter Grund kam hinzu. 1968 war in unserer Abwesenheit die
Kapelle des Heiligen Blasius zusammengefallen. Ein kroatischer Bautechniker,
den wir zufällig am Strand kennengelernt hatten, riet uns, unser Haus möglichst
bald zu verlassen. Es könne vielleicht noch Jahrzehnte halten, könne aber auch
sehr bald zusammenfallen, weil es in der gleichen Zeit wie die Kapelle, vor ca.
200 bis 250 Jahren, erbaut worden sei. Der Kalkmörtel habe sich schon zersetzt,
und die unbehauenen Natursteine seien weitgehend ihres Haltes beraubt
Der Umzug wurde im November 1970 von den Hirten zusammen mit unserem
besten jugoslawischen Freund, Professor Nikola Sucic, durchgeführt. Professor
Sucic, heute fast 80 Jahre alt, der vor seinem Ruhestand Direktor der Schule in
Cres und Schulinspektor gewesen war, besitzt ein geräumiges Segelboot. Er hat
uns, solange wir ihn kennen, mit einer bewunderungswürdigen und selbstlosen
Hilfsbereitschaft bei vielen Gelegenheiten geholfen. Wir sind ihm zu großem
Dank verpflichtet. Bei Fahrten mit seinem Boot hat er uns die Schönheiten der
Insel gezeigt, die man anders nicht erreichen kann. Auch brachte er uns nach
Sveti Blaz, wenn wir uns aus irgendeinem Grunde nicht selbst versorgen konnten,
alles Nötige, z.B. als ich den Arm gebrochen hatte. Bei starkem Sturm konnte er
nicht anlegen und warf dann die Lebensmittel auf den weißen Felsen, nachdem er
uns durch lautes Rufen auf seine Ankunft aufmerksam gemacht hatte. Beim Umzug
brachte er unsere Habe auf seinem Boot in die Stadt Cres, von wo sie in einem
Lastwagen nach Vodice weiterbefördert wurde.
Nun lebten wir mitten unter Bauern und Hirten. Das Dorf Vodice erhielt
seinen Namen nach einer der wenigen Quellen auf Cres, die unterhalb des Dorfes
noch heute fließt, aber nur noch als Tiertränke benutzt wird (kroatisch: voda =
Wasser, vodice = die Wässerchen). Es liegt in der nördlichen Hälfte der über 70
km langen Insel am Nordosthang des Inselmassivs in ca. 300 m Höhe. Hinter dem
Dorf steigt das sehr steile Gelände bis 543 m hoch. Etwa 7 km nördlich ist die
charakteristische kegelige Bergform des Sis zu sehen. Von unserem Haus schaut
man auf den Kvarner hinab, wie dieser Teil der Adria heißt, genauer gesagt, auf
die Srednja vrata. Die Adria wird hier durch die Inseln Cres und Krk in drei
Teile zerlegt, die Vela vrata, Srednja vrata und Mala vrata heißen (Großes,
Mittleres und Kleines Tor). Von Vodice aus sieht man über die Srednja vrata,
über die Insel Krk und über die Mala vrata hinweg bis zum
Helmut Thoma
jugoslawischen Festland, ein imposantes Panorama, eine gewaltige, stille,
schöne, manchmal aber auch graue, beinahe furchterregende Inselwelt. Sie kann
sich über Nacht vom blaustrahlenden, wärmedurchströmten südlichen
Landschaftsidyll zu einem tosenden Inferno verwandeln mit jagenden Wolken,
stürmenden Wellen, krachenden Gewittern und prasselnden Regengüssen oder
Hagelschlägen. Aber die Stille überwiegt. Sie ist manchmal so vollkommen, daß
ich sie mit leichtem Erschrecken zur Kenntnis nehme. Ich höre dann das leichte
Sausen der Luft in den Schwingen der Geier, wenn sie zu zweien, vieren oder
sechsen, immer paarweise, über das Dorf segeln.
Das Dorf besteht aus elf Häusern, von denen zur Zeit
drei nicht mehr bewohnt werden. Bei unserem Einzug lebten hier 32 Menschen, von
denen sechs im schulpflichtigen Alter waren. Schon 1982 war die Einwohnerzahl
durch Abwanderung und Todesfälle auf 25 zurückgegangen. Hiervon sind sechs über
70 Jahre alt Das Dorf stirbt also langsam aus, wie alle diese Dörfer der Insel,
in denen sich kein Tourismus entwickeln kann. Kein Wunder! Die Bauern- und
Hirtenarbeit ist sehr schwer und bringt wenig ein. Die seit 25 Jahren erfolgte
verkehrstechnische Erschließung der Insel, Radio, Fernsehen und nicht zuletzt
der Tourismus haben ihre Wirkung getan.
Die Bauern sind katholisch, aber nicht frömmelnd, gehen jeden Sonn- und
Feiertag pünktlich zur Messe, was meistens einen Fußmarsch von zehn bis zwölf
Kilometern einschließt. Das Dorf selbst hat eine sehr kleine Kapelle, in der
aber nur dreimal im Jahr eine Messe gelesen wird. Der Friedhof und eine größere
Kirche liegen fünf Kilometer entfernt in dem Nachbardorf Predoscica. Jeder
Tote von Vodice bekommt dort ein feierliches Requiem. Die Gräber werden von den
Bauern selbst geschaufelt, und am Ende der Trauerzeremonien ziehen sich zwei
Männer die Jacken aus, um mit der Zappa die Arbeit des Totengräbers zu
verrichten. Polternd knallen die lehmigen Erdklumpen inmitten der
Trauergemeinde auf den Sargdeckel.
Jetzt sind wir schon seit Jahren in das Dorf integriert. Das geht so
weit, daß uns von mehreren Familien angeboten wurde, uns gegebenenfalls in
ihrer Familiengrabstätte beerdigen zu lassen. Wenn wir in Vodice eintreffen,
werden wir von jedem mit Bruderkuß begrüßt, genauso, wenn wir wieder abreisen.
Als wir einzogen, war die Stichstraße, die die Landstraße mit dem Dorf
verbindet, noch so schmal, daß nur Lastesel sie passieren konnten. Mit Autos
kam man nicht durch, so daß wir unsere Lebensmittel ähnlich wie in Sveti Blaz
etwa 250 m weit, von der Straße zum Dorf, bei ansteigendem Weg hinauftragen
mußten. Wir äußerten, daß wir dies eines Tages nicht mehr würden leisten können
und daß wir uns daher wieder ein anderes
Domizil suchen müßten. Als wir das nächste Mal wiederkamen, hatten die
Bauern in unserer Abwesenheit eine der den Weg begrenzenden Steinmauern um
einen Meter nach außen versetzt, eine Riesenarbeit, die wir ihnen niemals
hätten zumuten mögen. Diese Geste der Verbundenheit hat uns das Dorf noch
sympathischer gemacht.
Unser Haus bestehtaus vier Räumen und einer winzigen Küche. Durch eigene
Arbeit und mit Hilfe von Handwerkern haben wir es so hergerichtet, daß man
bequem darin leben kann. Wir haben zwei große Terrassen - eine haben wir überdachen
lassen -, auf denen sich der größte Teil unseres Lebens abspielt. Wir haben ein
Badezimmer einbauen lassen und pumpten das Zisternenwasser mit einer
Benzinmotorpumpe in einen Betonbottich auf dem Dach, so daß wir fließendes
Wasser hatten. Gekocht, gekühlt, geheizt und beleuchtet wurde mit Butangas.
Im Laufe der Jahre haben wir die winzigen Gärten neben dem Haus für Blumen und
Küchenkräuter hergerichtet und die Terrassen mit Blumenkästen versehen, so daß
wir wie in einer regelrechten Blumenwanne sitzen.
Das Dorf wirkt manchmal wie ausgestorben. Trotzdem erleben wir fast
hautnah die Gezeiten des bäuerlichen Lebens. Wir erleben die Freuden und die
Kümmemisse der Bauern, ihre Sorge um das Wetter, um die Tiere und um die Ernte.
Nur an Sonn- und Feiertagen wird die Stille durchbrochen. Freunde und Verwandte
kommen ins Dorf, mit denen gegessen, getrunken, gespielt und gesungen wird. Oft
wird dann auch nach dem Essen mit großem Palaver und Riesengeschrei genau vor
unserem Haus Boccia gespielt, wo ein kleiner Wendeplatz für Autos eingerichtet
ist. An diesen Tagen kommen die Bauern auch gerne - alleine oder mit ihren
Freunden - für ein kurzes Gespräch bei einem Gläschen Wein oder Slivovica zu
uns, auch um ihrem Besuch unser - wie sie sich ausdrücken - Museum zu zeigen.
Das Dorf ist mir fest ans Herz gewachsen. Offenbar brauche ich es als
eine späte Fortsetzung meiner dörflichen Erlebnisse bei meinen Großeltern in
Oberschlesien, ich brauche den dort noch sichtbaren selbstverständlichen
Zusammenklang von Landschaft, Menschen und Tieren, obgleich mir bewußt ist, daß
diese Form menschlichen Lebens bald ganz verschwinden wird. Die fast
archaischen Verhältnisse in Vodice sind zum Anachronismus geworden.
Es bleibt eine offene Frage, ob ich die Anregungen für meine Malerei
allein aus dieser Inselwelt beziehe. Wahrscheinlicher ist, daß mich auch die
Großstadt Berlin anregt, in der ich ja einen großen Teil meines Lebens
verbringe. Der Gegensatz zwischen beiden und der Dualismus, hart gesagt: die
Schizophrenie, derzu-
Mein Leben - Eine Collage
folge ich gerne in einem primitiven Dorf leben möchte, aber auch nicht
auf das Leben in der Großstadt Berlin verzichten kann, sind wahrscheinlich das fruchtbare
Moment, dem ich meine Bilder verdanke. Es ist eine gewisse Unzufriedenheit mit
dem, was ich habe, und die Einsicht, daß das, dem ich nachtrauere, nicht mehr
möglich ist. Das Nichtwissen, ob ich lieber in der Großstadt oder auf dem Lande
leben möchte, die Unmöglichkeit, mich klar für das Dorf oder für die Großstadt
zu entscheiden, dieses Hin- und Hergerissensein ist sicherlich eine natürliche
Folge des Verlaufes meines Lebens und prägt wahrscheinlich auch meine Bilder.
Diese Niederschrift über
die Insel Cres habe ich bis hierher 1979 geschrieben. 1983, nur vier Jahre
später, hat sich die im vorletzten Absatz angesprochene Ahnung schon fast
erfüllt. Die Insel und auch das Dorf Vodice haben sich in dieser kurzen Zeit
beängstigend schnell verändert.
1980 erreichte die Elektrizität auch Vodice. Wir haben sofort das ganze
Haus von Handwerkern mit dieser "Errungenschaft" ausstatten lassen.
Cornelia hat die Waschmaschine, die Warmwasserboiler, das Bügeleisen, die
Kühlschränke usw. mit Befriedigung benutzt. Auch das Lesen bei gutem Licht vor
dem Schlafengehen ist uns sehr willkommen. Das Blumengießen mit dem Schlauch
ist eine große Erleichterung. Das Haus ist durch die Elektrizität sehr
komfortabel geworden. Die schönen Mond- und Sternennächte auf unseren Terrassen
sind aber verschwunden, seitdem die kleine Dorfstraße und der winzige
Parkplatz dicht an unserem Haus übermäßig hell beleuchtet sind. Nichts ist
vollkommen!
Seit 1970, als wir in
Vodice einzogen, sind neun der ältesten Dörfler gestorben. Die damaligen Kinder
sind jetzt erwachsen, zwei davon haben geheiratet, und in deren drei Kindern
erlebten wir die fünfte Generation des Dorfes. Die Elektrizität hat das
Fernsehen mitgebracht. Die dörfliche Gemeinschaft ist nicht mehr sichtbar.
Abends sitzt keiner mehr zu einem Gespräch vor seinem Haus. Keiner spielt mehr
Boccia. Alle sitzen nach der Arbeit vor dem Fernseher. Und der Autoverkehr
nimmt zu, obgleich im Dorf Verkehr gar nicht möglich ist. Die Dorfstraße ist
nur einspurig und endet auf dem kleinen Wende- und Parkplatz vor unseren
Hausfenstern. Der Platz reicht für vier Wagen. Das Dorf allein bringt es aber
schon auf sieben, wenn ich meinen dazurechne. Unsere Stuben stinken bei jedem
an- oder abfahrenden Auto, denn die Motoren sind fast alle nicht sauber
eingestellt. Wenn sich der Platz noch durch einige Gästewagen verstopft, wird
der Gestank bei dem millimeterweisen Hin- und Herrangieren zum Ärgernis für
uns: Dazu brauchen wir nicht nach Cres zu fahren! Sollen wir schon wieder
flüchten? Wir fühlen, daß wir uns in den vielen Jahren hier eingewurzelt haben.
Wir müssen uns Zeit lassen. Vielleicht gelingt es, uns schmerzlos zu lösen.
Der größte und mächtigste
Veränderer der Insel ist der Tourismus. Genau an der Stelle, wo wir während der
ersten Jahre in Einsamkeit und Stille in nahezu unberührter Natur badeten, ist
ein Touristendorf mit ca. 400 kleinen weißen, rotgedeckten Häusern entstanden.
Diese ziehen sich in einer Bodenwelle vom Strand bis zur Höhe hinauf, und für
die kleinen Boote der Touristen ist sogar ein kleiner Hafen angelegt worden.
Wir geben zu, daß das alles sehr ordentlich gemacht ist und daß es sehr hübsch
aussieht. Wir haben gesehen, daß sich die Menschen dort wohlfühlen. Aber wir
müssen auch feststellen, daß das grandiose Erlebnis von Stille und
unverfälchter Natur dort niemandem mehr geschenkt werden kann. Beim Anblick
dieses Bungalow-Dorfes dachten wir auch an die einsame Bucht von Nedomisce, wo
seit Jahren ein FKK-Strand eingerichtet ist, und an Sveti Blaz, das schon vor
1970 vom Tourismus heimgesucht und verheert wurde.
Seit unseren ersten Cres-Aufenthalten sind fast 30 Jahre vergangen. Es
ist selbstverständlich, daß sich die Insel in so langer Zeit verändern mußte.
Sie ist durch viele gute Straßen und viele Omnibuslinien verkehrstechnisch
erschlossen, sie ist elektrifiziert, sie hat den Tourismus vertausendfacht.
Allen Einwohnern geht es jetzt sehr viel besser als früher. Die Stadt Cres ist
um drei neue Stadtteile gewachsen. Man muß diese Entwicklung begrüßen, sie
zeigt, daß der Wohlstand der Bevölkerung gewachsen ist. Aber der Reiz der
Insel ist unwiederbringlich verblaßt und wird schon bald ganz verschwinden.
Auch wir, Cornelia und ich, haben uns in diesen vielen Jahren verändert.
Auch meine Malerei. An der Art und Weise, wie sie sich besonders in den letzten
beiden Jahren wandelte, ist deutlich zu merken, daß sie sich dem Einfluß der
Insel entzieht. Eine merkwürdige Parallele und eine merkwürdige
Gleichzeitigkeit! Die Quantität des Tourismus - sollte ich vielleicht schreiben
"des Fortschritts"? - hat den Charakter der Insel qualitativ
verändert. Und meine Malerei, die sich so viele Jahre an der herrlichen Natur
dieser Insel orientierte, hat darauf reagiert. Ausgerechnet auf Cres entstanden
meine ersten Zeitgenossenbilder[1]), deren Vorarbeit sich
in Berlin abgespielt und deren Konzeption ich gewissermaßen im Gepäck auf die
Insel mitgebracht hatte. Diese Bilder haben nichts mehr mit Cres zu tun. Sie sind
eher berlinisch. Der nunmehr sichtbar gewordene Wandel in meiner Malerei
beunruhigte mich keineswegs, er erfrischte mich. 1982 und 1983 malte ich an
dem großen Zeitgenossentriptychon an drei verschiedenen Orten. Die beiden
Seitenstücke entstanden in Teneriffa, das Mittelstück malte ich in Berlin,
nachdem ich den Entwurf dafür auf Cres gemacht hatte. Das war für mich das
Helmut Thoma
deutlichste Zeichen dafür,
daß ich mich von Cres vollständig abgenabelt hatte. Das ist gut so. 1983 war
die Insel so von Touristen überschwemmt, daß diejenigen, die keine Unterkunft
gebucht hatten, keinen Schlafplatz mehr fanden. Sogar unser stilles Vodice
wurde dabei entdeckt und hat schon die ersten Touristenübernachtungen hinter
sich. Das wird sicher bald Folgen haben.
Die Touristen scheinen die Insel so, wie sie jetzt ist, zu lieben, ihnen
scheint sie so, wie die Jugoslawen sie für den Tourismus zurechtgemacht haben,
gut zu gefallen. Was ich auf Cres suchte und fand, wird schnell und gründlich
ausradiert. Den allmählichen Verfall bzw. die fortschreitende Zerstörung der
damaligen Inselkonstitution, die mir so viele entscheidende, fruchtbare Erlebnisse
schenkte, mitanzusehen, ist störend und schmerzlich für mich. Dieses Jahr,
1984, werden wir zum letzten Male dort noch zwei Monate leben und arbeiten.
Dann werden wir Abschied nehmen. Für immer.
Die Grunewaldstraße
Die Abteilung Kunstpädagogik der Hochschule für bildende Künste war in
dem gleichen Hause, Grunewaldstraße 2-5, untergebracht wie ihre Vorgängerin,
die damalige Kunstschule Schöneberg, in der ich studiert hatte und in die ich
nach 14 Jahren zurückkehrte. Meine erste Aufgabe in diesem Hause lag außerhalb
der regulären Hochschularbeit. Sie gehörte zur Lehrerweiterbildung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele junge Lehrer durch ein
Kurzverfahren in den Schuldienst gelangt, ohne mit Kunsterziehung in Berührung
gekommen zu sein. Etwa 20 solcher Lehrer sollten im Zeitraum von zwei Jahren,
wobei sie drei Wochentage in der Abteilung Kunstpädagogik und die anderen drei
in ihrer Schule arbeiteten, eine eingehende Kenntnis der Gestaltungsvorgänge
in der Kinderzeichnung und der Ziele des Kunstunterrichtes erhalten, sollten
Einblick finden in die Besonderheiten der modernen Kunst und sollten durch
praktische Arbeit zu eigenen Erlebnissen im Malen, Zeichnen und Werken kommen.
Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 23 und 30 Jahren. Sie waren schon vorher
durch einen Kurzkursus des Instituts für Lehrerfortbildung (bildnerische Erziehung)
in Berlin- Tempelhof gegangen und nach künstlerischer Begabung ausgesucht
worden. Die Arbeit mit ihnen war problemlos und erfolgreich.
Die Fortschritte, die diese Lehrer in kurzer Zeit machten, waren
erstaunlich. Alles, was über die Kinderzeichnung erarbeitet wurde, konnte im
zweiten Teil der Woche in der Schule praktische Anwendung finden. Die dabei
entstandenen Schülerarbeiten konnten in der nächsten Woche analysiert und
kritisiert werden.
Der Zweijahreskursus wurde nur einmal durchgeführt. Er war als
Lehrerweiterbildung einfach zu teuer und hatte zu wenig Breitenwirkung. Man
versuchte es ab 1950 mit Dreiwochenkursen, die ich ebenfalls durchführte.
Natürlich waren drei Wochen zu kurz, um den Teilnehmern ausreichende Kenntnisse
für den Kunstunterricht zu vermitteln. Aber zweierlei war doch zu erreichen:
Erstens nahm jeder eine gewisse Begeisterung für bildnerisches Tun mit,
zweitens hatte jeder gelernt, was man im Kunstunterricht mit Kindern nicht
falsch machen darf. Die Teilnehmer an diesen Dreiwochenkursen waren bis zu 60
Jahre alt.
Für mich war am interessantesten, bei diesen künstlerisch kaum begabten
Leuten zu erleben, daß tatsächlich jeder fähig war, zu zeichnen und zu malen. Es
war lediglich nötig, ihnen plausibel zu machen, daß künstlerische Disziplinen
oft nicht nur von Künstlern, sondern
auch von Laien selbstverständlich praktiziert werden, wie zum Beispiel
der Tanz, die Musik, der Gesang, das Spiel. Jeder kann sprechen, ohne ein
großer Redner zu sein. Jeder kann tanzen, jeder kann malen, zeichnen usw.
Wichtig ist, daß der Betreffende bereit ist, das unter seinen Händen
Entstandene als Ausdrucksmöglichkeit seiner Person anzunehmen. Bildnerische
Tätigkeit ist ursprünglich nicht auf das Produkt Kunst gerichtet, sondern sie
beruht auf einer dem Menschen immanenten Fähigkeit, sich über Gesehenes,
Vorgestelltes, Erlebtes, Phantasiertes bildhaft zu äußern, um es anderen
mitzuteilen. Die anfängliche Scheu der Lehrer war bald überwunden, die
Ähnlichkeit der Lehrerarbeiten mit Kinderarbeiten war oft eklatant, aber auch
starke Ansätze künstlerischer Begabung wurden sichtbar. An Hand der eigenen
Arbeit entwickelte sich wie von selbst Verständnis für moderne Kunst. Die
individuell sehr verschiedenen Gestaltungen der Lehrer zum gleichen Sujet
regten sofort einsichtiges Verhalten gegenüber den subjektivistischen Tendenzen
der heutigen Kunst an. Ähnliche Erfahrungen hatte ich schon früher in der höheren
Schule beim Kunstunterricht gemacht. Sie erfuhren hier eine wichtige Ergänzung.
Ich habe die Arbeit in den Lehrerkursen mit Begeisterung und
Zufriedenheit geleistet. Die Zuneigung, die die Lehrer meiner Person, und die
Lernbegier und die Aufmerksamkeit, die sie meinem Unterricht entgegenbrachten,
habe ich später selten in diesem Ausmaß erlebt. Die Lehrer wußten und begriffen
sofort, daß alles, was ich ihnen darbot, in der Schule verwendbar war. Meine
Tätigkeit war hier nicht die eines Hochschullehrers - dafür war ich ja auch
nicht eingestellt worden -, sondern eher die eines Tutors für das Unterrichtsfach
Kunsterziehung.
Der Zweijahreskurs lief erst ein halbes Jahr, als mir der
Abteilungsleiter Georg Tappert eine Malklasse mit zehn Studenten anvertraute.
Das war überraschend für mich. Es bedeutete, daß ich mich als künstlerischer
Hochschullehrer qualifizieren sollte. Wieder ein halbes.Jahr später bekam ich
den Auftrag, eine zweisemestrige Übung im Handpuppenspiel für die Studenten des
ersten und zweiten Semesters durchzuführen. Ich hatte im Zweijahreskursus mit
den Lehrern ebenfalls Handpuppen gebaut und auch einige Spiele inszeniert und
aufgeführt. Die viele Arbeit war mir willkommen. Sie half mir, Krieg und
Gefangenschaft zu vergessen.
Der Lehrbetrieb in der Abteilung Kunstpädagogik schien sich, seitdem ich
1934 nach meinem Examen dieses Haus verlassen hatte, nicht geändert zu haben.
Viele Lehrerstellen waren noch offen. Auch Tappert schien mir unverändert. Er
war voller neuer Ideen, war aber zunächst einmal vollauf damit beschäftigt, den
Lehrbetrieb im Sinne der noch immer gültigen Verordnungen der Vorkriegszeit
anzukurbeln. Auch die Prüfungsordnung von 1920 war immer noch gültig und mußte
bei Einrichten des Studienbetriebes berücksichtigt werden. An Neuerungen war
zunächst nicht zu denken. In den damaligen Magistratsabteilungen hatte man alle
Hände voll zu tun mit Dingen, die nach dem Kriege dringlicher schienen.
1949 kam durch Tapperts Bemühungen die Sammlung "Mannheimer
Kinderzeichnungen", die in ganz Westdeutschland kreiste, auch in unser
Haus. Tappert bat mich, die Ausstellung aufzubauen. Die altersmäßig bedingte
zeichnerische Entwicklung des Kindes sollte dabei berücksichtigt werden. Die
Sammlung war hierfür gut geeignet. Während diese Ausstellung lief, habe ich
fast jeden Tag Führungen für Lehrer und Studenten durchgeführt, die das
Berliner Schulamt organisiert hatte. Die Kunstpädagogik erfreute sich damals in
Berlin einer hohen Wertschätzung. Auch alle Mitarbeiter der Schulämter nahmen
an einer Führung teil.
1950, zum 70. Geburtstag Tapperts, habe ich mit einer Studentengruppe in
etwa vier Wochen so etwas wie ein Multimediatheater aufgezogen, eine
Stegreifaufführung mit Handpuppen-, Marionetten-, Menschen- und Maskentheater,
mit Schallplatten und Gesang, unter Einbeziehung des Publikums und der
Korridore des Hauses - ein Theater, in dem wir uns über das Haus, seine Lehrer
und Studenten, über das Studium und den angestrebten Beruf mit
selbstentwickelten Texten und Inszenierungen lustig machten.
Meine Arbeit an der Hochschule: die Lehrerkurse, die Malklasse, die
Übungen im Handpuppenspiel und auch solche besonderen Aufgaben, wie die
Mannheimer Ausstellung aufzubauen oder das oben erwähnte Multimediatheater zu
inszenieren, lief mir leicht von der + Hand. Mir kam beglückend zum
Bewußtsein, daß ich in diesem Hause gebraucht wurde, daß ich eine Arbeit
gefunden hatte, die vielfältig und interessant war. Mein Leben hatte wieder
einen Sinn bekommen. Ich stand wieder mitten im Leben. Ich hatte das Gefühl,
daß ich mich richtig entschieden hatte, als ich mich entschloß, Kunsterzieher
zu werden. Alles, was ich in meiner Studien- und Referendarzeit gelernt hatte,
konnte ich gut gebrauchen und verwenden. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir gut
vorstellen, daß es lohnend sein könnte, seine ganze Kraft für die
Kunsterziehung einzusetzen. Ich unterlag da beinahe einem Zwang. Ich dachte
daran, wieviel mir in der Referendarzeit gefehlt hatte und daß sich jetzt die
Gelegenheit bieten würde, daran mitzuarbeiten, das Angebot der Abteilung in
Richtung Lehrerbildung zu erweitern. Ich sprach mit Tappert darüber. Er hatte
recht, als er sagte, zu Neuerungen sei es noch ein langer Weg.
Aber er hatte doch schon
einiges in diesem Sinne verändert. Er hatte für die Studenten Möglichkeiten
geschaffen, in Berliner Schulen zu hospitieren und selbst Unterrichtsversuche
zu machen. Ein Philosoph und ein Erziehungswissenschaftler hatten Lehraufträge
und hielten Vorlesungen und Übungen. Tapperts Aufgeschlossenheit war mir
erstaunlich und bewundernswert. Mit allen meinen Änderungsvorschlägen rannte
ich offene Türen ein. Er war über alle Entwicklungen und Tendenzen in den
Berliner Schulen und Hochschulen informiert. Er hatte viele Verbindungen zum
Schulamt und auch zur Pädagogischen Hochschule. Die neuesten Bestrebungen in
der Lehrerbildung waren ihm geläufig. Aber er hat es nicht mehr miterlebt, daß
die Abteilung schließlich seinen Vorstellungen entsprach. Diese besitzt jetzt
eine Professorenplanstelle für einen Erziehungswissenschaftler und eine für
einen Didaktiker des Kunst- und Werkunterrichts. Auch für das Fach
Werkerziehung konnten die Studienmöglichkeiten verbessert werden. Schließlich
hatten wir auch hier vier Professorenstellen. Dadurch hat sich dieses Fach
immer mehr zu einem künstlerischen Fach entwickelt.
Rückblickend
kann ich sagen, daß sich in der Zeit, die ich an der Abteilung Kunstpädagogik
aktiv mitarbeiten konnte, das Studienangebot enorm verbessert hat. Es
übertrifft jetzt sogar meine Vorstellungen, die ich in meiner Referendarzeit
entwickelt hatte. Insofern könnte ich also sagen, daß ich an einer glücklichen
und erfolgreichen Entwicklung dieser Abteilung beteiligt war. Aber
Lehrerbildung ist mit ihren Inhalten und Einrichtungen von der jeweiligen
Schulwirklichkeit, die weitgehend von Politik und Schulverwaltung geprägt
wird, abhängig. Um ein fiktives und krasses Beispiel zu nennen: Wenn die
Schulfächer Bildende Kunst und Werkerziehung durch Ministerialerlaß aus den
Stundentafeln der Schulen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins
verschwänden, könnte man den Fachbereich 6 (wie die Abteilung Kunstpädagogik
heute in der Hochschule der Künste genannt wird) schließen. Im folgenden will ich auf solche Zusammenhänge noch eingehen,
auch darauf, wie diese in die Abteilung Kunstpädagogik hineinwirkten.
Seit
1920 muß der Kunsterzieher zwei Fächer studieren: Bildende Kunst (auch
Kunsterziehung genannt) und Werken (Werkerziehung). Die Erste Staatsprüfung für
das Künstlerische Lehramt an höheren Schulen führt in die Studienratslaufbahn.
Da in den zwanziger Jahren in den Stundentafeln der höheren Schulen aber das
Werken nicht auftauchte, waren für den Kunsterzieher in vielen Schulen nicht
genügend Unterrichtsstunden vorhanden. Deswegen wurde dem Kunsterzieher noch
ein drittes Fachstudium, und zwar in einem wissenschaftlichen Fach, auferlegt.
Dieses Fach wurde von den Kunsterziehern treffend mit dem Namen Zwangsfach
belegt, weil es in fast allen Fällen neigungs- und begabungsfremd war.
Nach
dem Kriege waren beide Fächer - Bildende Kunst und Werkerziehung - in den
Stundentafeln der Schulen enthalten, zum ersten Mal seit 1920. Mitte der
fünfziger Jahre gelang es uns, unter dem Abteilungsleiter Ernst Fritsch, dem
Nachfolger Tapperts, für Berlin das Zwangsfach abzuschaffen.
Nun
tauchten wieder Bedenken gegen die Praxis des künstlerischen Studiums auf. Seit
1920 wurde das Fach Bildende Kunst nur sechs Semester, das Fach Werken
hinterher oder zwischendurch sogar kursusartig in nur zwei Semestern studiert.
Generell werden aber für die Studienratslaufbahnen zwei Studienfächer mit je
acht Semestern Studium gefordert. Um den Erfolg der Abschaffung des
Zwangsfaches zu erhalten, hat die Abteilung Kunstpädagogik das Studium beider
Fächer auf je acht Semester umgestellt. Außerdem gelang es, dies alles in einem
Zusatz zur bestehenden Prüfungsordnung und im Lehrerbildungsgesetz zu
verankern.
All
dies wurde aber später wieder seiner Wirkung beraubt, als in den Berliner
Schulen die künstlerischen Unterrichtsfächer zugunsten der wissenschaftlichen
immer mehr abgebaut wurden und die Werkerziehung fast ganz verschwand. Das
Zwangsfach wurde von neuem gefordert und besteht heute noch. Auch der Kampf, es
wieder abzuschaffen, ist wieder im Gange.
Parallel
zu diesen "außenpolitischen" Aktivitäten mußte sich natürlich auch
die innere Struktur der beiden Studienfächer ändern.
In
der bestehenden Prüfungsordnung, die sich seit den zwanziger Jahren nicht
geändert hatte, wurde für das Fach Bildende Kunst im praktisch-künstlerischen
Teil der Prüfung stereotyp von jedem Prüfling das gleiche verlangt: Malen,
Aktzeichnen, Tierzeichnen, Sachzeichnen, Tafelzeichnen, Schriftschreiben und
Perspektive, außerdem ein Wahlgebiet, sozusagen ein Leistungsfach, das aber
nur aus den Gebieten der Plastik, der Druckgraphik oder Schrift gewählt werden
konnte. Der Grundgedanke für diese Schematik lag in dem Bestreben, den
Kunsterzieher zu einer gewissen Breite des Studiums und zur künstlerischen
Vertiefung auf vielen Gebieten zu zwingen. Das läuft aber im Endeffekt dem
Wesen der Kunst zuwider und verhindert, daß der Student während des Studiums zu
einer eigenen künstlerischen Leistung in einem Neigungsgebiet findet und dies
auch im Examen zeigen kann. Andererseits muß man aber auch die Notwendigkeit
einsehen, daß dem Kunsterzieher möglichst viele künstlerische Disziplinen
geläufig sein sollten, damit er in seiner späteren Unterrichtspraxis möglichst
alle Schüler ansprechen kann.
Eine bestehende
Prüfungsordnung zu verändern, ist natürlich sehr schwierig. Wir haben viele
Sitzungen und viele Verhandlungen mit dem Landesprüfungsamt und dem Senat
gebraucht, die Änderungen zu erarbeiten und die beteiligten Institutionen von
deren Notwendigkeit zu überzeugen. Jetzt erfährt der Student zwar immer noch
eine gewisse Einengung, andererseits aber auch eine große Freiheit, damit seine
Neigung und seine persönliche Begabung zum Tragen kommen. Der Student
absolviert jetzt in den ersten Semestern ein breites künstlerisches
Grundstudium, das Malen, Zeichnen, Plastik, Schrift und Druckgraphik umfaßt,
und arbeitet in den letzten Semestern ausschließlich in seinem künstlerischen
oder wissenschaftlichen Wahl- oder Leistungsfach, in dem er beim Examen eine
Hausarbeit anfertigt, die auf selbständiger Arbeit fußt und über die er sich
noch in einer mündlichen Prüfung eingehend äußern muß. Das künstlerische
Grundstudium braucht hingegen bei der Prüfung nur durch Testate nachgewiesen
zu werden.
Noch umfangreichere Umstellungen wurden im Studienfach
Werken notwendig. Dieses war seit 1920 auf Handfertigkeit abgestellt. Die
künstlerisch-gestalterischen Impulse waren
hier schon wegen der kursusartigen schnellen Abhaspelung des Studiums in zwei
Semestern
geringfügig.
Die Kunsterzieher hatten nach dem Kriege in den
Schulen aus dem Werken ein gestalterisches Fach entwickelt, in dem sich die
Phantasie der Schüler an verschiedenstem Material betätigen konnte. Sie hatten
die neuen Tendenzen der Vor- und Nachkriegskunst als Impulse und Anregungen
schnell und gründlich im Werkunterricht der Schulen aufgegriffen, als da sind:
Mobiles, Kinetik, Schrottplastiken, serielle Reihungen von Industrieprodukten
und -abfällen, Materialkollagen usw. Diese neuen Tendenzen der Kunst mußten
jetzt endlich anregend und verändernd auch in die Werkstattarbeit unserer
Abteilung einziehen. Tatsächlich war dies, als ich 1948 in der Grunewaldstraße
begann, schon in einigen Werkstätten im Ansatz vorhanden. Wenn die Abteilung
beweisen wollte, daß das Studium im Fach Werken künstlerisch sei, mußte die
künstlerische Gestaltung alle bestehenden Werkstätten (Holz, Papier und Pappe,
Metall, Textil) voll erfassen. Die Werkstät- tenarbeit mußte sich vom rein
handwerklichen Betrieb, von der rein technischen Handfertigkeitsübermittlung
deutlich abheben. Ende der fünfziger Jahre war diese Entwicklung abgeschlossen.
Eine Werkstatt für freies Gestalten in verschiedenen Materialien war hinzugekommen,
und ganz zuletzt konnten wir noch eine Kunststoffwerkstatt und eine Werkstatt
für Spiel und Bühne einrichten. Seither steht das Studienfach Werken gleichberechtigt
als künstlerisches Fach neben dem Fach Bildende Kunst
Die
Studenten absolvieren nun auch in diesem Fach ein breites Grundstudium in
mindestens drei Werkstätten, um dann im letzten Teil des Studiums in einem Wahlfach
in einer Werkstatt an eigenen Gestaltungen zu arbeiten. Auch für die Hausarbeit
in der Ersten Staatsprüfung kann die Aufgabe aus dem Gebiet des Werkens
gestellt werden.
Die Werkstatt für Textiles
Gestalten war besonders glücklich dran, weil seit 1920 Studentinnen, die schon
die Erste Staatsprüfung hinter sich hatten, in einem zweisemestrigen (jetzt
viersemestrigen) Zusatzstudium das Fach Textiles Gestalten (früher Handarbeit)
anstelle des wissenschaftlichen Zwangsfaches studieren konnten. Jetzt steht
diese Möglichkeit auch für männliche Studenten offen.
Die vielen Veränderungen, die die Abteilung
Kunstpädagogik vom Kriegsende bis jetzt durchgemacht hat, gingen natürlich nur
selten glatt über die Bühne. Es ergab sich sehr oft eine hartnäckige Opposition
derer, die die althergebrachte Ordnung aufrechterhalten oder wiederherstellen
wollten. Man sollte dankbar dafür sein, weil man gerade durch die Opposition
gezwungen ist, alles, was man ändern will, von vornherein klar durchzudenken
und stichhaltige Argumente bereitzuhalten. Der Sieg der Argumente ist immer
noch die beste Grundlage, eine Gemeinschaft zusammenzuhalten.
Der Berufswunsch und das Berufsziel der jungen
Menschen, die in der Abteilung Kunstpädagogik studieren, ist klar: Sie wollen
Kunsterzieher werden. Wenigstens müßte man annehmen, daß es so ist. Da aber
diese Studenten nach künstlerischer Begabung ausgesucht sind, studiert auch
hier eine künstlerische Elite. Kein Wunder also, wenn während des Studiums bei
dem einen oder anderen mit zunehmender künstlerischer Potenz der ursprüngliche
Berufswunsch verblaßt und schließlich von der Verlockung, freier Künstler zu
weiden, verdrängt wird. Wenn sich ein solcher Student mir anvertraute, habe ich
ihm immer geraten, zielstrebig das Examen anzusteuern und sich erst danach zu
entscheiden, ob er als freier Künstler oder als Kunsterzieher arbeiten will.
Beides zu sein ist sehr schwer. Ich habe das an mir selbst erfahren.
Die Lehrtätigkeit in den Ateliers,
der Umgang mit jungen und begabten Menschen, ist für mich immer eine reine
Freude gewesen, besonders, wenn nach einigen Semestern die Eigenarten der
verschiedenen Begabungen zum Vorschein kamen. Man ist dann als Lehrer leicht
geneigt, diese Studenten bis ans Ende ihres Studiums bei sich zu behalten. Ob
das richtig ist, habe ich immer bezweifelt. Natürlich ist es einfacher, mit Studenten,
mit denen man schon weitgehend einen
Konsensus hergestellt hat, zu
arbeiten als mit solchen, die man erst noch kennenlernen muß oder deren Entfaltung
noch auf sich warten läßt. Aber es schien mir oft und gerade im Falle einer
großen Begabung und einer zunehmenden Selbstsicherheit des Studenten für dessen
Entwicklung besser, wenn er den Lehrer wechselte, um noch andere Lehrmeinungen
kennenzulernen. Es ist natürlich auch für den Studenten bequem, sich unter dem
Spalier eines einzigen, vielleicht sogar verehrten Künstlers, einzuwurzeln oder
vielleicht sogar ein Ableger des "Meisters" zu sein. Besser finde
ich, wenn der Student erst am Ende seines Studiums, nach gewonnener Einsicht
und Übersicht eine selbständige Entscheidung für seinen künstlerischen
Standort findet. Viele vom Lehrer hochgezüchtete begabte Studenten platschen
nach dem Verlassen der Hochschule zusammen wie Blumen ohne Wasser, weil sie versäumt
haben, sich schon an der Hochschule durch einen Lehrerwechsel selbst in Frage
zu stellen.
Kunst zu
lehren scheint mir noch im Nachhinein fast unmöglich. Eine Lehre, die den
Lernenden direkt so weit bringen kann, daß er Kunst macht, gibt es wohl nicht.
Es gibt nur indirekte Wege. Alle Übungen in den Ateliers wie Malen,
Aktzeichnen, Sachzeichnen, Komposition, Farbenlehre, Druckgraphik usw. usw.
haben zunächst noch gar nichts mit Kunst zu tun, aber sie sind wichtig auf dem
Wege dorthin. Sie sind auch leicht zu lehren. Die eigentliche künstlerische
Lehre kann erst beginnen, wenn der Student an einer Malerei, Zeichnung oder
ähnlichem arbeitet, die aus seiner eigenen Initiative entstanden ist. Man
spricht so leichthin von der Korrektur. Aber Korrektur kann ja höchstens
bedeuten, daß mit ihrer Hilfe, durch Kritik und Ratschläge des Lehrers, es dem
Studenten allmählich gelingt, sein Bild dorthin zu fummeln, wo es der Lehrer
hinhaben will. Solche Atelierarbeit wird auch der Person des Lernenden nicht
gerecht und ist auf die Dauer langweilig und freudlos. Wesentlicher ist es, vom
Studenten Selbständigkeit zu verlangen und ihn dazu anzuregen, eigene
Bildideen zu entwickeln. Der Lernende muß dazu gebracht werden und davon
überzeugt werden, daß es nur Sinn hat zu malen, wenn er eine eigene Motivation
dazu hat, wenn ihn die eigenen Vorstellungen dazu drängen, wenn die Arbeit aus
der - benutzen wir ruhig den hochgestochenen Begriff - eigenen Weltschau oder
Weltanschauung erwächst. Hier liegt der Kern der künstlerischen Lehre. Alles
andere wie handwerkliches Können, Anwendung der künstlerischen
Ausdrucksmittel, Gestaltungsgesetze, Fähigkeit zur Analyse eigener und fremder
Bilder, Sensibilität usw. ist leicht lehrbar und erlernbar und kann durch
Übungen vielfältiger Art entwickelt werden. Aber den Studenten dazu zu führen,
daß er das Erlernte zwar benutzt, aber so verwendet oder verwandelt, daß er
sich in seiner Arbeit selbst manifestiert und wiedererkennt, daß Person und
Werk des Studenten gewissermaßen identisch werden, ist die schwierigste und
vornehmste Aufgabe des Lehrers. Und hierfür gibt es keine Methode.
Hier liegt der Grund, weshalb
man dem künstlerischen Lehrer nur eine beschränkte Zahl von Studenten zumuten
darf. Der Lehrer muß genügend Zeit haben, den persönlichen und geistigen
Kontakt zu seinen Studenten zu entwickeln und zu pflegen. Mehr als zwanzig
sollte man ihm nicht aufbürden. Und in Zeiten, wo der Lehrer durch Ämter der
akademischen Selbstverwaltung behindert ist, sind zwanzig schon zuviel. Ich
bin Jahre hindurch in dieser Lage gewesen. Mir blieb dann nichts anderes übrig,
als gerade meinen begabtesten Schülern zu raten, sich einen anderen Lehrer zu
suchen.
Ich war und
bin noch heute davon überzeugt, daß die Unterrichtsfächer Bildende Kunst und Werken
an den Schulen eine wichtige Erziehungs- und Bildungsfunktion zu erfüllen
haben. Sie entwickeln den jungen Menschen in ganzheitlichen Abläufen, an denen
alle Kräfte des Schülers beteiligt sind: das Tun mit der Hand, das Denken, das
Sehen, das Vorstellungsvermögen, das Erinnerungsvermögen, die Phantasie, das
Gefühl, die Empfindung usw. Sie vermitteln durch die Sichtbarkeit und
Tastbarkeit des Arbeitsergebnisses ein besonders nachhaltiges Erlebnis der
eigenen Leistung. Diese meine Überzeugung, die Erfahrung in den Jahren meiner
Schulpraxis und der dauernde Kontakt mit Kunsterziehern haben mich immer
wieder bestärkt, mich sowohl für die Erhaltung der künstlerischen Schulfächer
wie für die Verbesserung und Vervollkommnung des Studiums der Kunsterzieher
einzusetzen. Um immer rechtzeitig und wirksam auf Bestrebungen in Berlin und im
Bundesgebiet, die künstlerischen Schulfächer einzuschränken oder wegfallen zu
lassen, reagieren zu können, habe ich mich zu vielen Aktivitäten entschließen
müssen, deren Last auf die Dauer unerträglich wurde und die mir die Zeit für
die Hochschultätigkeit und die eigene künstlerische Arbeit einschränkten. Ich
war damals
1. Mitglied des Akademischen Senats (1953 -1965),
2. Leiter der Abteilung
Kunstpädagogik (1958 -1965),
3. Vorsitzender des
Staatlichen Künstlerischen Prüfungsamtes (Fachrichtung Bildende Kunst und
Werkerziehung (1958 - 1970)),
4. Federführendes Mitglied
der Konferenz der Leiter der Abteilungen Kunstpädagogik der Kunsthochschulen
der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (1959 - 1965),
5. Beisitzer im Vorstand des
Kunsterzieherverbandes Berlin,
6.
Mitglied des Lehrerbildungsausschusses Berlin.
Heute sehe ich,
daß die viele zeitverschleißende Arbeit, die ich neben meiner Lehrtätigkeit freiwillig
und gerne geleistet habe, zu einem beträchtlichen Teil umsonst war. Die
künstlerischen Unterrichtsfächer sind heute mehr denn je in ihren Stundenzahlen
reduziert und an den Rand der schulischen Bildung gedrängt. Die Werkerziehung,
die ich, obgleich ich Maler bin, für noch wichtiger als die Kunsterziehung
halte, ist fast ganz aus den Schulen verschwunden. Die unheilvolle Entwicklung
ist zwar in einer Zeit, in der die Ratio regiert, folgerichtig, zeugt jedoch
von größter pädagogischer Kurzsichtigkeit, ja Bedenkenlosigkeit. Sie bekommt
einen besonderen Aspekt, wenn man sich erinnert, daß etwa 1920 Deutschland als
erstes Land Europas dem Kunsterzieher die Studienratslaufbahn eröffnete und
damit die pädagogische Bedeutung der Kunsterziehung hervorhob, daß dadurch
Deutschland gewissermaßen zum klassischen Land der Kunsterziehung wurde. Von
den damaligen Einsichten ist heute in den Kultusministerien nichts mehr zu
spüren. In Berlin und Niedersachsen waren diese Einsichten lange Zeit
vorhanden. Die Kulturhoheit der Länder war eine gewaltige Bremse für alle
Bemühungen, das Bundesgebiet von Berlin aus zu beeinflussen. Auch in der
ständigen Kultusministerkonferenz hat Berlin nie den Ausschlag geben können.
Vielleicht hätte ein starker und fester Zusammenhalt der deutschen
Kunsthochschulen viel für die Kunsterziehung erreichen können. Aber diese
hatten damals noch nicht begriffen, welche wichtige Position in ihrem eigenen
Interesse hier zu verteidigen und zu behaupten war. Die wichtigen
Entscheidungen über die künstlerischen Schulfächer fielen in den Ländern oft
ohne Anhörung von Fachleuten und ohne daß sie von den Kunsthochschulen
bemerkt wurden.
Gesellschaftliche
Entwicklungen scheinen immer konsequent zu verlaufen. Folgerichtig hat die
Überschätzung der industriellen Entwicklung die Überschätzung der
Wissenschaften nach sich gezogen. Das führte einerseits zur Mißachtung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen und gipfelte in der Umweltverschmutzung,
andererseits bewirkte es in der Schulbildung die Überbetonung und Vermehrung
der wissenschaftlichen Unterrichtsfächer und die Mißachtung und Einengung (auch
Beseitigung) der künstlerischen Fächer und leitete so eine Bildungsverödung
ein. Jetzt haben wir die Gefahren der Umweltverschmutzung bitter erfahren und
erkannt und fangen an, ihr entgegenzuwirken. Werden wir nun auch folgerichtig
die Kraft entwickeln, die Bildungsverödung zu erkennen und zu beseitigen? Oder
müssen auch hier erst bittere Erfahrungen uns wach machen?
Heute
erscheinen die vielen Kämpfe und Debatten, die in der Hochschule, speziell in
der Abteilung Kunstpädagogik, innerhalb des Professorenkollegiums oder mit dem
Schulamt oder anderen Stellen des Berliner Senats oder mit der ständigen
Konferenz der Universitätsrektoren oder der Kultusminister geführt wurden, in
neuem Licht. Der desolate psychische Zustand unserer Jugend, ihre Anfälligkeit
für Neurosen und ihre Neigung zum Aussteigen werfen erneut die Frage auf, ob
daran die Überlastung der Schule mit Wissenschaft eine erhebliche Schuld trägt.
Zieht man noch in Betracht, daß der Kampf um die 35-Stunden-Woche womöglich zu
einer Umverteilung der Arbeit führt, daß dadurch die Freizeit der einzelnen
sich bis zur Unerträglichkeit vermehren kann, liegt die Zeit nicht mehr in
weiter Ferne, wo man darüber nachdenken muß, warum die Menschen zu wenig
Phantasie haben, um mit ihrer Freizeit etwas Gescheites anzufangen. Die
Aufgabe, die da auf uns zukommt, wird von der Schule allein nicht mehr gelöst
werden können, auch wenn sie noch so viele Stunden für nichtwissenschaftliche
Fächer zur Verfügung stellen könnte. Man wird dann vor allem auch den Erwachsenen
durch staatliche Maßnahmen helfen müssen, ihre Freizeit mit Sinn zu erfüllen,
damit sie ihnen nicht zur unerträglichen Last wird.
1964 hatte sich
wieder ein Bruch in meiner Malerei angekündigt, eine Veränderung, die
zweifellos das Ende meiner Bemühungen, zu einer gegenstandslosen Malerei zu
kommen, bedeutete. Ohne mein Wollen schlichen sich immer wieder gegenständlich
deutbare Formen ein. Die Frage, ob nun meine Arbeit in eine nachimpressionistische
Bahn einmünden würde oder ob es mir gelingen würde, etwas Neues, mir aber noch
Unbekanntes aus dem Gegenstand zu entwickeln, beschäftigte und beunruhigte
mich. Eine große Portion Neugier war auch beteiligt. Ich befand mich in einem
ähnlichen Zustand wie damals kurz vor meinem Studium. Ich brauchte mehr Zeit
für meine eigene Arbeit. Ich entschloß mich, bei Beendigung der laufenden
Abteilungsleiter-Wahlperiode 1965, nicht mehr zu kandidieren und mich auch von
allen anderen zusätzlichen Aktivitäten zu befreien. Dadurch kam endlich wieder
Ruhe in mein Leben. Ich konnte mich vermehrt um meine Studenten kümmern und
mich meiner Arbeit ungestört hingeben. Das Atelier, in dem ich in der
Grunewaldstraße seit 1958 arbeitete, war das gleiche, das während meines
Studiums Konrad von Kardorff und nach dem Kriege Georg Tappert innehatten.
Schon nach zwei Jahren hatte sich meine Arbeit so weit entwickelt, daß ich
meinen zukünftigen Weg klar vor mir sah.
Fast zur gleichen Zeit, etwa 1967, begann die studentische
Unruhe in der Grunewaldstraße einzuziehen.
Die
studentische Unruhe, die verhältnismäßig spät und zögernd in der Abteilung
Kunstpädagogik auftauchte und den Lehrbetrieb für Jahre behinderte, begann zunächst
nicht vordergründig politisch. Während früher die Studenten sich oft beklagt
hatten, die wissenschaftlichen Studiengebiete wirkten sich behindernd auf den
künstlerischen Teil des Studiums aus, wurde nun plötzlich gegen die
Überbetonung des Künstlerischen lautstark aufbegehrt. Man protestierte gegen
das Gängelband des Meisters, gegen das Vater-Sohn-Verhältnis von Lehrer zu
Schüler. Auch wurde zeitweise eine ausschließliche Ausrichtung des Studiums auf
die spätere Schulpraxis verlangt, was natürlich so in einer Hochschule auch
wieder unmöglich ist. Auch die Forderung nach mehr wissenschaftlichen und
pädagogischen Lehrveranstaltungen wurde vorgebracht. Ich muß gestehen, daß ich
das am allerwenigsten erwartet hatte. Hier artikulierte sich wahrscheinlich
auch ein gewisser Einfluß früherer Studenten, die sich schon im Schuldienst
befanden. Solange es sich um sachliche und fachliche Veränderungen des Studiums
handelte, war es möglich, den Studenten entgegenzukommen.
Ihre
Forderungen bei Stellenneubesetzungen zeigten später aber deutlich eine andere
Stoßrichtung. Man konnte sich nicht mehr des Eindrucks erwehren, daß bei den
von den Studenten zur Berufung vorgeschlagenen Persönlichkeiten wenigerderen
fachliche Qualifikation als ihre politisch-ideologische Haltung den Ausschlag
gegeben hatte. Hier fing die studentische Unruhe an, politisch zu werden. Der
Gipfel war schließlich die Forderung, alles in der Abteilung durch Abstimmung
in der Vollversammlung entscheiden zu lassen, in der jeder Lehrer und jeder
Student eine Stimme haben sollte. Mir ist heute noch schleierhaft, wie diese
Forderung im Lehrerkollegium nach einer langen Diskussion eine Mehrheit Finden
konnte. Natürlich hatte dieser mit unserem Grundgesetz nicht zu vereinbarende
Unsinn keine Chance auf Verwirklichung.
Als ich
1948 in der Grunewaldstraße angefangen hatte, machte ich mir Gedanken über den
Status unserer Hochschule. War sie eine Hochschule oder eine Fachhochschule?
Nach den gesetzlichen Grundlagen war sie eine Fachhochschule. Nur die Abteilung
Kunstpädagogik besaß den Hochschulcharakter im Sinne einer Universität. Sie
war die einzige Abteilung, die von ihren Studenten das Abitur verlangte. Aber
der praktisch- künstlerische Teil des Studiums unterschied sich kaum vom
Atelier- und Werkstattbetrieb der Abteilung Freie Kunst. Zu meinen
Malerkollegen hatte ich in unserer Abteilung ein gutes Verhältnis. Als ich aber
einmal in einer Sitzung äußerte, wir müßten uns abgewöhnen, in unserer
Abteilung einen Ableger der Abteilung Freie Kunst zu sehen, waren einige
richtig böse.
Später, in
einer Senatssitzung Mitte der fünfziger Jahre, rief ich ebenfalls große
Entrüstung hervor, als ich behauptete, unsere Hochschule sei keine Hochschule
und wir würden die Gleichstellung der Kunsthochschulen mit den Universitäten
nie erreichen, solange wir uns nicht um eine Universalität des Kunststudiums
bemühten. Die Studenten aller Abteilungen müßten Kunstgeschichte,
Kunstsoziologie, Psychologie und auch Philosophie obligatorisch studieren,
soweit diese Wissenschaften für die Kunst von Bedeutung seien. Dies müßte dann
auch in Prüfungen nachgewiesen werden, z.B. in der Meisterschülerprüfung. Um
Malerei oder Bildhauerei zu erlernen, genügten zwar Meisterateliers. Aber
spezialistisch ausgebildete, sonst aber ungebildete Künstler seien ein
Anachronismus.
In der
Abteilung Freie Kunst konnten sich damals solche Gedanken nich t durchsetzen
und sind auch heute nur in schwachen Ansätzen vorhanden. In der Abteilung
Kunstpädagogik wurden schon in den fünfziger Jahren neben der Prüfung in
Kunstgeschichte von den Prüflingen Kenntnisse in Erziehungswissenschaften und
pädagogisch relevanten Gebieten der Philosophie, Psychologie und Soziologie
bzw. Einblicke in diese Gebiete verlangt. Die geistige Flexibilität, die die
Studenten dadurch erlangten, hat wahrscheinlich mitgeholfen, daß sich die
künstlerischen Potenzen unter ihnen in den sechziger Jahren (siehe
Großgörschenstraße) in der Berliner Kunstszene gut durchgesetzt haben. Es ist
eben nicht richtig, wenn man junge Menschen, die sich der "Freien
Kunst" verschrieben haben, in den Ateliers geistig isoliert. Künstlerische
Freiheit kann nur in geistiger Beweglichkeit gedeihen.
Daß das obligatorische Studium der freien Künstler breiter
sein müßte und sich nicht auf reine Atelierarbeit beschränken sollte, ist in
den Berufsverbänden bildender Künstler schon erkannt worden, wenn auch nur
indirekt. Besonders der Berliner Verband hat in den siebziger Jahren viel von
sich reden gemacht, als er die Künstlerweiterbildung konzipierte und auch einen
Modellversuch durchsetzte. Sinn und Zweck dieser Künstlerweiterbildung ist,
denjenigen Absolventen der Abteilung Freie Kunst, die von ihrer Kunstproduktion
nicht leben können, eine Qualifikation für ihre Arbeit in gesellschaftlichen
kulturellen Gebieten zu vermitteln. Man hat da an Museumspädagogik, an
Freizeitgestaltung in Sozialeinrichtungen, an kunst- und kulturpädagogische
Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, an Arbeiten mit Bezirkskunstämtern
usw. gedacht. Man hört, daß diese Versuche positiv verlaufen und die nunmehr
mit erweiterter Bildung versehenen freien Künstler in den genannten Bereichen
schon arbeiten. Nun hat die Hochschule der Künste diese Künstlerweiterbildung
nach langem Hin und Her übernommen. Sie ist ja nach ihrer Gründung, die sämtliche
Berliner Kunsthochschulen, Kunstfachschulen und Teile der Pädagogischen
Hochschule zusammenfaßte, heute mit ihren vielen kunst-, kultur- und
sozialpädagogischen Lehrveranstaltungen der geeignete Ort dafür. Die Künstlerweiterbildung
wird nun im Fachbereich 11 (Ästhetische Erziehung, Kunst- und
Kulturwissenschaften) untergebracht sein. Ich fände es richtig, wenn sich auch der Fachbereich 1 (Bildende Kunst) und
vielleicht auch andere künstlerische Fachbereiche Gedanken machen würden, ob
man in Zukunft die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen zur
Künstlerweiterbildung den Studenten schon während des Studiums empfehlen sollte.
Abgesehen von dem damit verbundenen Bildungsgewinn könnte den Studenten, die
sich später von ihrer Kunst allein nicht ernähren können, viel Zeit erspart
werden. Dieses Studium für die Studenten der Freien Kunst obligatorisch zu
machen, wäre noch besser, weil dadurch eine umfassende Bildung des gesamten
künstlerischen Nachwuchses erreicht würde. Hiernach wäre es dann logisch, demjenigen
Studenten, der den Meisterschülertitel haben will, in einer mündlichen Prüfung
den Nachweis von Mindesteinsichten und -kenntnissen in kunstrelevante
wissenschaftliche Gebiete abzuverlangen. Die Hochschule kann unmöglich den
Meisterschüler, von dem sie doch hofft, daß er sich mit seiner Kunst
durchsetzen wird, mit einer einseitigen Atelierausbildung entlassen und
andererseits dem, der nach dem Verlassen der Hochschule sich um einen Brotberuf
bemühen muß, zu einer vertieften Hochschulbildung verhelfen. Das Natürlichste
von der Welt wäre, wenn beide schon während der Studienzeit dieses Ergänzungsstudium
parallel zur Atelierarbeit wahrnehmen würden. Zeit genug ist dazu vorhanden.
Die Grunewaldstraße in Berlin-Schöneberg ist für mich
beinahe so etwas wie eine Schicksalsstraße geworden. In der damaligen
Kunstschule Schöneberg, Grunewaldstraße 1-4, habe ich zweieinhalb Jahre
studiert, mein Erstes Examen gemacht und meine erste Frau kennengelernt; im
Prinz-Heinrich-Gymnasium, Grunewaldstraße 77, habe ich mein erstes
Referendarjahr abgeleistet, in einer ihrer Querstraßen, in der Elßholzstraße
34- 37, lag mein Bezirksseminar während meines zweiten Referendarjahres, und
schließlich kehrte ich nach Krieg und Gefangenschaft in die Grunewaldstraße
1-6, in die nunmehrige Abteilung Kunstpädagogik der Hochschule für bildende
Kunst, zurück - für 26 Jahre.
Diese 26 Jahre haben mir manchen Gegner beschert, aber auch
viele Freunde geschenkt. Die stärkste freundschaftliche Bindung hatte und habe
ich noch heute zu Gerhard Fietz, mit dem zusammen ich in Breslau in der Klasse
Dobers das Studium begann. Unsere Freundschaftentwickelte sich erst 1936 in
Berlin, wurde durch den Krieg unterbrochen und lebte wieder auf, als Fietz in
die Abteilung Kunstpädagogik als Lehrer berufen wurde. Er war, nachdem Tappert
und Möller gestorben waren, mein einziger Malerfreund. Wir haben uns durch
Kritik und Bestätigung gegenseitig viel helfen können, obgleich wir in unserer
Arbeit Wege in sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen haben. Heute
wohnt Fietz jenseits der Elbe. Noch sind wir durch die Insel Cres verbunden,
auf der er vor etwa zehn Jahren ein Haus gekauft hat. Aber auch diese
Verbindung hört auf, wenn Ende September dieses Jahres (1984) mein letzter Aufenthalt
auf Cres beendet ist. Nur die gegenseitigen sporadischen Besuche bleiben
übrig.
Diesem Kapitel meiner Niederschriften ist wahrscheinlich
unschwer anzusehen, daß vieles von mir ausgespart wurde. Fast nichts habe ich
über die Hochschulkollegen geschrieben, mit denen ich jahrelang zusammenarbeitete.
Da nur selten die Hochachtung, die man einer hohen
künstlerischen oder geistigen Potenz oder einer hohen pädagogischen Fähigkeit
zollt, auch auf den Träger dieser Eigenschaften übertragen werden kann, reichte
die Skala meiner persönlichen Beziehungen zu den Kollegen von Kontaktlosigkeit
über die kollegiale Normalität bis zur freundschaftlichen Verbundenheit. Diese
Mischung ist natürlich, weil man sich für die Hochschularbeit die Kollegen
nicht nach persönlichen Gesichtspunkten aussuchen kann. Wir haben als Hochschullehrer
selbst dafür gesorgt, daß in unserer Abteilung eine breite Skala
künstlerischer Anschauungen und Lehrmeinungen vorhanden war. Wir mußten also
von vornherein mit Meinungsverschiedenheiten rechnen. Wir haben trotzdem oder
gerade deswegen die Hochschularbeit in Lehre und Organisation des Atelier- und
Werkstättenbetriebes gut leisten können, und das ist das wesentliche. In den
Beziehungen zwischen Menschen ist oft schwierig zu erkennen, wer sie gefördert
oder verhindert hat. Ich hüte mich, in den Hochschulklatsch abzugleiten, und
hoffe, daß ich dadurch dem Leser Langeweile erspare.
Die Namen meiner Kollegen, mit denen ich von 1948 bis 1974
in der Abteilung Kunstpädagogik zusammenarbeitete, können leicht in der
Hochschulbibliothek aus den Übungs- und Vorlesungsverzeichnissen erfahren
werden.
Im Querschnitt war mein Verhältnis zur älteren Generation
ausgeglichener als zu meiner eigenen oder zur jüngeren. Das liegt sicher daran,
daß meine erste wichtige Berührung mit Kunst, die noch in Neisse stattfand,
sich anhand der Kunst der Zwanziger Jahre vollzog. Ich empfinde eine gewisse
Affinität zu den Künstlern dieser Zeit. Sie dokumentiert sich zweifellos auch
in meinen Bildern. Mir bleibt sicher aus diesem Grunde der Zugang zu vielen
Erscheinungen heutiger Kunst oder - vorsichtiger gesagt - heutigen
Kunstbetriebes verwehrt. Trotzdem bin ich an allen auf Kunst zielenden Erscheinungen
und Aktivitäten unserer Zeit interessiert. Es ist erfreulich für mich zu sehen,
daß auch hier die Freiheit der Kunst gewahrt bleibt. Aber eine gewisse Barriere
hindert mich, zur Fraternität zu schreiten, wenn es sich beispielsweise um
Happenings, Environments, Multimedia oder Erzeugnisse eines Joseph Beuys
handelt. An meinem Alter kann das nicht liegen. Ich bin heute mehr als in
jungen Jahren überzeugt, daß das Feld der bildenden Kunst unermeßlich weit
ist, doch konnte ich schon immer nur dann etwas als Kunst anerkennen, wenn mir
die Qualität einsehbar war. Auch glaube ich nicht, daß Kunst die
Schnellebigkeit unserer Zeit mitmachen kann, ohne sich selbst in Frage zu
stellen. Anfänge von "Wegwerfkunst" sind ja schon vorhanden. Dieses
Wort drängt sich mir immer auf, wenn ich höre oder sehe, daß Christo eines
seiner Verpackungskunstwerke von der aufwendigen und mühselig befestigten
Plastikbahnenverkleidung wieder befreien mußte. Das künstlerische Engagement
auch eines Christo steht für mich außer Frage.
Ich brauche mich nicht weiter hierüber auszulassen. Eine
Streitschrift über Kunst kann und will ich auch nicht schreiben. Aber wenn ich
schon über mein Leben als Maler schreibe, hat der Leser ein Recht darauf zu
erfahren, daß es für mich in dem grenzenlosen Gebiet der bildnerischen
Gestaltungen einen Kern gibt, den wir mit Kunst bezeichnen, an dessen - leider
oder gottlob - bis heute unklar gebliebenen Grenzen einerseits ein Noch-nicht
und andererseits ein Nicht-mehr liegt. Ich bin der Meinung, daß es nutzlos ist,
über den Verlauf dieser Grenzen zu streiten, weil sie rational nicht erfaßbar
sind.
Bilanz
Seit 1974, nach 44jähriger Beamtendienstzeit, bin ich nun im
Ruhestand. Ich glaube, es war hohe Zeit, mich von der Hochschule zu
verabschieden. Die studentischen Unruhen waren nicht Schuld daran, daß ich die
Emeritierung am Ende des 65. Lebensjahres wahrnahm. Ich hatte den Wunsch,
endlich - wenigstens im Alter - wieder einmal ungehindert und ungestört malen
zu können. Mir war dabei klar, daß der Ruhestand mir nichts weniger als Ruhe
bringen würde, sondern daß die Malerei für eine gewisse Unrast sorgen, daß sie
mich nun noch mehr als bisher beanspruchen würde.
Wenn man genügend Ruhe hat, fängt man an, über sich selbst
nachzudenken. Mir ging es nicht anders. Bald drängten sich Gedanken über die
vielen Arbeiten, die in meinem Leben entstanden sind, in den Vordergrund. Die
Arbeiten lagen zwar einigermaßen geordnet in Mappenschränken, aber ich konnte
nicht behaupten, daß ich darüber einen Überblick besaß, der mir ermöglichte,
bestimmte Arbeiten, die ich wiederzusehen wünschte, schnell zu finden. Jetzt
entschloß ich mich, eine endgültige und gründliche Ordnung zu schaffen. Ich
begann, meine sämtlichen noch vorhandenen Arbeiten zu katalogisieren und
jahrgangs weise zusammenzufassen
Cornelia hatte schon 1965 begonnen, meine Bilder (Öl- , Dispersionsfarben- und Acrylbilder) und Collagen in
Kartotheken zu erfassen. Sie hat für jede Arbeit eine Karte angelegt, die die
Daten, die Story und ein Kontaktfoto mit dem Hinweis auf das Negativ enthält.
Außerdem hatte Cornelia von den wichtigsten Bildern und Collagen Dias
angefertigt.
Ich begann nun, ein Verzeichnis der Aquarelle, Zeichnungen
und Graphiken herzustellen, Signaturen zu ergänzen und jede Arbeit zu
numerieren. Es war eine umfangreiche Arbeit, die ich manchmal verwünschte, die
mir aber zum Schluß eine große innere Ruhe und Zufriedenheit schenkte.
Die nunmehr geschaffene Ordnung in den Mappen- schränken
ermöglichte mir, jede Arbeit mühelos aufzufinden. Außerdem gewann ich eine
klare Übersicht über meine künstlerische Entwicklung. Vier Phasen ließen sich
deutlich voneinander trennen.
I. Phase
1930 -1940 Freude an der sichtbaren Welt,
gefühlsmäßige Reaktion auf optische Eindrücke (1940 - 1948 Krieg und
Gefangenschaft).
II. Phase
1948 –
1957 Veränderung, Verwandlung
und Zerlegung des Sehbildes. Tendenz, von der gegenständlichen Auffassung
wegzukommen. Versuche, Zeichen für die
menschliche Figur zu entwickeln. Hinwendung zum Malerischen.
III. Phase
1957 – 1964 Zunehmend malerische Haltung.
Tendenz zu Bildern aus freien Pinselzügen ohne Beziehung zur sichtbaren Welt
und ohne Assoziationsmöglichkeiten. Schließlich
wieder Hinwendung zu Landschaft und menschlicher Figur.
IV. Phase
1964
– 1984 Versuche, zu einer neuen
Darstellung des Menschen zu kommen, Zerlegung der menschlichen Figur in ihre
Gliedmaßen, die zu einer neuen Figuration zusammengesetzt werden. Die
Farbe der Gliedmaßen wandelt sich zu Weiß, später auch zu Schwarz. Der Kopf
verschwindet zunächst, taucht
aber 1974 wieder auf, zunächst in Zeichnungen, seit 1980 in den Janusbildern,
seit 1982 in den Zeitgenossenbildern.
Nach Abschluß dieser
mühseligen Arbeit war mir merklich leicht zumute. Die Beispiele aus meinem
Bekannten* und Freundeskreis hatten mir des öfteren vor
Augen geführt, was ein ungeordnetes und unübersichtliches Lebenswerk eines
Malers bei dessen Tode für die Erben bedeutet. Den Erben, selbst den Ehefrauen
ist es dann nahezu unmöglich, die hinterlassenen Bilder zu datieren und mit
Titeln im Sinne des Autors zu versehen.
Bei dieser Registrierarbeit
kam mir sehr zustatten, daß ich seit meinem Studium meine Arbeiten immer
signiert und mit der Jahreszahl versehen habe. Dadurch konnten die
verschwindend wenigen unsignierten leicht zeitlich bestimmt werden. Nachdem das
Verzeichnis fertig war, legte ich noch eine Tabelle an, in der neben der
Jahreszahl in einzelnen Rubriken einige der markantesten Bilder, Zeichnungen,
Aquarelle, Graphiken und Collagen, meine Ferienaufenthalte, Reisen und
sonstigen Aktivitäten und schließlich noch Veränderungen und Tendenzen in
meiner künstlerischen Arbeit verzeichnet wurden. Die fertige Tabelle war schon
das Gerippe einer Selbstbiographie und regte mich an, mit der vorliegenden
Niederschrift zu beginnen. An ihrem Ende will ich noch eine Darstellung dessen
geben, was ich selbst über meine künstlerische Entwicklung zu sagen habe.
Vieles davon ist schon in diese Aufzeichnungen eingeflossen. Es ist aber
unsystematisch und fragmentarisch. Eine zusammenhängende Darstellung scheint mir
aufschlußreicher
I. Phase: 1930 bis 1948
Bewußt
künstlerisch zu arbeiten begann ich erst, als ich mich entschied, nach dem
Abitur ein Kunststudium zu beginnen. Meine davor liegenden künstlerischen Bemühungen
waren Gelegenheitsbeschäftigungen, vielleicht auch Zeitvertreib oder auch die
Erfüllung des Wunsches eines Freundes oder Bekannten. Das änderte sich
schlagartig nach der geschilderten Begegnung mit Werner Grundmann. Ich sah nun
meine Arbeiten, die meist vor der Natur entstanden, kritischer, sie nahmen mehr
Zeit in Anspruch, und ich suchte sorgfältiger meine Motive aus. Daneben machte
ich viele Linolschnitte, meistens nach Motiven der Stadt Neisse.
Nach
meiner Aufnahme in die Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau
verstärkte sich mein Wille, möglichst nichts in meinen Bildern zu erfinden,
sondern alles aus dem optischen Erscheinungsbild abzuleiten, aber mit eigenen
Empfindungen anzureichern, um dadurch den im Sehbild vorhandenen Ausdruck zu
steigern. Kein Wunder, daß ich van Gogh verehrte, ihn als Vorbild sah. Von den
Breslauer Akademielehrern imponierten mir Otto Müller und Paul Holz und dann
erst Oskar Moll. Das waren zwar drei sehr verschiedene Temperamente: die
weitgehenden, nahezu klassischen Vereinfachungen Otto Müllers, die frechen,
impulsiven, ausdrucksstarken Federkritzeleien von Paul Holz und die farbig
harmonischen, die Natur einerseits vereinfachenden, andererseits die Natur
"mißachtenden", beinahe erfundenen Bilder Oskar Molls. Aber die großen
Entfernungen, die zwischen ihnen lagen, obgleich sie alle drei von der Natur
ausgingen, brachten mir die wichtige Erkenntnis, wie weit das Spektrum
künstlerischer Aussage schon sein kann, wenn man nur die wahrnehmbare Natur als
Ausgangspunkt seiner Arbeit gelten läßt.
Die Akademielehrer stellten im Frühjahr und Herbst jeden
Jahres im Breslauer Kommandanturgebäude aus. Diese Ausstellungen regten mich
immer sehr an und bestärkten mich in meinem Bewußtsein, daß ich selbst im
Spektrum dieser drei Maler beheimatet sei. Die anderen, Alexander Kanold, Calo
Mense, Oskar Schlemmer und Johannes Molzahn, lagen schon außerhalb dieses
Spektrums.
Ich ging zu Fuß oder fuhr mit dem Fahrrad auf Motivsuche
und arbeitete vor den einzelnen Motiven zunächst sehr schnell und verhältnismäßig
kurze Zeit. Alles blieb dadurch noch im Skizzenhaften stecken. Ab 1931 änderte
sich das. Ich liebte die Kohlezeichnung, die man wegwischen und trotzdem im wesentlichen dann noch sehen und darüber korrigierend
arbeiten kann. So unglaublich das klingt: Ich habe an dem Portrait nach dem
Breslauer Lumpensammler Max Felgner, einer Kohlezeichnung, fünf Wochen lang
täglich drei Stunden gearbeitet (Abb. 1). Dieses etwas selbstquälerische
Arbeiten, bei dem sicher viele gute Ergebnisse durch das dauernde Wegwischen
zerstört wurden, ebbte aber nach einem halben Jahr wieder ab, und der
Arbeitsvorgang kam in selbstverständlichere Bahnen. Ich hatte den Punkt
zwischen Spannung und Lockerung, zwischen bewußt und unbewußt gefunden, wo ich
glücklich und sehr zufrieden arbeiten konnte. Besonders markante Höhepunkte
erlebte ich bei Arbeitsaufenthalten an Orten, wo ich mich fast nur auf der
Stelle im Kreise zu drehen brauchte, um in jedem Blickwinkel ein brauchbares
Motiv zu finden: in Alt-Schalkowitz und Pirano, später in Jugoslawien, Rowe und
Nidden.
Aber auch in den Vororten von Berlin tummelte ich mich. Es
entstanden neben vielen Portraits und Stilleben auch Landschaften, die dann
doch oft nicht direkt vor der Natur, sondern anhand von Zeichnungen aus der
Erinnerung zu Ende gemalt wurden, die natürlich - gewollt oder ungewollt - mit
Vorstellungen sich anreicherten. Mit besonderer Begeisterung zeichnete und
malte ich Portraits. So entstanden einige Bildnisse meiner Frau Marion und auch
Selbstbildnisse (Abb. 2).
Das Arbeiten aus der Erinnerung setzte sich dann im Krieg
fort, weil ich einen großen Teil dieser Zeit in Schützengräben, Bunkern und
Erdlöchern verbringen mußte. Besonders die Briefe an Marion waren mit
Federzeichnungen gefüllt, die meine Kriegserlebnisse und die russische
Bevölkerung darstellten. Außerdem entstanden Landschaftsaquarelle. Aus diesem
Abschnitt ist wenig, fast gar nichts erhalten geblieben.
Das Ende dieser Entwicklungsphase sah ich schon in den drei
Jahren sowjetischer Gefangenschaft auf mich zukommen. Trotz meiner damaligen
Stumpfheit stand oft die Frage vor mir, wie es nach meiner Heimkehr mit der
Malerei weitergehen sollte. Mein Skizzenbuch aus dem letzten Jahr der
Gefangenschaft (1947/48) gibt nur andeutungsweise Auskunft, wie schwankend ich
meine künstlerische Zukunft beurteilte. Es scheint mir eher ein Beweis dafür zu
sein, daß ich mich in einem desolaten seelischen Zustand befand. Meine positive
Einstellung zur Welt und mein Glaube, daß das Sehbild als Sujet für den Maler
ausreiche, waren am Ende.
II. Phase: 1948 bis 1957
Die wirkliche Auseinandersetzung mit meiner künstlerischen
Zukunft begann gleich nach meiner Heimkehr. Mein erstes Stilleben, das ich auf
eine noch vorgefundene lädierte Lederpappe malte, hatte einen Zinnkrug und
eine Steingutobstschale, in der ein Früchteabziehbild prangte, auf einer
blau-weiß-karierten Decke zum Motiv (Abb. 3). Sofort war ich mit den Fragen
konfrontiert: Sehbild oder anderes? Schein oder anderes? Meine Entscheidung ist
nicht ganz eindeutig ausgefallen. Ich versuchte, sie zu ertasten. Zwar sind die
Gegenstände dieses Bildes in ihren meßbaren und erfahrbaren Tatsachen
konzipiert, wie Aufsicht, Seitenansicht, senkrecht stehend, waagerecht liegend,
woran man das Abrücken von dem Sehbild klar erkennen kann, aber die Malerei ist
sinnlich, vom Spaß am Farbauftrag und von der Freude am Sehen geprägt.
Es folgten noch einige Stilleben im gleichen Sinne. Aber es
bedurfte nur der Reisen (1948) nach Hiddensee und (1949/1950) nach Rügen, um
dort durch die Konfrontation mit der Natur in Aquarellen und Zeichnungen in
meine Vorkriegsanschauung zurückzurutschen. Aber nach jeder Rückkehr nach
Berlin ging die Suche nach anderem weiter. Heute kann ich diese Suche nur mit
dem großen Nachholbedarf, der sich durch die Nazizeit und die Kriegs- und
Gefangenschaftsjahre aufgestaut hatte, erklären. Ich mußte alles, was in dieser
Zeit sich im In- und Ausland an Kunst ereignet hatte, nachholend kennenlernen
und verarbeiten, ehe ich überhaupt daran denken konnte, die Ecke in der
Kunstlandschaft zu finden, in der ich mich ansiedeln konnte. Ich sagte herzhaft
"Ja" zu diesem meinem Bedürfnis, hatte aber, Gott sei Dank, keine
Vorstellung davon, wie lange das dauern würde.
Ich arbeitete also weiter daran, das Sehbild, das optische
Erscheinungsbild, die sichtbare Natur, den Schein der Wirklichkeit oder wie
auch immer man dieses bezeichnen will, loszuwerden. Ich veränderte,
verwandelte, vereinfachte, verunklärte, zerstörte, verfremdete, zerhackte den
Gegenstand, um schließlich nicht in der Natur vorhandene Bildmotive zu erfinden
oder ein Motiv aus der Natur solange abzuwandeln, bis von ihm nur noch
Andeutungen, ein Konzentrat oder ein Schema zurückblieben. Einige Motive, wie
Stilleben, Mutter und Kind, Laokoon, Bulle und Kuh, habe ich bis zu zwanzigmal
variiert oder eine Tasse oder einen Stuhl zeichnerisch analysiert, um dem
Schwindel der Perspektive auf die Schliche zu kommen. Ich bin dabei in die
Jagdreviere Picassos, Braques, Klees und Max Emsts geraten, habe auch öfter
etwas gefunden, was, wie ich glaubte, völlig neu war, um dann bald von einer
Kunstzeitschrift belehrt zu werden, daß dies schon längst erfunden oder
gefunden worden war (1948 - 1951).
Meine Versuche, die menschliche Figur zu verändern und
schließlich abkürzende Zeichen dafür zu finden, brachten mich in die Nähe von
Klee und Mirö (1952-56) (Abb. 4). Der Eifer, mit dem ich an diesen Bildern
gearbeitet habe, scheint mir noch heute zu bestätigen, daß mein Interesse, über
Menschen etwas auszusagen, schon damals stark ausgeprägt war bzw. sich seit meinen
Anfängen keineswegs verringert hatte.
III. Phase: 1957 bis 1964
Ab 1957 schien sich ein Ende meines Suchens und Aufnehmens
anzukündigen. Meine Arbeiten wurden ohne mein absichtliches Dazutun
malerischer, offener, lockerer in der Erfindung. Diese Wandlung wurde durch ein
spektakuläres Naturerlebnis ausgelöst. Meine erste Reise nach Cres war im Jahre
1955. Ich fand durch diese Insel wieder zur Natur zurück. Zwar arbeitete ich
nicht direkt vor der Natur, aber in meinen lockeren Aquarellen, die zweifellos
Landschaften, Dampfer- und Schiffsfiguren darstellten, dokumentierte sich ein
neues In- die-Natur-Eingebettetsein, das gleichzeitig vom Abstand zur Natur
Zeugnis ablegte, so widersprüchlich das auch klingen mag.
Ich malte damals meine Aquarelle nicht vor einem gefundenen
Motiv. Vielmehr malte ich mehr aus den Farbflecken heraus, gefühlsmäßig,
impulsiv, meditierend, vielleicht sollte man es traumartig nennen. Besonders
1958 bis 1961, auf Cres, auf Formentera, auf Terschelling, spielte sich der Mal
vorgang, sehr zu meinem Erstaunen, beinahe in einer trancehaften Weise ab. Ich
konnte mich irgendwo in der Natur, in einem Zimmer, in einer Kneipe hinsetzen,
den Block aufschlagen, den Aquarellkasten anfeuchten und dann nach einigen
Augenblicken der Konzentration anfangen. Ausgangspunkt waren meistens ein
Farbfleck oder auch mehrere, der Rest spann sich wie von selbst darum herum
bis zum Bildrand. Meistens sahen die Arbeiten zunächst wie Landschaften aus.
Später wurden sie bewegter, aber schließlich auch assoziationslos. Sie wurden
malerischer und lockerer.
Auch in meinem Berliner Atelier wurden die Bilder immer
lockerer, wenn auch motivische Anklänge an
Früheres immer wieder auftauchten. Diese
Entwicklung war durch sehr malerische Collagen, die ab 1957 entstanden und von
denen später noch die Rede sein soll, vorbereitet worden. Sie fand 1959 einen
gewissen Kulminationspunkt in Bildern, die nahezu nur aus Farbflecken
bestanden. Die Affinität zum Tachismus war offensichtlich. Ich mußte also
weitersuchen, was mich allerdings gar nicht beunruhigte.
Die Steine, Felsen, Felswände und Felsspalten der Insel Cres
fingen mich ab 1959 stark zu interessieren an; ihre graphischen Elemente
verselbständigten sich schließlich zu Pinselzügen. Die vielen Cres-Bilder, die
1961 und 1962 entstanden, die aber immer noch neben dem Inselnamen
gegenständliche Motivbezeichnungen trugen, leiteten schließlich zu den
langgestreckten, japani- sierenden, zumindest oft asiatisch wirkenden Papierbildern
aus Pinselzügen und -flecken über, die mich 1962 bis 1964 beschäftigten (Abb
5,6).
Aber schon ab 1963 war zu merken, daß dieser neue Versuch,
mich von der Natur zu lösen, nicht gelingen würde. Im Gegenteil! Die Papierbilder,
vorwiegend die Querformate, wurden unverhohlen zu Landschaften (Abb. 7,8), und
schließlich die Hochformate - und dies nun schon bewußt von mir herbeigeführt -
zu menschlichen Figuren (Abb. 8a). Ich war also nach einer langen Irrfahrt,
wahrscheinlich einer sehr notwendigen Irrfahrt, freilich in einer vorher nicht
geahnten Weise, zur Natur zurückgekehrt, die ich eigentlich nie ganz hatte
negieren können.
Stand ich nun 1964 vor einem Scherbenhaufen? Hatte ich 17
Jahre sinnlos mit Suchen, Versuchen, Grübeln usw. vertan? Und wenn ja, was lag
nun vor mir? Sollte ich bei diesen Landschaften und Figuren, die mir Beziehungen
zum Nachimpressionismus zu haben schienen, bleiben oder wieder neu beginnen?
Nein, ich wollte beides nicht. Schwere Selbstzweifel kamen auf.
Manchmal drängte sich mir der Gedanke auf, daß ich eine
endlos lange Lehrzeit, eine autodidaktische Lehrzeit, hinter mir hatte. Aber
17 Jahre! Hatte sich das gelohnt? Immerhin hatte ich mit Begeisterung und ohne
an mir zu zweifeln gearbeitet. Jetzt war ich irgendwie beunruhigt, aufgewacht.
Waren tatsächlich 17 Jahre notwendig gewesen, um mir selbst nachzuweisen, daß
ich von der Natur nicht wegkonnte? Oder war ich vielleicht nahe daran, eine
neue, andere Einstellung zur Natur zu gewinnen als bisher?
Was war eigentlich konstant in meiner Malerei seit 1930
geblieben? Die immer wieder sich wiederholende Neigung zur menschlichen Figur,
zur Landschaft und zum Stilleben! War da der Schlüssel für meine künftige
Arbeit zu finden? Immer wieder kreisten damals meine Gedanken um den gleichen
Punkt: Wie geht es weiter? oder: Wie finde ich einen neuen Anfang? Ein Zufall -
oder war es kein Zufall? - kam mir zur Hilfe. Vielleicht hatte mich alles
Vorherige für diesen Zufall aufnahmefähig gemacht.
IV. Phase: 1964 bis 1984
Hier muß ich etwas zurückgreifen, um auf die Rolle der
Collage in meiner Arbeit zu sprechen zu kommen. In der Zeit des Suchens nach
meiner Heimkehr aus der Gefangenschaft waren naturgemäß viele Arbeiten,
Zeichnungen und farbige Arbeiten auf Papier entstanden, die meiner Kritik
nicht standhielten. Bis 1953 hatte sich ein ziemlicher Berg von ausrangierten
Arbeiten angesammelt, die ich meinem Urteil zufolge niemandem zeigen konnte.
Bei einigen stimmte die Komposition nicht, bei anderen war der Fluß der Ablesbarkeit
zu holprig. Diese Arbeiten schnitt ich auseinander und fügte Teile anders
zusammen. Der sehr lebendige Vorgang des Hin- und Herschiebens faszinierte
mich. Die Schnelligkeit, mit der ich ein brauchbares, aber immer noch mühelos
korrigierbares Resultat erzielen konnte, war verblüffend. Die nach einigen
Tagen schon recht zahlreich herumstehenden, mit Nadeln aufgespießten Arbeiten,
die geschnittenen oder gerissenen Schnipsel auf dem Fußboden, auf allen Tischen
und herausgezogenen Schubladen der Mappenschränke steigerten meine
Arbeitslust. Sehr bald wurde ich wagemutiger, zerschnitt auch Arbeiten, an
deren Qualität ich nur leicht zweifelte, fügte andere Elemente aus Zeitungen
oder aus zufällig vorhandenen farbigen Papieren hinzu. Schließlich entstanden
auch Collagen, die unabhängig von früheren Arbeiten waren und nur aus
aufgeklebten Papieren bestanden, in die ich noch hineinzeichnete. Die
Unabhängigkeit, die ich dabei erlangte, kulminierte in sehr malerischen,
skizzenbuchgroßen Collagen, die ich 1957 bei einem Kuraufenthalt in Bad Orb in
meinem kleinen gemieteten Zimmer machte. In diesen Arbeiten stehen die
Techniken Zeichnen, Malen und Geklebtes Papier gleichberechtigt - zu einer
Arbeitsweise vereint - neben- und ineinander. Es wurde schließlich unwichtig,
ob ich mit Kleben, Zeichnen oder Malen begann.
In den folgenden Jahren (1958-1963) entstand keine einzige
Collage mehr. Die Collagen hatten mich zu etwas Neuem oder Anderem, auf jeden
Fall in eine abstrakt malerische Phase geführt, von der ich schon weiter oben
berichtete. Die Collage hatte also einen neuen Abschnitt meiner Arbeit
eingeleitet, und ich brauchte sie offenbarnicht mehr. Sie bot sich aber sofort
wieder an, als im Herbst 1964 jener Zufall eintrat, der schon angedeutet wurde.
Ich hatte mehrere Jahre keine illustrierten Zeitungen
angesehen. Sie hatten mich aus irgendeinem Grunde, den ich nicht mehr
bezeichnen kann, abgestoßen. Im Wartezimmer meines Zahnarztes, während einer
unverhältnismäßig langen Wartezeit, griff ich doch zu den Stößen von
Illustrierten, die da herumlagen, um mir die Zeit zu vertreiben. Und siehe da,
ich war sofort sehr interessiert, nahezu gefesselt, so daß ich beinahe ärgerlich
war, als ich endlich in das Behandlungszimmer gerufen wurde.
Zunächst war ich erstaunt über die Güte des Druckes und der
Wiedergabe der Fotos, auch über die oft große Qualität der Fotos. Da hatte sich
also viel geändert. Aber nach einigen Minuten drängte sich mir ein Bild vom
Menschen auf, das ich bisher mit solcher Deutlichkeit nie bemerkt hatte. Ich
wußte aber nicht, wie ich es benennen oder charakterisieren sollte. Die
Vielfalt menschlichen Ausdrucks, menschlicher Leidenschaften, menschlicher
Aktivitäten, menschlicher Eitelkeiten, menschlicher Schwäche und Stärke, die
vielen Menschengestalten, schön und häßlich, arm und reich, lustig und traurig,
normal und verrückt, angezogen und nackt, krank und gesund, tätig und faul,
aufgedonnert und zerlumpt, und immer wieder die vielen in den Blickpunkt
gerückten menschlichen Gliedmaßen - die Hände, die Füße, die Beine, die
Hinterteile, die Köpfe, die Gesichter -, die besonders in den bebilderten Reklameseiten
für Badeanzüge und Unterwäsche und Strümpfe als Einzelheit sich mir
aufdrängten, - dies alles stand als verwirrender, kunterbunter Haufen vor mir,
ein bewegtes, kaleidoskopartiges Krabbelgebilde, ein emsiger Ameisen- oder
Insektenhaufen, ein beunruhigendes, rätselhaftes Gebilde aus Menschenteilen,
ein Menschenknäuel, ein Menschenknoten, in dem es gleichgültig war, zu wem die
einzelne Hand, der einzelne Busen oder das einzelne Gesicht gehörte, ein
durcheinandergequirltes Sammelsurium von Gliedmaßen, Kleidern, Dessous,
Werkzeugen, Accessoires usw. Am beunruhigendsten waren mir die vielen Hände,
Beine, Arme in dieser Vision.
Gleichzeitig drängte sich mir als Komplementärvorstellung
das herbe und gelassene Idyll menschlichen Daseins auf der Insel Cres oder im
Dorf meiner Großeltern oder in Rowe oder Nidden auf. Der Gegensatz zwischen
diesen beiden Welten, die Spannweite zwischen dem heute noch vorhandenen, fast
animalisch primitiven Dasein des Menschen und der ebenfalls vorhandenen, aber
ausufernden, hypertrophischen, oft ganz sinnlos erscheinenden Betriebsamkeit
unserer Großstädte mit dem Verkehr, den Kaufhäusern, den Produktionsstätten,
dem Sich-gegenseitig-Übertrumpfen, dem Sich-zur-Schau-Stellen, dem Überfluß,
der das zum Leben Notwendige längst in erstickendem Maße überschritten hat -
dieser Gegensatz zwischen einer noch hinreichend intakten Natur und dem darin
sich austobenden Menschen, der vielleicht schon dabei ist, sich durch seine
übertriebenen Aktivitäten und seine Zerrissenheit das Inferno seines
Unterganges zu schaffen, bewegte mich sehr.
Andererseits stellte sich mir, der sein Leben lang gemalt,
gezeichnet, geklebt und sonstwie an Sichtbarem und Greifbarem herumgebastelt
hatte, die Frage, warum denn so wenige bisher mit dem immensen Arsenal von
menschlichen Gliedmaßen in den Illustrierten etwas angefangen hatten. Sicher -
die Geschichte der Collage beweist es - haben viele die Illustrierten für ihre
Gestaltungen benutzt.
Aber eine Besonderheit meines Illustriertenerlebnisses
schien mir noch keineswegs auch nur andeutungsweise irgendwo aufgetauchtzu
sein. Dieses Besondere konnte ich nicht benennen, ich konnte es mir auch nicht
klar vorstellen, ich ahnte es nur. Es schien mir aber verlockend, diesem
Unbekannten nachzugeben, mich damit zunächst experimentierend zu beschäftigen.
Da in meinen Arbeiten 1963 die menschliche Figur wieder
aufgetaucht war und mich beunruhigt hatte, lag es sehr nahe, den Impuls dieses
Erlebnisses aufzugreifen. Ich fing an, menschliche Gliedmaßen aus Illustrierten
auszuschneiden. Nach zwei bis drei Tagen hatte ich genügend vor mir liegen -
große, mittelgroße und kleine. Ich breitete sie aus, schob sie zusammen und
wieder auseinander. Die Gebilde, die sich da vor mir zeigten, waren in ihrer
Zufälligkeit, in ihrer Negierung jedes natürlichen Zusammenhanges eine
aufregende Überraschung für mich. Sie sagten eigentlich schon viel über mein
Illustriertenerlebnis aus, ohne daß ich mir die geringste Mühe zu geben
brauchte, gestaltend oder auch nur ordnend einzugreifen.
Die Köpfe darin waren eine starke Beunruhigung. Wenn sie
zufällig mit den danebenliegenden Gliedmaßen den Proportionen des menschlichen
Körpers entsprachen, entpuppten sich diese Stellen als leibhaftige Kretins. Bei
meinen nun folgenden Versuchen ergaben sich die überzeugendsten Gebilde, wenn
ich riesengroße Gliedmaßen mit kleineren kombinierte, und wenn ich die Köpfe
so hinter Körperteilen versteckte, daß sie mehr zu ahnen als zu sehen waren.
Schließlich verschwanden die Köpfe ganz, obgleich ich mich auch mit ihnen
längere Zeit beschäftigte, indem ich sie veränderte, so daß auch beim Kopf der
naturgegebene Zusammenhang seiner Einzelteile negiert wurde.
Als schließlich die ersten Collagen vor mir lagen, war
deutlich zu merken, daß die Gliedmaßengebilde keineswegs mehr menschliche
Gebilde zu nennen waren, daß sie aber etwas über den Menschen in einer
geheimnisvollen, rätselhaften Weise aussagten. Manchmal erinnerten sie auch
an femöstliche Figuren mit vielen Armen und Beinen, die dort natürlich eine
ganz andere Bedeutung haben und anderes aussagen. Diese Collagen waren in der
Farbe sehr zurückhaltend, weil ich ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotos ausgeschnitten
hatte.
Die Frage, ob ich die Zahl dieser Arbeiten noch vermehren
sollte oder ob ich versuchen sollte, nun Bilder im Sinne dieser Collagen zu
malen, war fällig. Mein Freund Gerhard Fietz sprach diese Frage sofort aus, als
ich ihm die Collagen eines Tages zeigte.
Ich fing an, eine kleine Collage in ein über zwei Meter
hohes Bild zu übertragen. Es entstand die "Nereide Cres" (Abb. 9,10).
Durch die Vergrößerung zwang ich mich dazu, die ursprüngliche Konzeption zu
verändern, denn kleine Entwürfe lassen sich nie pedantisch genau in ein großes
Bild übertragen, zumal wenn der Entwurf nur zeichnerisch oder, wie in diesem
Falle, ohne Farbe erfolgte. Dieses Bild zu malen war für mich aufregend und
erfrischend. Es kam auch zu einem guten Ende und bestätigte mir, daß ich einen
gangbaren Weg eingeschlagen hatte, meine Bildvorstellungen zu realisieren. Die
Farbigkeit der "Nereide Cres" entsprach der Farbigkeit eines vor der
Natur gemalten Aktes. Es handelt sich also um ein vorgestelltes Sehbild.
Die Tatsache, daß ich nun beim Malen von den Collagen
abhängig war, beunruhigte mich. Ich fing daher an, im Sinne dieser Collagen zu
zeichnen und zu malen. Das war zunächst nicht ganz einfach, weil ich mir nicht
klar war über die Möglichkeit, Zeichnungen und Bilder im Sinne von Collagen zu
machen. Selbst wenn ich einen Arm oder eine Hand oder einen Kopf irgendwohin
auf das Papier zeichnete, ohne mir eine ganze Figur vorzustellen, rutschte ich
immer mit dem Fortschreiten der Zeichnung in die Nähe der Natur, und wenn ich dann
in diese nunmehr "falsch" oder anders als in der Natur
zusammengesetzten Gliedmaßenknoten oder Verschlingungen noch naturalistische
Farbe brachte, war das Resultat unbefriedigend. Solche Bilder sind der
"Gaukler", "Halbakt" und "Aeolus". Im Bild
"Schlafende Venus" kam ich während meiner Arbeit beim dauernden
Übermalen und Ändern der Gliedmaßenfarbe schließlich bis zum Weiß (Abb. 11).
Das wirkte sofort überzeugender. Warum? Die Größe der Gliedmaßen und des
Kopfes hielten sich in diesem Bild stark an die Proportionen des menschlichen
Körpers. Die Zusammensetzung der Gliedmaßen entsprach aber keineswegs der
Natur. Erhielten die Gliedmaßen nun noch zusätzlich eine naturalistische, dem
Sehbild entnommene Farbe, war der Zwiespalt in der Gesamtkonzeption eklatant,
weil das Bild naturalistische und anaturalistische Elemente enthielt. Was bei
der "Nereide Cres" noch möglich war - in ihr wiesen die Gliedmaßen
sehr starke Größenunterschiede auf, also ein anaturalistisches Element mehr -,
ging bei der "Schlafenden Venus" nicht. Durch das unsinnliche
anaturalistische Weiß, auf das ich experimentierend, probierend gekommen war,
kam das Bild näher an eine anaturalistische Einheit heran, wenn auch nicht
ganz. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, die mich wenig später auf rein
weiße Gliedmaßen kommen ließ. Zunächst habe ich aber genau das Gegenteil getan
und ein Bild wie "Schlafendes Paar" gemalt, an dem ich heute noch als
einem besonderen Kuriosum von Malerirrwegen meine Freude habe. Es entspricht
ungefähr einem Bild von Franz Marc, auf dem ein naturalistisch gezeichneter
Pudel zu sehen ist, der aber ein rosafarbenes Fell hat.
Die Phantasie jedes Menschen ist auf eine bestimmte Art
festgelegt, so daß man sogar erkannte Irrwege in der künstlerischen Arbeit verstandesmäßig
nicht vermeiden kann. Es bedarf häufig eines Wegweisers, eines Vehikels oder
einer Spielregel, die verhindert, immer wieder in die alten, ausgefahrenen
Gleise seiner Phantasie zurückzugleiten. Speziell für mich handelte es sich
darum, einen Arbeitsprozeß zu finden, der den naturgegebenen Zusammenhang
menschlicher Gliedmaßen in meinen Zeichnungen verhindert. So versuchte ich meine
Vorstellungs- und Erinnerungsbilder vom Menschen beiseite zu lassen, mir nur
einzelne Teile des Menschen vorzustellen und sie einzeln, wahllos und verstreut
auf die Zeichenfläche zu bringen, ohne Proportionen und organische
Zusammenhänge zu berücksichtigen. Die nun folgende Bemühung, die ohne Beziehung
zueinander stehenden Gliedmaßen in eine neue Figuration einzubeziehen, zwang
die Vorstellung und die Phantasie, andere Wege als bisher zu gehen. Die
Resultate waren für mich selbst überraschend, und nach einiger Zeit hatte meine
Phantasie den neuen Weg so vollkommen akzeptiert, daß ich ohne die oben
beschriebenen Methoden sofort und von Anfang an im Sinne dieser neuen
Figuration zusammenhängend zeichnen konnte. Ich kann also jetzt zeichnen, ohne
am Anfang die Vorstellung oder die Phantasie zu bemühen; diese greifen erst
dann ein, wenn der Weg zur Beendigung der Arbeit von ihnen erkannt werden soll.
Ich kann also beinahe sagen, daß meine Zeichnungen nicht von mir erfunden
werden, sondern daß sie bei der Arbeit entstehen. Die auf diesem Wege
folgerichtig entstehenden Figurationen sehen merkwürdigerweise in einem gewissen
Sinne organisch aus und verwirklichen meine Auffassung vom heutigen Menschen,
den in seinem objektiven Erscheinungsbild darzustellen ich wahrscheinlich
nicht mehr für zeitgemäß hielt.
Seitdem ich das Weiß als Farbe für die menschlichen
Gliedmaßen gefunden hatte, veränderte sich noch ein anderes Element in meinen
Bildern: das Plastische. Bisher hatte ich die Plastik dadurch erreicht, daß ich
die aus der Natur entnommene Lokalfarbe jedes Gegenstandes durch Dunkeln
stufte. In der "Schlafenden Venus" blieb die gestufte Lokalfarbe noch
stehen, obgleich ich die hellen Partien der Lokalfarbe durch Weiß ersetzt
hatte. Auch in einigen folgenden Bildern behielt ich dies bei. Erst ein Jahr
später benutzte ich zur Modellierung Graustufen. Ich versuchte auch, in einem
Bild den Gliedmaßen verschiedene Lokalfarben zu geben. Auch dies schien mir ein
gangbarer Weg, das Bild zu einem einheitlichen Abstraktionsgrad zu bringen,
d.h. allen Teilen des Bildes zu einem gleichen Abstand zur Natur zu verhelfen.
Mit anderen Worten: Ich war der Gefangene der klassischen Auffassung von
Kunst, die eine Einheitlichkeit in der Gestaltung aller Teile des Kunstwerkes
verlangt. Trotzdem stellte ich mir immer wieder die Frage, ob es nicht möglich
sei, diese Auffassung zu durchbrechen. Mir schwebte eine andere, freiere, ungebundenere
Auffassung vor. Warum sollte es unmöglich sein, durch eine vollständige, aber
vollkommene Un- einheitlichkeit zu einer neuen Vollkommenheit, zu einer neuen
Einheit zu gelangen? Einen Schritt zur Lösung dieses Problems machte ich 1973,
ohne es zu beabsichtigen. Und wieder half die Collage.
Noch einmal zurück zu meiner neuen Figuration, zu der von
meinem Erlebnis im Zahnarztvorzimmer inspirierten Kunstfigur, zu meinen
Glieder- oder Gliedmaßenknoten oder wie man dies auch immer nennen mag. Ich
berichtete schon, daß die von den Illustrierten hervorgerufene Vision eines
makabren Menschenbildes in mir gewissermaßen eine Gegenvision, eine
Komplementärvision erzeugte: meine Erlebnisse auf der Insel Cres, allgemeiner
gesagt: die wenn auch nicht heile so doch noch einfache, klare und ruhige Welt
von Cres. Diese Welt hatte seit 1955 starke Einflüsse auf mich gehabt, sie
hatte mich und meine Malerei umgekrempelt und nun auch den einschneidenden
Umbruch von 1964 herbeizuführen geholfen. Sie zog erst zögernd, dann immer
nachdrücklicher in meine neuen Bilderein. Aber sie
trat nicht unmittelbar auf, sondern eher verschlüsselt
in Symbolen für Meer, Berge, Früchte, Fische usw., die mehr von
Bildnotwendigkeiten als von Naturgegebenheiten bestimmt sind. Sie erscheinen
auch immer in ihrer intakten, ursprünglichen Form, im Gegensatz zum Menschen,
der zerlegt, in anderen Proportionen und anders zusammengesetzt erscheint.
Hier habe ich merkwürdigerweise - sicher nur unbewußt - einen
Bruch in der bisher von mir verfochtenen durchgehenden Einheit des
Abstraktionsgrades im Bild zugelassen, um den Gegensatz des nicht mehr
intakten Menschen zur noch intakten Natur ablesbar zu machen. Ich habe mir hier
eine gewaltige Freiheit herausgenommen. Das war 1966. Etwa 15 Jahre später
sollte das weitere Folgerungen zeitigen.
Natürlich ging das alles nicht so reibungslos und einfach,
wie es sich schildern läßt. Nachdem die ersten Bilder dieses erneuten Anfangs
aus mir herausgepurzelt waren, kamen Zweifel. Im Frühjahr 1966, bei einem
Ferienaufenthalt in der einsamen Bucht Nedomisce auf der Insel Cres im Zelt,
brachte ich kaum etwas zustande,
Zweifel plagten mich; ich verlegte mich lieber aufs
Faulenzen und Angeln. Nur drei kleine Skizzenbuchmalereien entstanden. Sie
zeigen einen Maler, der beim Schlaf, beim Malen und beim Lesen von seinem neuen
Gliederknotenidol belästigt wird. Vorher hatte ich mich bei einem
Studienaufenthalt mit Studenten auf der Insel Terschelling auch schon intensiv
mit meinem neuen Problem auseinandergesetzt, hauptsächlich zeichnerisch.
Hiernach, im Sommer 1966, in dem kleinen Hirtengehöft von
Sveti Blaz auf Cres, schritt meine Arbeit hemmungslos vorwärts, ich war ohne Skrupel.
Ich war jetzt überzeugt, daß ich die mir genommene oder vielleicht auch
geschenkte Freiheit unbedingt benutzen mußte. Ich fühlte mich auf dem richtigen
Wege. Es kam nur noch darauf an, allmählich die beiden gegensätzlichen Welten
zu einer überzeugenden Bildeinheit zusammenzuschweißen. Es entstanden Bilder,
die oft noch holprig, aber doch zu meiner Zufriedenheitgerieten. Sie brachten,
ohne daß sie mich große Mühe gekostet hatten, schon deutlich zum Vorschein,
was mir vorgeschwebt hatte (Abb. 12). Ich wagte deshalb 1967 auch die erste
Ausstellung dieser Bilder in der Galerie Hammer im Europa-Center Berlin. Die
Ausstellung zeigte Bilder, Zeichnungen und Collagen. Auf spektakulären Erfolg
hatte ich dabei nicht gehofft. Wichtig war mir nur, daß der Zeitpunkt des
Erscheinens dieser neuen Bilder in der Öffentlichkeit dokumentarisch mit einem
Katalog fixiert wurde. Die Vorbereitungen für diese Ausstellung brachten mir
die nähere Bekanntschaft mit Heinz Ohff, der das Katalogvorwort schrieb, und
mit Prof. Dr. Eberhard Roters, der zur Eröffnung sprach. Beiden
bin ich zu großem Dank verpflichtet. Genauso auch Jule Hammer, der mir in
seiner Galerie diese Ausstellung ermöglichte und dem ich seither freundschaftlich
verbunden bin. Ihnen verdanke ich sicher, daß ich wenigstens in Berlin
einigermaßen bekannt geworden bin. Das Echo der Ausstellung war - wie erwartet
- nicht groß. Die Kritiken waren vorsichtig. Verwundert nahm ich aus einer
Kritik zur Kenntnis, daß ich mich in "Beckmannschen Räumen" bewegte.
Auch heute noch kam wieder eine Kritikerin in Bonn zu einer ähnlichen Ansicht.
Ich selbst kann keine Ähnlichkeit meiner Bilder mit den Werken dieses von mir
allerdings hochgeschätzten Malers feststellen. Auch mit Leger brachte man mich
zusammen. Das Menschenbild in meinen Bildern hat sicher nichts mit den
Maschinenmenschen Ldgers zu tun. Vielleicht haben die weiße Farbe der
Gliedmaßen und die starken schwarzen Konturen (wie einfach!) die Vergleiche
provoziert. Es ist sicher schwer, über bildende Kunst zu schreiben.
Wahrscheinlich sieht man das auch vielen Passagen meiner Aufzeichnungen an. Man
wird leicht verführt, etwas an der Oberfläche Liegendes für das Entscheidende
zu halten oder Unwesentliches an den Haaren herbeizuziehen, um etwas
Erklärendes, Lobendes oder Kritisches zu sagen.
Natürlich ist es richtig, daß Kritiker sich nicht zurückhalten,
wenn ein plattes und offensichtliches Plagiat vorliegt. Normalerweise sind aber
solche Fälle gar nicht kritikwürdig. Sonst aber muß man dem Künstler zugestehen , daß er die Welt der bekannten Kunstwerke als
zu seiner Umwelt gehörig betrachtet und sich ihrem geistigen Einfluß nicht
verschließt. Er muß die Freiheit haben, auf alles, was er zu Gesicht bekommt,
also auch auf die Formen- und Farbwelt anderer Künstler, in seinem eigenen Werk
zu reagieren. In welcher Art diese Reaktion erfolgt, ob er daraus zitiert, ob
er sich daran anlehnt, ob er darauf aufbaut, ob er verändert, ob er
weiterentwickelt, ob er mehreres kombiniert - das muß ihm überlassen bleiben
und kann ihm nicht angelastet werden. Er muß die Möglichkeit haben, in die
tradierte Formenwelt einzusteigen und sie seiner persönlichen Aussage dienstbar
zu machen. Ein Kunstwerk muß eine Aussage über die bei seiner Entstehung
vorhandene Welt machen. Zur Welt gehört auch die bisher geschaffene Kunst.
Auch sie kann in die Aussage einfließen, zumindestens indirekt, verschlüsselt,
versteckt oder sonstwie, und man darf auf keinen Fall ausschließen, daß sie
auch direkt auftaucht, verwendet oder eingebaut wird. Wer meint, ich spräche
hier dem Plagiat das Wort, hat mich mißverstanden. Wer meint, das spräche den
bisherigen Gepflogenheiten Hohn, der muß daran erinnert werden, daß in der
Kunst bisher immer auch Tabus beseitigt wurden.
Die Deutung meiner Bilder scheint gar nicht so schwer zu
sein. Ein Bekannter sagte auf die Frage eines anderen, was denn meine Bilder
bedeuteten, das sei ganz einfach, man brauche nur genau hinzusehen. Der Mensch
sei auseinandergenommen und anders wieder zusammengesetzt, er stimme in den
Proportionen nicht mehr und der Kopf fehle ganz. Das müsse ja dann mit der
Meinung des Malers über die Menschheit insgesamt etwas zu tun haben.
Ein anderer sagte etwas ganz anderes. Er wunderte sich, daß
einige meine Bilder nicht mögen. Und indem er auf die sinnliche Wirkung der
prallen Gliedmaßen und Früchte hinwies, meinte er, er habe Lust, sich mit
seinem nackten Hintern mitten in diese Bilder hineinzusetzen. Dieser hatte
also eine andere Seite meiner Bilder als wesentlich empfunden.
Und einer meiner jugoslawischen Freunde, der mich jedes Jahr
ein- bis zweimal besuchte, um meine Bilder - auch in ihrer Entstehung - zu
sehen, sagte eines Tages etwas verlegen, er glaube jetzt zu wissen, was ich
male: Es sei der Irrsinn der Welt.
Alle drei, obwohl sie in ihrem Leben wenig mit Kunst zu tun
hatten, liegen in ihrer Unbefangenheit gar nicht so falsch.
Mit viel Verstand und Wissen glauben die Menschen, die Welt
vorteilhaft zu verändern. Aber ihr insektenhaft eifriges Tun ist ein makabres
Spiel mit der Natur zum Nachteil der Natur und des Menschen selbst. O homo
ludens! Genau dieses makabre Spiel treibe ich in meinen Bildern speziell mit
den Menschen: Ich zerstöre sie und setze sie anders zusammen, damit sie in
meinen Bildern in etwa in ihre zugerichtete Welt passen. Denn der Mensch, der
so viel Unheil anrichtete, kann ja auch nicht mehr heil sein, und das muß im
Bild sichtbar werden.
Dieses Spiel, das ich in meinen Bildern treibe, ist aber
weniger gefährlich als das Spiel, das wir mit der Umwelt treiben; es ist nur
für mich von Nachteil. Denn meine Bilder halten dem Menschen sein häßliches
Spiegelbild vor. Und wer sieht das schon gerne?! Instinktiv scheint jedoch
jeder zu ahnen, worum es sich handelt. Das ist wiederum erfreulich für meine
Bilder. Wenn die Prämisse stimmt, daß der Mensch zeit seines Lebens dabei war,
unsere Natur und unsere Umwelt zu demolieren, dürfte es verhältnismäßig logisch
sein, daß ich diese Tatsachenolens volens in meinen Bildern mindestens in
verschlüsselter Form auftauchen lasse. Die Thematik meiner Bilder könnte
natürlich direkter sichtbar gemacht werden. Manche Maler gehen dieses Thema
direkter an, indem sie offen und unverschlüsselt den Menschen als Kretin
darstellen. Solche Bilder kommen anscheinend besser an. Jeder ist ja überzeugt,
er brauche sich selbst mit solchen Darstellungen nicht zu identifizieren.
Andere Maler wieder stellen in ihren Bildern die krassen Verfallserscheinungen
der Menschheit dar, z.B. Trunk- und Rauschgiftsucht, Kriegstreiberei, Krieg,
Terrorismus usw. Bei diesen Bildern kann fast jeder Betrachter sagen, er sei
damit nicht gemeint. Eindeutige und leicht zu deutende Bilder werden gern
gesehen. Ich bin aber der Meinung, Kunst müsse vieldeutig sein. Dies kann sie
aber nur, wenn sie ihr Thema oder ihr Problem verschlüsselt darstellt, wenn sie
die Zustände der Welt nicht direkt oder punktuell spiegelt, sondern wenn sie in
Metaphern und Gleichnissen spricht.
Nach dem oben Gesagten könnte man glauben, ich sein ein Pessimist, der graue, unfrohe, trübselige Bilder
malt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe auch viel Freude an der Welt, und
ich liebe das Leben, was wahrscheinlich der Grund für das Überwiegen heller und
klarer Farben in meinen Bildern ist. Wer das Leben und seine Umwelt liebt,
reagiert aber auch empfindlich auf die gefährlichen Veränderungen, die um ihn
herum sichtbar werden. Bisher habe ich mich immer geweigert, eine Deutung
meiner Bilder vorzunehmen. Wenn der Maler das selbst tut, wird von ihm
womöglich eine Einbahnstraße gebaut, aus der dann kein Betrachter mehr
herauskommt. Die Mehrdeutigkeit meiner Bilder würde dadurch eingeschränkt. Ich
höre aber oft den Vorwurf, ich ließe den Betrachter mit meiner Symbolik allein.
Das haben allerdings viele Maler schon vor mir getan.
Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, warum sich in
meinen Bildern bald nach Beginn der letzten Phase, die 1964 begann, schwarze
Konturen eingestellt haben, die zunächst locker und grob in Erscheinung traten,
sich aber bald verfestigten und später schließlich in der Durchführung
gewissenhaft - manche sagen: pedantisch - wurden. Gefühlsmäßig stehe ich zu
diesen schwarzen Konturen, verstandesmäßig sie zu deuten oder zu erklären bin
ich vorsichtig und zurückhaltend. Verstandesmäßig kann man feststellen, daß die
Kontur (einschließlich der Binnenzeichnung) den größtmöglichen
Abstraktionsgrad des gesehenen Gegenstandes, des Sehbildes, darstellt. Wenn
sich die Kontur, dieses Abstraktissimum, vordrängt und wie ein Netz das Bild
überdeckt, bedeutet dies zweifellos eine starke Distanzierung von der sichtbaren
Natur, von dem Gegenstand, von der vorhandenen Welt, von der Realität (Abb.
13). Die Realität ist also zwar erkennbar, aber nicht mehr vordergründig
gemeint. Die sinnlich erfahrbare Realität ist verwandelt und zum Vehikel für
etwas Neues oder Anderes gemacht worden. Wenn aber die sichtbare Realität nicht
mehr gemeint ist, wird es auch möglich, sie wie auch immer zu benutzen, sie zu
verändern, zu zerstückeln, zu verwandeln, zu verunklären usw., anders gesagt:
Es wird nun möglich, das Bild zum Träger einer vorgestellten Welt zu machen und
die Gegenstände und Gegenstandsteile im Bild noch klar erkennbar darzustellen.
Sie sind aber nicht mehr selbst die Aussage des Bildes, sondern die Aussage
liegt schon jenseits der erkennbaren Gegenstände, jenseits des sinnlich
Erfaßbaren. Im Katalogvorwort schrieb 1967 Heinz Ohff: "Die sehr klaren...
Konturen lassen keinen Zweifel daran, daß es sich hier nicht um Spuk handelt,
sondern um Gegenwart, nicht um Wahn, sondern um erfahrene Wahrheiten".
Die schwarzen Konturen lassen nicht zu, daß das von der
Gegenständlichkeit der Natur abweichende Bild fehlgedeutet wird; sie
signalisieren vielmehr die Auseinandersetzung des Urhebers mit der Realität,
mit der Gegenwart, mit seiner Zeit. Das Bild ist zum Träger eines Bekenntnisses
geworden, das verschlüsselt mitgeteilt wird.
1969 bot sich die Möglichkeit, in der Kunsthalle Wilhelmshaven
eine Retrospektivausstellung zu machen. Es war für mich natürlich ein
besonderes Erlebnis, in einem großen und gut gegliederten Raum eine Übersicht
über meine Arbeit seit 1935 aufzubauen. Die vier Phasen meiner Entwicklung
ließen sich gut voneinander trennen, wobei die beiden ersten Phasen sich fast
nahtlos aneinanderzufügen schienen. Auch die Phase IV schien mir mit I und II
stark zusammenzuhängen. Nur die Phase III fiel aus dem Zusammenhang heraus. Sie
fällt zeitlich genau mit meinem größten Engagement in der Hochschule zusammen,
als ich Abteilungsleiter der Abteilung Kunstpädagogik war. Die Phasen I, II
und IV haben als Gemeinsamkeit die Auseinandersetzung mit den in der Natur
sichtbaren Gegenständen oder Gegenstandsteilen. Ich lernte, die Phase III als
eine letzte, fast gewaltsame Anstrengung zu verstehen, den Gegenstand aus
meinen Arbeiten zu eliminieren. Trotzdem schienen mir gerade diese Bilder sehr
locker, gelöst, unbeschwert und heiter zu wirken. Ich schätze, sie waren für
mich ein Gegengewicht gegen die oft harten Auseinandersetzungen und
Schwierigkeiten in der Hochschularbeit, eine Art der Selbsthilfe oder der
Selbsttherapie, sie waren eine Entspannung, eine Ausgleichshandlung, ein
Sichfallenlassen.
1969 fing ich an, Siebdrucke zu machen. Der technische
Vorgang ist einfach. Da mich volkstümliche Drucke, z.B. die Neuruppiner
Bilderbogen, immer stark beeindruckten, nahm ich mir vor, nur mit drei, vier
oder fünf Sieben zu drucken. Ich Fing also mit den
vier Farben Rot, Gelb, Blau und Schwarz an und nahm schließlich noch das
neutrale Grau hinzu. Durch Übereinander- drucken dieser fünf Farben erhält man
insgesamt 14 verschiedene Farbtöne, das Schwarz kann man dabei auch durch
Übereinanderdrucken der drei Hauptfarben erzielen. In dem fertigen Druck kann
man dann mühelos die Druckplatten, in diesem Falle die Siebe, unterscheiden.
Ich liebe Drucke nicht, bei denen der Druckvorgang raffiniert und
undurchschaubar ist, sie mögen im Endeffekt noch so ästhetisch aussehen.
In diesem Zusammenhang sei auch angemerkt, daß ich es für
falsch und sehr abwegig halte, an die Kunst Forderungen im Sinne der Ästhetik
des 18. Jahrhunderts oder der Goethezeit zu stellen. Noch mehr verabscheue ich
den Ästhetizismus, der die Kunst zum ästhetischen Genußmittel degradiert. Ich
kann das Wort Ästhetik im Zusammenhang mit bildender Kunst nur im Sinne der
griechischen Aisthesis (= Wahrnehmung) gelten lassen. Denn tatsächlich hat die
bildende Kunst nur selten mit Schönheit zu tun, aber immer sind Wahrnehmungen,
Sinneseindrücke, Sinneserlebnisse oder Sinneserkenntnisse für die Kunst
Grundlage und Ausgangspunkt, und immer dokumentiert sich bildende Kunst in
sinnlich erfaßbaren, also wahrnehmbaren Gebilden. Die Bezeichnung "Schöne
Künste" für die bildenden Künste hat sehr viel Verwirrung gestiftet und
spukt auch heute noch in vielen Köpfen herum.
Der Siebdruck machte mir mehrere Jahre große Freude, die
allerdings durch Berge von Auflagen, auch wenn man sie auf 50 Stück
beschränkte, sehr getrübt wurde. Die Schubladen der Mappenschränke füllten sich
schnell. Man wächst zu, zu schnell. Die Frage: "Wohin damit?" taucht
bald auf.
Für die Bilder haben wir eine gute Lösung gefunden. Wir
haben im Parterre des Hauses, in dem unsere Atelierwohnung liegt, die ehemalige
Portierwohnung gemietet und als Bilderlager eingerichtet. Auch in ihr rücken
die Wände mit jedem abgestellten Bild näher zusammen. Da ich sehr wenig
verkaufe, fast gar nichts, wird die Produktion zu einem makabren Spiel, dessen
Ende vorauszusehen ist. Schließlich werde ich eines Tages nach neuen Räumen für
ein zweites Bilderlager suchen müssen. In dieser Beziehung geht es wohl fast
jedem Maler so, der nicht faul ist. Hier findet man oft den Grund dafür, daß
viele Künstler einen Teil ihres Werkes vernichten oder übermalen, um Platz zu
schaffen. Nicht immer ist Selbstkritik der Grund. Ein merkwürdiger circulus
vitiosus!: Warum die Bilder registrieren, wenn man
sowieso manche davon wieder vernichtet? Und warum dem Bild auf der Rückseite
einen Titel, eine Nummer und auf der Vorderseite eine Jahreszahl samt Signatur
aufpinseln, wenn man es später wieder übermalt? Warum die Bilder und die
sonstigen Arbeiten pflegen, wenn sie später doch nicht der eigenen Kritik
standhalten und man sie vernichtet oder übermalt? Diese Fragen tauchen schon
lange nicht mehr für mich auf. Ich halte es für besser, wenn andere sichten und
wegschmeißen, nachdem durch den Tod des Künstlers die Produktion abgeschlossen
ist. Ich selbst habe in der Phase I viele Arbeiten vernichtet. Ich redete mir
damals selbst ein, daß nur die besten Arbeiten übrigbleiben dürften. Heute
neige ich dazu, für diese zeitweilige Vernichtungswut den Platzmangel verantwortlich
zu machen, auch meinen damaligen Geldmangel. Ich habe erst 1955 den ersten
Mappenschrank kaufen können. Jetzt besitze ich vier, 27 Schubladen DIN A0 und
zehn DIN AI, und keine drei Schubladen sind mehr leer. Ich wundere mich nicht,
daß Picasso, der wohl produktivste Künstler der Neuzeit, aus den überquellenden
Ateliers einfach flüchtete und sich nicht mehr darum kümmern wollte. Eine sehr
bequeme Lösung!
In diesem Zusammenhang tauchte vor vielen Jahren die Frage
auf, was mit den zurückgelassenen Arbeiten nach dem Tode eines Künstlers wohl
manchmal passieren kann. Während eines zweiwöchigen Aufenthaltes in Florenz im
Jahre 1963 erlebten Cornelia und ich ein merkwürdiges Schauspiel, das uns
einigermaßen erschütterte. Wir bummelten ziellos durch die Straßen der Stadt.
Ein Lastwagen versperrte den Bürgersteig. Er stand dicht an einer
übermannshohen Mauer. Der Fahrer des Wagens stand hochaufgerichtet in der Tür
des Fahrerhäuschens und lenkte den Ladegreifer des Fahrzeuges über die Mauer.
Der Greifer kam zurück, hatte eine lebensgroße Gipsplastik zwischen den Zähnen,
drehte bis zur Ladefläche und ließ seine Beute aus eineinhalb Metern Höhe
fallen. Wir sahen noch vier- bis fünfmal Plastiken verschiedener Größe
erscheinen und zerschellen, bis wir weitergingen. Der Laderaum war dann fast
voll. Wir vermuteten, daß hier das Lebenswerk eines verstorbenen Bildhauers
für alle Ewigkeit zertrümmert worden war.
Meine Frage, die ich oben aussprach, wurde mir in Florenz
lapidar beantwortet. Hier lag sicher ein krasser Fall vor. Man könnte sich eine
mildere Version vorstellen; auch in diesem Falle haben vielleicht Verwandte
oder Freunde versucht, das Werk des Bildhauers zu erhalten, haben es jahrelang
gepflegt und auch versucht, die einzelnen Arbeiten an den Mann zu bringen, oder
haben gehofft, damit einiges Geld zu erraffen. Sie haben Jahr für Jahr einen
Raum ihres Hauses, ihrer Wohnung für die Aufbewahrung zur Verfügung gestellt
und dafür Miete gezahlt. Wenn solche Bemühungen jahrelang ohne Erfolg bleiben,
wirft spätestens die nächste Generation die ererbte Last über Bord; die
Müllkippe hat was zu fressen.
Es ist sicher nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn ich
behaupte, daß auf diese Weise wichtige künstlerische Aussagen nie bekannt
geworden sind. Wenn das Jugendwerk van Goghs in der Lumpenstampfe verschwinden
konnte, ist auch noch Schlimmeres möglich.
Man könnte auf den ersten Blick glauben, daß solche
Betrachtungen auf einen Künstler sehr depremierend und lähmend wirken. Ich
glaube das nicht. Angesichts der geschichtlichen Tatsachen scheinen Erfolg und
Mißerfolg zu Lebzeiten des Künstlers nicht über den Wert seiner Arbeit zu
entscheiden. Prinzhorn hat sicher in einem tieferen Sinne recht mit seiner
Theorie, die die hochgeschätzte Kunst, die primitivste Zeichnung, die
Kinderarbeit und vieles andere unter dem Begriff Gestaltung subsumiert und
dadurch vergleichbar macht, den Begriff Kunst aber ausklammert, weil dieser ein
Werturteil darstellt. Auch der Künstler hat es zunächst und primär mit Gestaltung
zu tun, ob und wie seine Wahrnehmungserlebnisse (im weitesten Sinne) in eine
sichtbare Gestalt gebracht werden können. Erst in zweiter Linie muß er sich um
die Qualität dieser Gestaltung bemühen.
Wie das Werturteil über das Werk des einzelnen Künstlers
zustande kommt, bleibt bis zu einem erheblichen Grade geheimnisvoll. Es wird ja
von niemandem gefällt. Es wird vielmehr vorsichtig ertastet. Es wird zunächst
von einem Experten mehr oder weniger vorsichtig ausgesprochen, erhält dann von
anderer Seite Zustimmung, der Kreis der Zustimmenden vermehrt sich, und
schließlich stimmt bestenfalls eine so große Gemeinde zu, daß - um ein Beispiel
zu nennen - van Goghs Sonnenblumen in jedem Jungmädchenzimmer womöglich neben
dem größten Kitsch hängen. Auf jeden Fall liegt hier ein diffiziler und
undurchschaubarer Vorgang vor, der auch zu Fehlurteilen führen kann. Das
Werturteil Kunst scheint auch oft dem Zeitgeschmack zu unterliegen.
Der Staat tut gut daran, wenn er von Kunstwerturteilen die
Finger läßt, aber gleichzeitig die Kunst in großer Breite fördert. Tut er das
nicht, läuft er Gefahr, sich bloßzustellen, zu zeigen, wes Geistes Kind er ist,
und sich zu blamieren. Das Naziregime hat das Urteil "Entartete
Kunst" erfunden und durchgesetzt. Diese politische und ideologische Aktion
- von einem Werturteil kann man da nicht mehr sprechen - hat die
Unmenschlichkeit und die Kulturlosigkeit des Regimes von vornherein aufgedeckt,
andererseits unermeßlichen Schaden angerichtet.
1973, nach der zweiten Herzoperation, war Cornelias Befinden
besorgniserregend. Ich verbrachte den größten Teil meiner Freizeit bei
Cornelia im Krankenhaus. Wenn ich überhaupt zum Arbeiten kommen wollte,
brauchte ich einen spontanen, lebendigen und anregenden Arbeitsvorgang. Ich
entschied mich fürs Collagie- ren; als Material benutzte ich die Fehldrucke,
die beim Siebdrucken angefallen waren. Durch die
herumliegenden Ausschnitte wurde ich angeregt, schwarzflächige Gliedmaßen und
Figurationen mit solchen zu kombinieren, die mit dem dünnen Federstrich auf
Weiß gezeichnet waren. In vier Wochen entstanden etwa 40 Collagen. Sie
wanderten in eine Schublade und wurden vergessen. Sie waren mir leicht von der
Hand gegangen.
Erst sechs Jahre später habe ich sie wieder ausgegraben.
Anlaß war eine kleine Ausstellung meiner Siebdrucke in der Societä Dante
Alighieri Berlin, die deren derzeitiger Präsident, mein Hochschulkollege Prof.
Dr. Hubertus Lossow, angeregt hatte. Er hatte schon für zwei meiner
Ausstellungen (Wilhelmshaven, Reinickendorf) die Eröffnungsreden gehalten und
ein Katalogvorwort geschrieben, wofür ich mich ihm sehr verbunden fühle. In der
Absicht, die Ausstellung etwas aufzulockern, suchte ich auch die
Siebdruckcollagen heraus. Beim Durchblättern wurde mir klar, daß mir in diesen
Arbeiten schon wenigstens eine partielle Lösung des Problems unterlaufen war,
das unterschwellig der eigentliche Anlaß zu dieser Collagenserie gewesen war:
die Vermischung mehrerer Abstraktionsgrade in einer Arbeit. Ich sah also diese
Collagen jetzt mit anderen Augen. Auch erinnerte ich mich, daß ich sie kurz
nach ihrer Entstehung Heinz Ohff gezeigt und dabei gemerkt hatte, daß er mehr
Interesse an ihnen hatte als ich. Ich dachte jetzt daran, im Sinne dieser
Collagen Bilder zu malen. Ich fing sofort ein Bild an und benutzte dafür eine
dieser Collagen als Arbeitsgrundlage. Das Resultat war zufriedenstellend, aber
auch beunruhigend, weil nun wieder ein Bild entstanden war, das von der einheitlichen
Gestaltung abrückte. Dieses Bild bekam den Titel "Die Wegelagerer"
(Abb. 14).
Die klassische Auffassung von Kunst verlangt eine
einheitliche Durchführung des Kunstwerkes hinsichtlich des Materials, der
Technik und der Gestaltung. In diesem Sinne sind z.B. die Kathedralenbilder
Monets einheitlich im Material (Ölfarbe), in der Technik (Farbauftrag, mit
Pinsel getupft) und in der Gestaltung (Umwandlung des Erscheinungsbildes in
Farbflecke). Nicht einheitlich in diesem Sinne sind z.B. Plastiken, die
verschiedene Materialien (eingesetzte Augen, Montagen) verwenden. Die Collage
hat sich die meisten Freiheiten gegenüber der Einheit des Kunstwerkes genommen:
Papiere und andere flächige Materialien, dazu die Strichzeichnung und die Farbe
und noch anderes hat sie in ein und derselben Arbeit durcheinander verwendet.
In der Collage haben die Zufälligkeit des gefundenen oder vorhandenen und die
Willkür des ausgewählten Materials, also die vollständige Negierung der
Einheit des Materials und der Technik (kleben, pinseln, zeichnen, schneiden,
reißen, usw.), zu einer selbstverständlichen Nicht-Einheit, zu einer aus Negation
erstandenen neuen Einheit geführt, die auf den Betrachter eine besondere
Lebendigkeit und Faszination ausstrahlt. Auch der Abstraktionsgrad kann in den
Collagen, muß sogar, bedingt durch die verschiedenen Materialien und die
verschiedenen Urheber der Einzelteile, dauernd wechseln.
Daß ich in meinen Bildern die klassische Einheitsforderung
schon 1965 durchbrochen hatte, indem ich den Gliederknoten in einem anderen
Abstraktionsgrad darstellte als die Umgebung (die Landschaft, die Tiere, die
Pflanzen und Bäume), habe ich schon weiter oben dargelegt. Auch in den neuesten
Collagen von 1973 war ich wieder einen Schritt in diese Richtung gegangen,
indem jetzt der Gliederknoten aus weißen und schwarzen Gliedmaßen zusammengesetzt
war, sich also in zwei verschiedenen Abstraktionsgraden bewegte. Und "Die
Wegelagerer" bekräftigten dies noch einmal, genauso die nachfolgenden
Bilder der Jahre 1979 und 1980.
1979 tauchte noch ein zweites Bild auf, das mich
beunruhigte: "Der kranke Maler" (Abb. 15). In ihm erschien der
menschliche Kopf wieder, der seit 1967 aus meinen Bildern verschwunden war. Ich
konnte mich zunächst mit diesem Bild nicht befreunden. Trotzdem hing es 1980 in
meiner Ausstellung beim Förderkreis im Haus am Lützowplatz zusammen mit den
"Wegelagerern" und den entsprechenden Folgebildern.
Bei der aus dem Stegreif gehaltenen Eröffnungsrede kam
Eberhard Roters im Zusammenhang mit den weißen und den nunmehr aufgetauchten schwarzen
Gliedmaßen auf die Zweipoligkeit des menschlichen Lebens und der Welt und auch
auf den römischen Gott Janus zu sprechen. Die dadurch in mir hervorgerufenen
Vorstellungen von dem doppelgesichtigen Januskopf brachten mich auf die
Vermutung, daß dieser Zweifachkopf von meinen Gliederknotenbildern ohne
Widerspruch angenommen werden könnte, weil er wie sie sein Dasein einer
anaturalistischen Vorstellung verdankt. Ich arbeitete dann 1980 ausschließlich
an Janusbildern. Das eine
Gesicht war in Weiß gehalten, das andere enthielt viel
Schwarz. Auch Cornelia begann, ein Janustriptychon in diesem Jahr zu weben.
Im Frühjahr 1981 kam Bewegung in die Janusköpfe, sie lösten
sich von den bekannten Vorbildern, und ihre Gesichter vermehrten sich.
Schließlich entwickelte sich ein Gebilde aus Köpfen und Gesichtern, das man
Kopfkonglomerat, Köpfeknoten, Köpfeknolle oder ähnlich benennen könnte (Abb.
16).
Ich vermutete, daß nun ein Weg vor mir lag, der mich aus der
langen Reihe meiner Bilder mit dem kopflosen Gliederknoten heraus zu etwas
Neuem führen würde, vielleicht zu einer differenzierteren Aussage über den
Menschen, vielleicht zu einer Art Personifizierung oder wenigstens zu einer
Typisierung oder zu etwas, was man eben nur malen und weder benennen noch beschreiben
kann. Ich spürte einen neuen Impuls, ich war in Aufbruchstimmung. Das Ziel lag
noch im Unbekannten.
Instinktiv und triebhaft versuchte ich, Kopfhäufungen zu
zeichnen und zu malen, spürte, daß ich zu einer Aussage über meine Zeitgenossen
kommen könnte, malte in meiner Begeisterung sogar ein kleines Zcitge-
nossentriptychon.
Bei diesen Arbeiten tauchten neue Gedanken, besser gesagt:
Vorstellungen auf, wie ich die Vermischung verschiedener Abstraktionsgrade in
meinen Bildern noch weiter als bisher treiben könnte. Mir schwebte
vor, verschiedene Gestaltungsarten und Stilrichtungen, die man ja alle als
verschiedene Abstraktionsgrade bezeichnen kann, in einem Bilde zu vereinigen.
Realistische, tachistische, impressionistische, expressionistische, kubistische,
vielleicht auch kitschige, gebrauchsgraphische und beliebig andere Elemente
müßten sich in einem Bild verwenden lassen, wobei ich hoffte, daß die Quantität
der Dissonanzen zwischen den gehäuften künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu
einer neuen Qualität der Einheit führen würde. Ich hatte schon 1981 mit einer
gewissen Vorsicht angefangen, dies zu versuchen. Dabei habe ich nur Elemente
aus meinen eigenen, oben näher dargelegten Entwicklungsphasen in einigen
Zeichnungen oder Aquarellen, zuletzt auch in Bildern zu vereinigen versucht.
Ich fand die Ergebnisse nicht sonderlich spektakulär. Sie wirkten eher
selbstverständlich, harmlos, als ob es das schon immer gegeben hätte. Es mag
sein, daß ich hier nicht zuständig bin. Ich habe mir diese neue Möglichkeit so
oft vorgestellt, daß die Verwirklichung womöglich keine Überraschung für mich
sein kann. Die nächste Zeit mußte zeigen, ob ich einen brauchbaren Weg
eingeschlagen hatte.
Meine Gedanken kreisten immer wieder um die Richtung, die
mein künstlerischer Weg nun nehmen sollte. In meiner Arbeit habe ich mich stets
unabhängig gefühlt, unabhängig von dem, was gerade "in" war, unabhängig
vom Urteil anderer über meine Arbeit, obgleich mich jedes Urteil sehr
interessiert, unabhängig von der vielgepriesenen Einheit eines Lebenswerkes.
Drei sehr deutliche Bruchstellen habe ich in meinem Werk zugelassen. Ich
wundere mich manchmal, daß die Phase IV immer noch anhält. Anscheinend ist da
noch viel drin.
Die Frage, ob ich in meinen Gestaltungen einer zu starken
Gebundenheit anhänge, ist immer wieder aufgetaucht. Kann man die Freiheit und
Ungebundenheit in der Arbeit nicht weiter treiben als ich es getan habe? Weiter
bis ins Grenzenlose? Zweifellos liegen die Grenzen in der Person des Einzelnen
begründet. Kreist nicht in jedem einzelnen Menschen ein besonderer, nur ihm
eigener Kosmos von Gefühlen, Empfindungen, Gedanken, Erkenntnissen, Vorlieben,
Prinzipien usw., der in seinen Abläufen und Bewegungen besonderen, zwingenden
Gesetzen unterliegt? Dieser Kosmos ist doch wohl der Urgrund, aus dem die
spezifische persönliche Leistung erwächst!? Natürlich unterliegt ein solcher
Kosmos auch Einflüssen aus Gesellschaft und Umwelt Wenn es gelingen würde, sich
nur diesen eigenen Gegebenheiten und Einflüssen zu überlassen, könnte man
einen hohen Grad von persönlicher, auch künstlerischer Freiheit erreichen, die
auf keine althergebrachten oder zeitbedingten Vorurteile und Meinungen
Rücksicht nimmt. Und wenn ich auf die Idee gekommen bin, alle oder bestimmte
künstlerische Aussagen gewesener oder vorhandener Stile in meinen Bildern zu
verwenden, falls sie mir nur in meine Intentionen passen, sollte ich sofort zur
Tat schreiten. In solcherart konzipierten Bildern würde ein Stilwirrwarr, ein
Antistilismus, ein Stilanachronismus, ein Sammelsurium von Stilen und Stilismen
zustande kommen, in ihnen würde es von "Stilfehlern" nur so wimmeln.
Auch "wörtliche" oder sinngemäße Zitate aus fremden Bildern dürften
dabei nicht fehlen.
Im Zusammenhang mit diesen kunstanarchistischen Gedanken interessierte
mich, ob nicht schon andere Maler in ihren Arbeiten von dieser alten Forderung
nach der Einheit des Kunstwerkes abgewichen sind. Und da war tatsächlich
manches zu finden.
Picasso hat in seinen "Demoiselles d'Avignon" ein
markantes Beispiel gegeben. Unter seinen Portraits finden sich einige, die
anscheinend unvollendet blieben: Der Kopf ist in ihnen ganz und gar
durchgemalt, während sich der Körper "nur" in linienhafter Zeichnung
darbietet. Man darf nicht vermuten, daß der Künstler aus einer Laune, aus
einem Zufall, aus Übermüdung oder gar aus Desinteresse das Bild in diesem
Zustand beließ. Vielmehr ist anzunehmen, daß dieser Zwischenzustand bewußt zum
Endzustand erklärt wurde, weil gerade die beiden auseinanderklaffenden
Abstraktionsgrade dem Bilde eine besondere Spannung, einen besonderen
Ausdruck verleihen, der anders nicht zu erreichen ist.
Marc Chagall hat sich auf eine besondere Art eine grenzenlos
künstlerische Freiheit geschaffen. In seinen Bildern ist alles anders als in
der Wirklichkeit. Die sich selbständig machenden Geigen, Uhren, Pferdewagen
usw., die durch die Luft schweben, die Violinbögen, die eine Hand führt, die zu
niemandem gehört, die Köpfe, die in respektvoller Entfernung vom Körper in der
Luft herumtorkeln, oder der Soldat, vor dem auf dem Tisch er selbst und seine
Braut als winzige Puppen einen Tanz aufführen usw. - das alles stellt die
normalen Größen-, Raum- und Zeitverhältnisse der Erscheinungswelt auf den Kopf.
Durch den Bruch mit der realen, der kausalen Welt ist dem Maler nun alles
erlaubt. Er hat eine größtmögliche Freiheit erreicht, er ist frei und unabhängig
von den Zwängen des Sehbildes, frei von dessen Räumlichkeit, von seinen
Zusammenhängen und Maßverhältnissen. Und der Betrachter Chagallscher Bilder
macht willig und gläubig mit, er findet die Bilder märchenhaft.
Eine bewundernswert große Freiheit hat Picasso erreicht. Er
machte sich nicht nur allgemein frei von den Sehbildern, er war auch frei von
den eigenen Findungen und Erfindungen. Er konnte daher immer wieder neue und
andere Wege in seiner Arbeit gehen. Viele haben ihm seine
"Stilbrüche" übelgenommen, aber gerade diese waren die
Durchbruchstellen in die Freiheit. Man sollte Picasso gerade deswegen, weil ihm
so viele Durch- brüche zur künstlerischen Freiheit gelangen, hoch schätzen,
und jeder sollte sich hüten, primitive Sprüche wie "Schuster, bleib' bei
deinen Leisten" auf Künstler anzuwenden.
Etwa seit 1982 habe ich meine Scheu, aus den Bildern anderer
frei oder "wörtlich" in meiner Arbeit zu zitieren, überwunden. Ich
fühle mich nun frei, als ob sich endlich eine Schleuse geöffnet hätte, die
schon einige Zeit den Fluß meiner Arbeit teilweise behindert hatte. Ich bin
mitten in einem Arbeitsprozeß, der eine zunächst nur vage vorhandene
Gestaltungsidee oder - Vorstellung zu Klarheit und Aussagefähigkeit entwickeln
soll. Ich nehme an, daß dies noch einige Zeit dauern kann. Dieser Prozeß könnte
auch in einen anderen übergehen. Wenn er abgeschlossen werden kann, wird eine
gewisse Zeit ruhiger Produktion folgen, eine Erntezeit, in der die Bilderstapel
wachsen. Aber auch solche Zeiten ruhiger Produktion bleiben lebendig, weil sich
immer wieder unter den Händen neues oder anderes anbahnt. Das liegt in der
Natur künstlerischer Arbeit, weil diese in keinem Augenblick auf das
Schöpferische verzichten kann.
Eine im Künstler vorhandene Unruhe hält sowohl den
Verstandes- und gefühlsmäßigen Denk- und Vorstellungsprozeß als auch den
Prozeß der praktischen Arbeit an der Staffelei und am Zeichentisch ständig im
Fluß. Beide arbeiten Hand in Hand: Was gedacht oder vorgestellt wird, muß
beinahe gleichzeitig praktisch getan werden. Einzeln können sie in der
künstlerischen Arbeit nicht existieren. Gedanken und Vorstellungen bleiben
blaß, solange sie die praktische Arbeit nicht in die Sichtbarkeit hebt. Und die
praktische Arbeit wird schnell mechanisch und stumpfsinnig, wenn sie nicht
dauernd aus der Gedanken- und Vorstellungswelt lebendige Impulse,
Variationsanregungen und Richtungshinweise erhält.
Seit 1982 ist eine Serie von Bildern entstanden, die ich
Zeitgenossen nenne. Diese Zeitgenossenbilder betrachte ich als Portraits, aber
nicht in der althergebrachten Bedeutung dieses Wortes (Abb. 17). Ich benutze
dazu keine Modelle. Das einzelne Bild zeigt also nicht eine tatsächlich
vorhandene, abkonterfeite Person, sondern lediglich einen von mir erfundenen
Menschen (Mann oder Frau), der vordergründig eine oder mehrere Eigenschaften
oder Eigenarten, vielleicht auch nur belanglose Äußerlichkeiten zeigt, der
aber gleichzeitig hinter dieser Fassade eine Vielfalt besitzt, die ihn
interessant, unerklärlich, geheimnisvoll, unheimlich, wunderlich oder auch noch
anders erscheinen läßt.
Um diese Vielfalt im Bilde ablesbar zu machen, kamen mir
unter anderem meine weiter oben geschilderten Überlegungen und Versuche der
Stilvermischung zu Hilfe. Besonders spielt sich am Bildort des Kopfes eine mehr
oder weniger verwirrende, kaleidoskopartige Vielfalt von Köpfen
unterschiedlicher Gestaltung ab. Ein meist in Weiß gehaltener Kopf, der, ähnlich
wie beim üblichen Portrait, das Bild beherrscht, ist von verschieden geformten
Köpfen oder Gesichtern umgeben, die sich mehr oder weniger zurückhalten oder
vordrängen. Ich kann diese Köpfe selbst erfinden oder Bildern anderer
entnehmen, ich kann sie nehmen, woher ich will, aus der Kunst unseres
Jahrhunderts oder früherer und frühester Zeiten, auch aus der Trivialkunst
unserer Tage, sie lassen sich in meine Bilder einpassen, ohne zu stören. Bei
der Kleidung der vorgestellten Person versuche ich, eine Vielfalt zu erreichen,
die dem reichen Inhalt eines heutigen Kleiderschrankes entspricht. Genauso
könnte ich auch mit der Umgebung der dargestellten Person verfahren. Doch alles
hat seine Grenzen. Auch meine Vorliebe, meine Bilder bis zum Platzen zu füllen.
Bilder müssen auch Namen bekommen. Meine Zeitgenossen habe
ich in der umgekehrten Buchstabenreihenfolge des Alphabetes benannt, also
nicht von A bis Z, sondern von Z bis A. Da man sich aber unter dem Bildtitel
"Zeitgenosse L" kaum das Bild selbst einprägen kann, habe ich den
einzelnen Zeitgenossen auch durch einen kurzen zusätzlichen Satz zu
charakterisieren versucht, der aus einer im Bilde sichtbaren Besonderheit
oder Eigenschaft des Dargestellten hergeleitet ist. Die drei ersten
Zeitgenossenbilder, die die Titel "Zeitgenosse Z pflegt zu dozieren",
"Zeitgenosse Y geht gern spazieren" und "Zeitgenosse X startet
eine Friedenstaube" erhalten haben, zeigen eine dozierende Hand, einen
Spazierstock bzw. eine Friedenstaube. Diese Titel sagen natürlich nicht viel über
die dargestellte Person, die auf dem Bild womöglich geheimnisvoll,
undurchschaubar, hintergründig ist, aber sie sagen, was auf den ersten Blick
sichtbar ist (Abb. 18).
In meinen Aufzeichnungen habe ich wahrscheinlich dem Leser
eine ganze Menge zugemutet, wenn ich versuchte, ihm die Vorgänge, die sich im
Maler, also hier in mir abspielten, zu schildern. Denn diese sind ja nicht so
vordergründig und gradlinig, daß sie sich auf eine einfache und eingängige Art
beschreiben ließen. Sie spielen sich meistens im Unbewußten und im Unterbewußten
ab, entziehen sich der Ratio und können oft nur rückblickend anhand der
entstandenen Bilder rekonstruiert werden. Oft machen sie auch unerwartete
Sprünge und sind nicht logisch untereinander verbunden. Man sollte deswegen
den manchmal unlogischen, sprunghaften, unzusammenhängenden oder verschwommenen
Äußerungen von Künstlern zugutehalten, daß die Vorgänge der künsüerischen
Arbeit anders ablaufen, als sie mit den Mitteln der Sprache beschrieben werden
können. Die hier von mir gegebenen Beschreibungen habe ich gewagt, weil ich
dem Leser nicht vorenthalten wollte, auch in dieses wahrscheinlich aufregendste,
interessanteste, für den Künstler oft zermürbende Gebiet Einblick zu nehmen.
Die dauernde Zwiesprache zwischen Bildvorstellungen und den
Bildern selbst in statu nascendi ist der wichtigste, der wesentliche, der
geistige Teil der künstlerischen Arbeit. Die Vorstellungen und die entstehenden
Bilder müssen durch harte Arbeit allmählich in Übereinstimmung gebracht bzw.
einander angenähert werden. Formale Unstimmigkeiten zeigen die Diskrepanz
zwischen beiden. Ist die Vorstellung formal nicht zu bewältigen, ergeben sich
zwiespältige Bilder, die wohl gut in eine Entwicklungsreihe hineinpassen, aber
als Einzelbild nicht zufriedenstellend sind. Sie zeigen aber den Weg und deuten
auf das Ziel. Wird das Ziel nicht erreicht oder wird es aufgegeben, hat sich
höchstwahrscheinlich die Vorstellung des Künstlers geändert, oder die Zeit ist
noch nicht reif, die entstandene Problematik zwischen Vorstellung und
Verwirklichung zu bewältigen.
Meist wird die Problematik verstandesmäßig erkannt, während
die Lösung gefühlsmäßig und tastend gefunden werden muß. Vielleicht liegt hier
das Wesen der Intuition. Wahrscheinlich hat man sich deswegen von jeher die
Muse nur als gefühlsbetontes, sensibles weibliches Wesen vorstellen können.
Die vielen gefühlsmäßigen Entscheidungen, die ich bei meiner
Arbeit zu treffen habe, sind oft der Grund dafür, daß ich bei gezielten Fragen
nicht genau sagen kann, aus welchem Grunde in meinem Bilde dieses oder jenes so
und nicht anders gemacht ist. Hier ist das Gefühl dem Verstand vorausgeeilt,
und die Lösung ist für den Verstand noch nicht einsichtig.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir oft die Frage, ob ich
während der Arbeit überhaupt noch ich selbst sei oder ob vielmehr eine mir
unbekannte Kraft mich als Werkzeug benutzt, um Bilder und Gleichnisse in Erscheinung
treten zu lassen, die einem Menschen normalerweise gar nicht einfallen können.
Meine Arbeit führt zwar kaum zu Rauschzuständen, aber sie entwickelt manchmal
eine einzigartige Eigendynamik, die mich mit sich fortreißt, mich führt und
verführt. Am Ende dieses Zustandes scheinen die Stunden zu Minuten
zusammengeschmolzen zu sein. Hier ist eine Erklärung zu finden, daß ich
manchmal nahezu hilflos bin, wenn ich mich aus der Arbeit herausreißen soll, um
ansprechbar zu sein oder um Termine oder Verabredungen einzuhalten.
In der Kunst gibt es eine Grenze allen Erklärens und
Deutens, hinter der das ungelöste Geheimnis liegt, wie immer wieder neue, nie
gesehene Bilder in die Sichtbarkeit aufsteigen. Alle Deutungs- und
Erklärungsversuche müssen wohl oder übel vom Endergebnis Bild ausgehen und
enden dort, wo eine schriftliche oder verbale Äußerung des Autors vorliegt. Nur
ein Teil des Bildwerdens ist also erfaßbar, wahrscheinlich nur eine kurze
Endphase. Ich weiß, daß es mir auch nicht gelingt, tiefer vorzudringen. Der
letzte Abschnitt meiner Niederschriften hat es bewiesen. In ihm habe ich
versucht, Bilanz zu ziehen, die Bilanz meiner Malerei, nicht die Bilanz meines
Lebens. Das müßte ein anderer als ich tun, wenn mein Leben eines Tages zu Ende
ist. Dieses Ende ist mir an dem Punkt, den ich jetzt erreicht habe (1984),
schon lange vertraut und vorstellbar. Nicht so das Ende meiner Malerei. Denn
diese scheint mir ohne Ende zu sein, weit und unermeßlich wie das Weltall. Sie
scheint mir immer jung und neu. Ich habe nicht den Eindruck, daß sie von mir
abhängig ist. Eher bin ich von ihr abhängig. Sie kann auch nicht durch mich
oder meinen Tod beendet werden. Sie ist ein Quell, der unermüdlich fließt und
mich zur Arbeit treibt. Dieser Quell spendet eine solche Fülle von
Vorstellungen, die in die Sichtbarkeit drängen, daß mir die Zeit nicht reicht,
alle zu verarbeiten. Diese Fülle macht mich klein und demütig, denn sie scheint
mir so unermeßlich groß, daß sie durch alle Zeiten bis in alle Ewigkeit fließen
kann. Sie ist aber für uns nur zu bemerken, wenn einer da ist, der wenigstens
Teile davon ins Sichtbare hebt. Wenn er nicht mehr ist oder seine Kraft
erlischt, fließt sie weiter, aber ohne Belang für uns, weil sie nicht mehr
unser Bewußtsein erreicht.
Der letzte Teil meiner Aufzeichnungen hat mich viel
Selbstüberwindung gekostet und mir viel Arbeit abverlangt, weil ich keine
Erfahrung im Schreiben habe. Er ist für mich der wichtigste Abschnitt der
Biographie, weil meine Malerei zweifellos den größten Teil meines Lebens
beansprucht hat und weil ich während des Schreibens festgestellt habe, daß
sich der Sinn meiner künstlerischen Entwicklung, dieses langen Weges mit
seinen Brüchen und Knickungen, in meinen letzten Bildern zu offenbaren beginnt.
Eine große Schwierigkeit, meinen Beschreibungen zu folgen,
wird sich für den Leser ergeben haben, der meine Bilder nicht näher kennt und
nur wenige im Original gesehen hat. Ich hoffe jedoch, daß ich vieles, was zur
Entstehung und zur Gestalt meiner Bilder beigetragen hat, ohne in ihnen
unmittelbar sichtbar zu werden, mit meinen Worten aufzeigen oder wenigstens
ahnbar machen konnte.
"Künstler, bilde! Rede nicht!" Ich stimme diesem
Wort weitgehend zu, bin aber doch der Meinung, daß das geschriebene und
gesprochene Wort manchmal vor Bildern ganze Barrikaden abbauen kann, die den
Blick des Betrachters behindern, auch wenn - in diesem Fall - der Schreiber
nicht über die Wortgewalt eines Literaten, eines Schriftstellers oder gar
eines Dichters verfügt und zudem noch sein Leben lang mehr seinem Gefühl und
seinen Empfindungen vertraut hat als seinem logischen Denkvermögen.
Teneriffa (Nachtrag von 1990)
1984 glaubte ich, diese
Biographie abgeschlossen zu haben. Seither sind sechs Jahre vergangen. Einige
meiner Freunde wollten die Biographie lesen; von ihnen kam die Anregung, einen
Verlag für den Druck zu interessieren. Ich habe es versucht, habe aber keinen
Erfolg gehabt. Mein Buch sei zu persönlich, und es sei zu einseitig auf meine
Familie, auf meine Malerei, auf Kunstpädagogik und Hochschule zugeschnitten; es
würde daher nur einen kleinen Abnehmerkreis finden. Ich gab mich damit
zufrieden. Denn ich hatte ja das Buch ursprünglich für mich selbst geschrieben,
gewissermaßen als Selbstanalyse, als einen Rechenschaftsbericht über mein
bisheriges Leben und meine Arbeit.
Um so dankbarer bin ich nun der Hochschule
der Künste, daß sie das Buch drucken will. Mein Dank gilt insbesondere dem
Präsidenten der Hochschule, Ulrich Roloff-Momin, und dem Pressereferenten,
Rainer E. Klemke. Durch ihre Zustimmung zur Drucklegung erfährt nun meine 16
Jahre zurückliegende Tätigkeit als Hochschullehrer eine Anerkennung, die ich
dankbar als Selbstbestätigung empfinde.
Früher habe ich schon
über unser Haus in San Andres auf Teneriffa einiges geschrieben, ohne zu ahnen,
daß es unser Haus in Vodice auf Cres wenig später ersetzen würde. Vier Faktoren
machten den Wechsel nach Teneriffa erforderlich:
1954
Die Ursprünglichkeit der Insel Cres
war durch den krebsartig gewachsenen Tourismus verloren gegangen.
1955
Unsere von Jahr zu Jahr länger
werdenden Aufenthalte in San Andres hatten bewiesen, daß das sanfte Klima
Teneriffas Cornelia hervorragend gut bekam, während sie sich in dem Reizklima
auf Cres nie ganz wohlfühlen konnte und oft darunter leiden mußte.
1956
In den Jahren 1980 bis 1985 merkte
ich während der Autofahrten von Berlin nach Cres und zurück, daß meine
Konzentrationsfähigkeit und mein Reaktionsvermögen stark nachließen. Ich
ermüdete schnell und reagierte in gefährlichen Situationen zu langsam. Ich zog
die Konsequenz, das Auto abzuschaffen. Es tat mir nicht weh. Reisen nach Cres
ohne Auto sind unbequem, zeitraubend und kräfteverschleißend.
1957
Drei Wohnsitze auszufüllen, nämlich
Berlin, Cres und Teneriffa, wurde mit zunehmendem Alter immer beschwerlicher.
Wir mußten Cres
aufgeben.
Wir verabschiedeten uns
von unseren Inselfreunden, indem wir ihnen am Sommerende 1984 im Hotel Kimen in
der Stadt Cres ein Essen gaben. Dieser Abend hat uns erfreut und zugleich
erschüttert. Die ungefähr 40 Gäste brachten ihre Verbundenheit mit uns und ihre
Freundschaft mit solcher Herzlichkeit und Wärme zum Ausdruck, daß wir unseren
Entschluß, diese Insel nie wiederzusehen, plötzlich ganz anders sahen. Der
Pfarrer hielt eine lange Rede, eine Bäuerin aus Vodice hatte eine Rede
schriftlich verfaßt, konnte sie aber nur unter Schwierigkeiten halten, weil
ihre Stimme immer wieder in Tränen erstickte. Ich selbst hatte auch Schwierigkeiten,
meine Rührung zu unterdrücken, als ich auf die Reden antworten mußte.
Mehrere Jahre habe ich
noch gezweifelt, ob der Entschluß, Cres aufzugeben, richtig war. Ich habe
dieser Insel viel zu verdanken, nicht nur in künstlerischer Hinsicht. Besonders
das paradiesische Leben in dem Hirtengehöft von Sveti Blaz (1965 bis 1970) und
der dort erfolgte Aufbruch zu neuen Bildern bleiben unvergessen. Unser Freund
Nikola Sucic ist 1987 mit 88 Jahren gestorben. Seit diesem Jahr verloren meine
Bindungen zu Cres ihre Kraft Und meine Zustimmung zu den längeren Aufenthalten
auf Teneriffa war nun endgültig. Der immer wieder notwendige Abschied von
dieser sanften Insel fällt mir heute immer schwerer. Aber Berlin hat eben einen
großen Stellenwert für mich behalten. Hin und wieder ziehtes mich ohne
besonderen Grund nach Berlin. Zwingende Gründe sind, alte Freunde
wiederzusehen, die kulturellen Einrichtungen zu nutzen und für die Pflege des
Ateliers, der Wohnung und des Bilderlagers zu sorgen.
Heute, sechs Jahre nach
dem Abschied von Cres, haben wir uns mit Teneriffa ganz und gar befreundet. Wir
sind glücklich darüber, daß sich Cornelias Gesundheit in der sanften Luft, in
der warmen Sonne und dem ausgeglichenen Luftdruck gefestigt hat. Sie fühlt
sich dort meistens fast wie ein gesunder Mensch. Bei unseren wiederholten
gemeinsamen Berlinaufenthalten traten immer die alten Beschwerden wieder auf,
so daß sie nur noch selten nach Berlin kommt. So müssen wir uns jetzt öfter für
längere Zeit trennen, was wir bisher immer vermieden hatten.
1987 erkrankte ich in Teneriffa schwer. Der Hausarzt
verordnete Bettruhe und Antibiotika. Nach zwei Wochen wurde ich in die Clinica
Parque in Santa Cruz gebracht. Die Diagnose lautete: Endokarditis. Die
Bombardierung mit Antibiotika hatte keinen Erfolg. Nach zehn Tagen war ich
merklich geschwächt, und ich hatte mich auch schon selbst aufgegeben. Ich war
überzeugt, daß mein Leben zu Ende ging. Die Betreuung in der Klinik war
schlecht. Die Ärzte wirkten ratlos, als keine Besserung eintrat. Cornelia war
verzweifelt. Unser Sohn Heinz-Jürgen riet zu sofortiger Abreise nach Berlin,
organisierte innerhalb eines Tages Flugkarten für Cornelia und mich nach
Hannover, einen Krankenwagen von Hannover nach Berlin und die Aufnahme im
Krankenhaus Moabit. Dort wurde bald erkannt, daß die Diagnose
falsch war. Weitere Untersuchungen brachten dann einen fast kinderkopfgroßen
bösartigen Tumor zum Vorschein. Tumor und Milz wurden operativ entfernt. Am
15. Mai konnte ich das Krankenhaus mit 20 Kilogramm Gewichtsverlust verlassen
und erholte mich schnell. Den beiden behandelnden Ärzten Prof. Schüren und
Prof. Kraas fühle ich mich in großer Dankbarkeit verbunden. Die Pflege war
hervorragend und vorbildlich. Seither führt mich alle acht bis neun Monate ein
weiterer Grund nach Berlin: Die Krebsnachsorgeuntersuchung.
Das Dorf San Andr6s besitzt kein Hotel oder sonstige
Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist daher vom Massentourismus verschont
geblieben. Dies verdankt es der spanischen Militärbehörde, an der die Versuche,
hier Hotels zu bauen, gescheitert sind. Grund hierfür ist ein Hügel an der
Küste, der vom Militär besetzt ist und zwei Kanonen besitzt - ein Überbleibsel
früherer Zeiten, als so eine Einrichtung noch den Hafen schützen konnte. Der
einzige schon weit gediehene Plan eines Hotelbaues bescherte dem zwei
Kilometer langen Stand von San Andres, der Playade
lasTeresitas, weißen Sahara-Sand, der mit Schiffen hertransportiert wurde.
Dieser flache Küstenstreifen wird an Sonn- und Feiertagen von der Bevölkerung
der Hauptstadt Santa Cruz, die nur sechs Kilometer entfernt ist, als Badestrand
benutzt.
Die von Santa Cruz kommende Küstenautostraße ist in beiden
Richtungen zweispurig ausgebaut und in der Mitte und an den Seiten mit Palmen,
Oleandern und Drachenbäumen bepflanzt. Vor dem Dorf San Andres teilt sie sich;
der rechte Abzweig läuft durch die Playa de las Teresitas und dann auf den
Bergen an der Küste entlang bis Igueste, der linke Abzweig mitten durchs Dorf
und in etwa 100 Meter Entfernung an unserem Haus vorbei über das Anagagebirge
nach Taganana auf der Nordseite der Insel. Der Autolärm ist für uns unerheblich.
Unser Haus liegt nicht allzuweit, nur etwa 10 Kilometer, von dem östlichen Ende
Teneriffas entfernt. Die Insel mißt in west-östlicher Richtung 70 Kilometer.
Der Hauptverkehr spielt sich daher anderswo ab.
San Andres fing vor einigen Jahren an, in seinen noch
unbebauten Barranco, ein in die Berge tief eingeschnittenes Tal,
hineinzuwachsen. Zunächst wurde im Barranco ein Flußbett mit Riesensteinen
ausgepflastert, auf dessen rechtem Ufer ein Palmenpark und schon vier größere
Gebäude entstanden sind: Ein Gemeindehaus und eine Berufsfachschule sind schon
fertig, von den anderen steht der Rohbau. Auch viele Wohnhäuser sind
hinzugekommen. Die Hütten eines kleinen Slums, der früher das Ende des Dorfes
im Barranco bildete, sind weggefegt. Ihre Bewohner wurden in ein Hochhaus in
Santa Cruz verfrachtet. Ob sie dort glücklicher sind?
Am rechten Barranco-Ufer liegt der alte Teil von San
Andres. Der jüngere Teil ist dahinter einen steilen Berg
hinaufgewachsen. Die Häuser haben sämtlich eine kubische Form, sind auf
einfachste Weise aus gegossenen Hohlsteinen gebaut, meist im Eigenbau, und
sind nur über Treppen zu erreichen, die obersten über 300 und mehr Stufen. Das
Baumaterial einschließlich Wasser ist mit Menschen- und Eselskraft
hinaufgetragen worden. Jetzt sind diese Häuser mit Wasser und Elektrizität
ausgestattet. Die Bewohner waren ursprünglich Fischer und Bauern, jetzt finden
sie meistens in den Städten Santa Cruz und La Laguna ihre Arbeit.
Das neue Flußbett ist fast das ganze Jahr ohne Wasser, in den
regenreichen Wintermonaten nur wird es zum rauschenden und reißenden
Gebirgsbach. Alles sieht jetzt schon viel zivilisierter aus als früher, als der
Barranco in seinem Urzustand noch als Ablage für Großmüll wie Autokarosserien,
unbrauchbare Kühlschränke, Fahrräder, Kinderwagen usw. benutzt wurde und das
Wasser der Regenzeiten sich selbst den Weg zum Meer suchte und große
Wasserpfützen hinterließ, in denen die Kinder in Holzbottichen die Seefahrt
probten. Auch die Ziegenherde zottelt und bimmelt jetzt nicht mehr durch den
Barranco, und die zum Lastentragen benutzten Kamele und Esel sind aus dem
Dorfbild verschwunden. Alles ist jetzt zivilisierter. Aber nicht lebendiger und
interessanter.
Die Vegetation Teneriffas ist nahezu exotisch. Allerdings
kann sie sich nur deswegen hier so gut entwickeln und halten, weil die Insel
viel Wasser und im Winter starke Regenfälle hat. Die wüstenartigen Gebiete, die
im Sommer grau und vertrocknet aussehen, können im Winter in zwei bis drei
Wochen grasgrün werden. Das übliche sommerliche Erscheinungsbild scheint an diesen
Stellen wie ausgewechselt. In mittleren Höhen findet man eine üppige Vegetation
das ganze Jahr über. Die vielen Grünvariationen sind überwältigend schön. Das
Anagagebirge, das gleich hinter unserem Haus aufsteigt, ist im heißesten Sommer
eine grüne Hölle, in der herumzustreifen ein besonderes Erlebnis für einen
Maler ist.
Die Attraktion der Insel bleiben die Canadas am Fuße des
Teide, des höchsten Berges Spaniens, der meist das ganze Jahr über eine
schneebedeckte Spitze zeigt. Die riesigen Lavafelder, die bizarren,
abwechslungsreichen Gesteinsmassen und Bergformen, meist ohne Vegetation,
vermitteln immer noch eine beeindruckende Ahnung von den Naturgewalten, durch
die diese Insel entstanden ist. Besonders lohnend ist ein Besuch der Canadas
im Frühjahr, wenn die Vegetation in den Geröllmassen erwacht und überall durch
große Kissen von Blumen in knalligem Gelb, zartem Blau und gedämpftem Weiß
lebhafte Akzente in das zurückhaltende Graubraun setzt.
Unser Haus und unser Garten liegen an einem ziemlich steil aufsteigenden Berghang am linken Ufer
des Bar ranco, also dem Dorf gegenüber. Ich habe mich in zurückliegenden
Jahren im Garten als Maurer betätigt und Trockenmauern und viele Stufen gebaut.
Jetzt sind wir dabei, die Treppen mit Handläufen aus Wasserrohren zu versehen.
Die Maurerarbeiten erledigen Cornelia und ich, während sich unser Sohn der
Rohrlegerarbeiten annimmt. Wir sorgen schon fürs Alter vor. Wir wollen auch
dann, wenn wir älter und wackliger sind, noch im Garten herumklettern. Ich
spüre deutlich die belebende Wirkung des Gartens, wenn ich in einer
Arbeitspause für einige Minuten zwischen den exotischen Gewächsen umhergehe
und nach Süden die ruhige Horizontlinie des Meeres und nach Norden die
aufregenden Zacken des Anagagebirges sehe.
Unser Garten
ist, weil er künstlich bewässert wird, das ganze Jahr grün. Er ist
pflegeleicht, weil wir die einheimischen Pflanzen bevorzugen: verschiedene
Arten von Aloe, Agaven, Opuntien, Kakteen, Zypressen, Nadel- und Gummibäume,
Zitronen, Mandarinen, Weihnachtssterne, Drachenbäume, Mimosen, Palmen, Bambus,
Hibiskus, Teresiten, Bougainvillea, Oleander und die unermüdlichen Geranien.
Der Garten wächst und blüht ohne Pause. Das Beschneiden wird zum Problem, nicht
das Pflanzen. Und zwischen all diesem vegetativen Vielerlei schleichen,
spielen, huschen, springen, klettern, miauen, schreien, kreischen, balgen sich
unsere Katzen oder schmusen um unsere Beine. Oft werde ich an die von Tieren
belebten Dschungelbilder Henri Rousseaus erinnert.
1988 haben wir
in unserem Wohnraum an der Stelle, wo der Tisch steht, an dem wir die drei
Tagesmahlzeiten halten, ein etwa zwei mal zwei Meter großes Fenster einbauen
lassen. Wir können dadurch, bei welchem Anlaß auch immer wir an diesem Tisch
sitzen, die gleiche Aussicht genießen, die sich auch von der großen Terrasse
aus darbietet. Wir sehen über den Barranco auf das Dorf und links daneben übers
Meer, auf dem fast immer Schiffe oder Boote zu sehen sind. In der Bucht von S
an Andr6s ankern täglich einige große Tanker oder Frachtschiffe. Bei Dunkelheit
und nachts entwickelt der Ausblick einen besonderen Zauber, wenn die Lichter
des Dorfes leuchten und die Riesentanker ihre großzügigen Warnbeleuchtungen
angemacht haben, die den Eindruck von schwimmenden Lichterbäumen erwek- ken.
Wenn dann zu den Sternen darüber sich noch der Abendstern, die Mondsichel oder
gar der Vollmond gesellt, kann man leicht an eine übertrieben schön gestellte
Theater- oder Filmkulisse denken.
Das äußere
Erscheinungsbild Teneriffas ist sehr viel anders als das von Cres. Cres ist
durch Faltung entstanden und hat in den hochgelegenen Karstgebieten weiße
Steine, die wahrscheinlich das dominierende Weiß in meinen dort entstandenen
Bildern hervorriefen. Teneriffa ist vulkanischen Ursprungs. Die schwarzen Lavafelder
und die dunklen bräunlichen bis ockerfarbenen Berge fangen jetzt schon an, das
Weiß aus meinen
Bildern zu
verdrängen. Ganz scheint dieser Vorgang noch nicht abgeschlossen zu sein, ich kann nichts Endgültiges darüber sagen. Das
Sonnenlicht ist auf Teneriffa heller als auf Cres, so daß auch das flirrende
Licht in manchen meiner Bilder sich bereits mit helleren Farben Einfluß zu
verschaffen scheint.
Viele
Veränderungen in meinen Arbeiten sind seit unseren ersten Aufenthalten in San
Andres aufgetreten. Ob sie alle auch auf die Einwirkungen der Insel zurückzuführen
sind, muß offen bleiben. Auch der Maler selbst verändert sich ständig, und alle
anderen Veränderungen wie Wohnungswechsel, neue Reiseziele, neue Bildthemen
usw. sind womöglich eine Folge davon.
Der
menschliche Kopf, der in Bildern vor dem Zweiten Weltkrieg schon wegen der
vielen Portraits eine große Rolle gespielt hatte, verschwand nach dem Krieg
fast ganz, tauchte 1965 wieder auf, wurde aber sofort hinter Gliedmaßen oder
Händen versteckt (Abb. 11 und 13), um schließlich noch als überschnittene
schwarze Kreisform hervorzugucken und schließlich ganz zu verschwinden. Im
Bild "Der kranke Maler" tauchte er wieder offen auf (Abb. 15) und war
dann in den Jahren 1980 und 1981 in einer Reihe von Janusbildern als Doppelkopf
zu sehen. Die Zweigesichtigkeit des Januskopfes wurde dann in der Reihe der
Zeitgenossenbilder zur Vielgesichtigkeit (1981-1984). Diese Entwicklung kann
man anhand der Abbildungen in den Ausstellungskatalogen von 1980, 1985 und 1989
lückenlos nachvollziehen.
Die
Ausstellung, in der diese Reihe von Bildern hauptsächlich gezeigt wurde,
erhielt die Bezeichnung "Die vielgesichtigen Zeitgenossen". Diese
Bilder sind keine Portraits, sie versuchen vielmehr, die Vielfalt des einzelnen
Menschen zu zeigen, ohne einen bestimmten zu meinen. Sie behaupten, daß der
Mensch verschiedene Gesichter parat hält, die er bei passender Gelegenheit
herausholt, daß zwar jeder sein Fotografiergesicht hat, das ohnehin jeder
kennt, daß er aber sein "wahres" Gesicht dahinter versteckt, so daß
das von ihm gezeigte Gesicht eine Maske, eine Tarnung ist. Auch kann die
Vielgesichtigkeit zeigen, daß wir es mit jemanden zu tun haben, der
verwandlungsfähig ist, der sein Gesicht seinem Tun, seinen Reden, seinen
Emotionen anpaßt, oder mit jemandem, der hinter seinem schwammigen und weichen
Gesicht seinen eisernen Charakter verbirgt oder umgekehrt. Die
Zeitgenossenbilder signalisieren die Undurchschaubarkeit des Menschen, sie
zeigen auf das Rätsel Mensch, auf dessen Hebens- und fürchtenswerte
Variationsfähigkeit.
DieZeitgenossen werden 1985 bis 1986 "durch so etwas
wie Situationsschilderungen ersetzt und nun beim 'Warten' gezeigt oder bei
einem 'Gescheiterten Flugversuch'. Zum vorläufigen Abschluß sind zwei sehr merkwürdige
und nur anscheinend deplazierte Reiterbilder entstanden. Die beiden großen
Reiter in einer doch so gut wie pferdelosen Gesellschaft tragen einmal einen
Weihnachtsstern, das andere Mal einen Wassereimer in der Hand, als sei es der
letzte Weihnachtsstern, der aufgeblüht, das letzte Wasser, das geschöpft worden
ist.... der Reigen der Zeitgenossen, so heiter er mitunter wirkt, endet im
Totentanz." (Heinz Ohff im Katalog 1985).
Hiernach entstanden noch vier solcher Situationsschilderungen:
"St. Lukas im Gehaus", "Aufstieg eines Malers", "Tanz
mit dem Popanz", "Tanz mit dem Idol". In der folgenden Reihe von
Bildern, die man noch den Zeitgenossenbildern zurechnen kann, tauchten ein
"Gespaltener" auf und ein "Turm der hohlen Köpfe" (1986).
Während die Köpfe der Zeitgenossen trotz ihrer Vielge- sichtigkeit noch
zweifellos als lebensfähig aufgefaßt werden konnten, handelte es sich jetzt um
zerstörte, kaputte, jedenfalls um Köpfe, deren Besitzer damit nicht leben
können.
Der von Heinz Ohff angesprochene Totentanz begleitete mich
also weiter, und 1987 geriet ich selbst durch meine Krebserkrankung mitten in
ihn hinein. Matt und ziemlich kraftlos fing ich nach dem langen Krankenhausaufenthalt
wieder an zu malen. Vier Köpfe auf kleinem Format (ca. 46 x 34) schlössen sich
wiederum den Vielgesichtigen an, aber auf eine neue Weise: Die
Vielgesichtigkeit spielte sich jetzt innerhalb eines Gesamtkopfumrisses ab,
nicht mehr in mehreren Teilköpfen.
Um mit den geringen Kräften hauszuhalten, hatte ich den
Einfall, sehr kleine Bilder zu malen. Ich durchsuchte meine Lumpenkiste, aus
der sich meine Mallappen rekrutieren, und schnitt die geeigneten Kleider- und
Stoffreste großzügig in kleine Rechtecke in Postkartengröße, auch größere und
kleinere. Ich grundierte sie so, daß um die weiße Mal fläche
noch ein etwa ein Zentimeter breiter Streifen der ausfransenden Stoffe stehenblieb.
Ich hatte damit Formate gefunden, die meine noch vorhandenen Kräfte nicht
überforderten. Ich nannte diese nun in schneller Folge entstehenden Bilder
"Lumpenbilder". Fast jeden Tag oder alle zwei Tage war ein kleines
Bild fertig. Meine Phantasie wurde dabei beflügelt, und ich war um Einfälle
nicht verlegen. Und durch die anspruchslose Winzigkeit und ihre ausgefranste
Armseligkeit zeigten die Resultate einen gewissen Charme. Trotz ihres harmlosen
Habitus brachten sie weitere kaputte Köpfe zum Vorschein: den Verkehrtkopf,
den Querkopf und den Spaltkopf. Andere Köpfe wiederum waren senkrecht,
waagerecht oder kreuz und quer zerschnitten, sie waren zerhackt, bekamen
schließlich kleine oder größere Löcher, so daß man durchschauen konnte, und
zerfielen. Sie versuchten, sich hinter Masken, Gesichtshalftern, Fensterkreuzen
und Vorhängen zu verstecken, und endeten in Kopfkäfigen. Größere und kleinere
Bilder mit Titeln wie "Der perforierte Mann" oder
"Durchlöcherter Doppelkopf' entstanden, einem "Trinker" wurde
der Kopf zum hohlen Gefäß, "Kartenspieler" entpuppten sich als
Veikehrtkopf, Querkopf und Fastnormalkopf, und schließlich wurde jemandem ein
"Gratulationsstrauß für das Loch im Kopf' überreicht.
Nebenher und später ausschließlich entstanden auf getönten
Ingresblockpapieren Zeichnungen, auch farbige, auf denen der menschliche Kopf
hinter Drahtgewirr und Maschendraht, hinter und in Spiralen, hinter roten Fransen,
hinter Buntkariertem oder hinter einem Doppelkreuz sich versteckte. Oder er
war einäugig oder auf sämtlichen Augen blind, er war gezeichnet, markiert,
gebrandmarkt oder numeriert, er wurde gespalten, eingekastelt oder
viergeteilt, befand sich im Dunst oder war umwölkt, fiel dann auseinander oder
bestand nur noch aus Kopfresten und ging schließlich ganz verloren und lag vor
dem kopflosen Körper auf dem Tisch.
Diese Reihe von ungefähr 40 Zeichnungen hat mich viel
Durchstehvermögen und Kraft gekostet. Der Anblick so vieler verletzter,
behinderter, zerstörter und mißhandelter Köpfe, die schließlich alle Wände
meines winzigen Ateliers bedeckten, wurde lästig und quälend, sogar
beunruhigend. Was mögen wohl die Gründe und Ursachen sein, die mich dazu
brachten, dieses Panoptikum kaputter, verletzter und behinderter Menschen zu erstellen?
Sieht der augenblickliche Zustand des Menschen so aus, ist er vielleicht immer
so gewesen, oder erwartet er uns in der Zukunft? Oder habe ich da eine Tragikomödie
verfaßt? Während ich daran arbeitete, kamen mir diese Gedanken kaum, höchstens
blitzlichtartig, um sofort wieder zu verschwinden. Das Machen stand mit seinen
Höhen und Tiefen, mit seinen begeisternden Bestätigungen und deprimierenden
Unmöglichkeiten im Vordergrund meines Bewußtseins.
Die Ausstellung, in der ich 1989 diese Arbeiten vorstellen
konnte, verdanke ich wieder dem Fördererkreis Kulturzentrum Berlin und meinem
Freunde Jule Hammer, auch seinem Mitarbeiter Axel Sommer, der die
ausgezeichnete Hängung bewerkstelligte. Für die Gestaltung des Katalogs habe
ich mich bei meinem Kollegen und Freund Heinz-Jürgen Kristahn und für das
Vorwort dazu bei Rainer Höynck zu bedanken. Während bisher bei meinen
Ausstellungen nur ein bis zwei Zeitungen darüber schrieben, erschienen diesmal
in allen Berliner Zeitungen überraschend lange und sehr positive Artikel mit je
einer großen Abbildung, in einem Fall mit einer sehr großen farbigen. Acht
Bilder und eine Zeichnung wurden verkauft. Rochus Selbst verbuchte einen
kleinen Erfolg, seine Frage, was nach meinem Tode mit unseren Bildern werden
solle, blieb weiter offen.
Für den letzten Satz bin ich dem Leser noch eine Erklärung
schuldig. In ihm tritt neben den Verfasser eine neue, eine andere Figur: Rochus
Selbst. Zu Beginn meiner Lebensbeschreibung war der Name Rochus im
Zusammenhang mit meiner Taufe aufgetaucht. Ich habe oft in
meinem Leben daran gedacht, daß der Name Rochus Thoma für einen Maler
werbewirksamer sein könnte als der vergleichsweise bürgerlich klingende Helmut
Thoma.
1984, als ich diese Niederschriften glaubte abgeschlossen
zu haben, malte ich auf der Insel Cres ein großes "Selbstbildnis" im
Sinne der Zeitgenossenbilder. Auf ihm sind zwei stehende (halbe) Figuren zu
sehen, die offenbar durch eine Umarmung ihre Zusammengehörigkeit zeigten,
andererseits aber durch einen schwarzen Spalt getrennt sind. Die linke
Figurationshälfte stellt einen Maler dar, der an einer Staffelei arbeitet, die
vor einer Landschaft mit Meer, Wolken, Mond und Sternen steht. Ein schwarzer
Profilkopf und eine aus den Wolken hervorbrechende Augenhand scheinen in das
entstehende Bild einzugreifen. Der Maler hält schon die nächste Leinwand
bereit. Auf seiner Hose ist eine mittelmeerische Welt aufgedruckt mit Sonne,
Schafskopf, Fisch und Früchten.
Die rechte Hälfte der Figuration zeigt einen Zivilisten mit
Hut und Aktentasche mit einer tiefhängenden pinselhaltenden Hand, mit einem
linken Arm ohne die Hand, die offenbar einen Stuhl ergreifen oder festhalten
wollte, auf dessen Rückenlehne die Buchstaben K und P zu sehen sind, auf dem
aber zu sitzen oder auszuruhen unmöglich ist, weil die Sitzplatte fehlt, und
unter dem irgendwelche unbeachteten Früchte liegen, die durch die Sitzöffnung
gefallen sind. Hinter dem Zivilisten quirlt ein Durcheinander von Köpfen,
Fratzen und Händen, eine Hand hält in Schulterhöhe der Figuration ein Buch
hoch, auf dem die Worte Selbst und Biographie undeutlich zu erkennen sind.
(Das Bild ist im Ausstellungskatalog 1985 mit der Katalognummer 48 abgebildet
und heißt "Bildnis des Malers Rochus Selbst").
Ob dieses mit Gedanken überfrachtete Bild gut oder schlecht
ist, bleibe dahingestellt. Es ist aber ein Bild, das den Namen Rochus Selbst
hinreichend erklären kann, der hier zum ersten Male in einem Bildtitel
auftaucht. Spätere Bilder, die in die Nähe eines Selbstbildnisses gerieten,
habe ich immer mit diesem Namen bezeichnet, auch wenn sie nur vage
selbstbiographische Züge zeigten. Deswegen sein Familienname
"Selbst".
Das Bild zeigt den Zustand, in dem sich mein Leben zwischen
1930 und 1974 abspielte. Ich fühlte mich als Maler, konnte aber nur meine halbe
Kraft dafür einsetzen, die andere Hälfte - sicher war es oft mehr! - gehörte
der Kunstpädagogik. Ich fühlte mich deswegen nicht als Gespaltener, obgleich
mein Leben tatsächlich zweigeteilt verlief. Denn die Kunst ist in einem tiefen
Sinne pädagogisch gerichtet, und der Pädagoge wird oft auch Menschen-Bildner
genannt. Das bekannte Wort von den zwei Seelen, die in einer Brust wohnen, spielt
auch hier mit hinein.
Rochus Selbst ist sicher der selbstsicherere, der selbständigere
und eigenwilligere Teil meiner Selbst. Er hat nie gefragt, was er tun soll, er
hat es immer gewußt. Auch seine Irrwege ist er selbstbewußt gegangen, ohne sie
später zu bereuen. Er verdient also auch deswegen den Familiennamen
"Selbst".
In den letzten Jahren sind auch einige Bildnisse im üblichen
Sinne vor dem Spiegel entstanden. Diese habe ich mit dem Wort Selbstbildnis
bezeichnet. Im vorigen Jahr entstand das Bild "Rochus hinter
Scherben" (Abb. auf vorderem Umschlag). Rainer Höynck schreibt im Katalog
zur Ausstellung 1989:"... faszinierend ist 'Rochus hinter Scherben'.
Surreal, glasklar, psychoanalytisch."
Rochus Selbst kann sich also auch solche Attribute zulegen, was
ich, der Schreiber, mir nicht zutrauen würde. Sicher weiß er auch, was hinter
ihm das Schwarz, die Nichtfarbe, bedeutet. Vielleicht deutet er auch die
herunterfallenden Scherben auf seine Weise. Für mich sind sie der Beweis, daß
die Faszination der Insel Cres verblaßt ist. Rochus sieht sicher zwischen den
herabprasselnden Scherben schon neue Bilder. Er hat jetzt, nachdem ich den
guten Anzug, den Hut und die Aktentasche schon lange abgelegt habe, die
Führung endgültig übernommen. Ich spüre das Alter schon deutlich. Er ist
darüber erhaben. Und solange ich seine Stimme hören und seinen Anweisungen
folgen kann, werden wir weiter unsere Bilder malen.
Hubertus Losow in der Zeitschrift »Schlesien«,
1963, Jahrgang VIII, Heft 3; Seite 175: Helmut Thoma und Gerhard Fietz. Zwei
schlesische Maler in Berlin.
t
Heinz Ohff im Katalog zur Ausstellung in der Galerie Hammer
Berlin, 1967.
Eberhard Roters im Katalog zur Retrospektiv-Ausstel- lung in der
Kunsthalle Wilhelmshaven, 1969.
»Kunst in Berlin«, Belser Verlag, 1969, Seite 225,300, 311.
Giambattista Basile: »Das Märchen
aller Märchen, 1/ 6«, und Helmut Thoma: 12 Scheuchen«,Henstedter Handdruck
Verlag, 1970.
Hubertus Lossow im »Werkverzeichnis der Collagen 1953 bis 1970«,
herausgegeben 1972 vom Kunstamt Reinickendorf.
Heinz Ohff: »Cres malt« im Katalog
zur Ausstellung »Bilder und Zeichnungen aus den Jahren 1964 bis 1979« im Haus
am Lützowplatz Berlin. Im gleichen Katalog »Die Insel Cres« (Aus autobiographischen
Notizen) von Helmut Thoma.
Heinz Ohff: Ȇbersiedlung zum
Zeitgenossen« im Katalog zur Ausstellung »Die vielgesichtigen Zeitgenossen»
(Bilder, Aquarelle, Collagen, Zeichnungen aus den Jahren 1980-1985), herausgegeben
vom Kunstamt Berlin-Reinickendorf, 1985.
Rainer Höynck: »Der Kopf ist wieder da!« im Katalog zur Austeilung »Menschen, Köpfe und Gesichter«
(Bilder, »Lumpenbilder« und Arbeiten auf Papier aus den Jahren 1986-89).
Bibliographie 86 Abbildungen 87 -105
I. Rochus Selbst hinter Scherben, 1989,
Aquatec 15. auf Leinen, 100 x 81,(1142)
II. Selbstbildnis mit Tonpfeife, 1936, Öl auf
Nessel, 53 x 43, (24)
1. Felgner, Breslauer Lumpensammler, 1931,
Holzkohle auf dickem Zeichenpapier, 62,5x51,(1/31)
2. Bildnis Marion, 1938, Öl auf Pappe, 66,5 x
56,5, (32)
3. Der Zinnkrug und die Obstschale, 1948, Öl
auf Pappe, 44 x 58,5, (52)
4. Der Kreuzritter, 1954, Öl auf
Dekorationsstoff, 90 x 50, (207)
5. Cres-Felsenschrift, 1960, Öl auf
Dekorationsstoff, 96 x 70, (40)
6. Pinselzug, 1962, Öl auf Zeichenpapier,
150x41,(509)
7. Dünenkopf, 1963, Öl auf Zeichenpapier, 150
x 65, (54)
8. Meer und Düne, 1963, Öl auf Zeichenpapier,
65 x 150, (614)
8a. Knieende Frau mit Tuch, 1964, Öl auf
Zeichenpapier, 150 x 65, (678)
9. Vorfahre einer Nereide, 1964, Collage aus
Illustriertenausschnitten, 28,5 x 27,5, (Collage 116)
10. Nereide Cres, 1965, Dispersions- und Ölfarbe
auf Leinwand, 205 x 155, (706)
11. Schlafende Venus, 1965, Dispersionsfarbe auf
Leinen, 132 x 175, (722)
12. Strandläuferin, 1966, Dispersionsfarbe auf
Leinen, 50 x 65, (746)
13. Kopf hinter Händen, 1976, Holzkohle auf
Zeichenpapier, 59 x 42, (76/3)
14. In den Händen der Wegelagerer, 1979, Aquatec
auf grünem Leinen, 95 x 75, (944)
15. Der kranke Maler, 1979, Aquatec auf Leinen,
80 x 105, (943)
16. Haupt- und Nebenköpfe, 1986, Aquatec auf
Leinen, 99,5 x 80, (1038)
17. Zeitgenosse am Tisch, 1982, Aquatec auf Jute,
95 x 125,(965)
18. Familienportrait oder Vorsicht! Individuen,
1988, Aquatec auf Jute, 116 x 89, (1098)

- Felgner, Breslauer Lumpensammler, 1931, Holzkohle auf
dickem Zeichenpapier, 62,5 x 51, (1/31)

2. Bildnis Marion, 1938, Öl auf Pappe, 66, 5 x 56,5, (32)
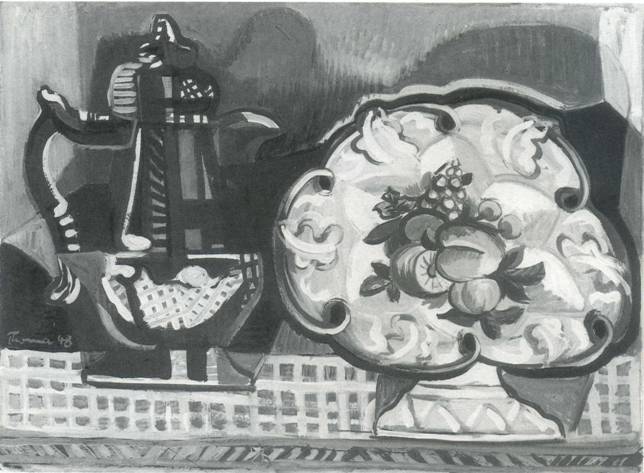
-
Der Zinnkrug und die Obstschale, 1948, Öl auf Pappe, 44 x 58,5,
(52)
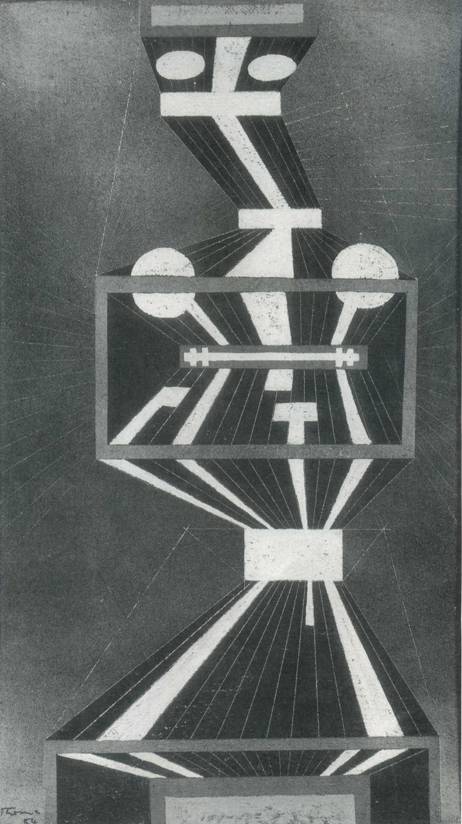
- Der Kreuzritter, 1954, Öl auf
Dekorationsstoff, 90 x 50, (207)

- Cres-Felsenschrift, 1960, Öl auf
Dekorationsstoff, 96 x 70, (406)
Mein Leben – Eine Collage

- Pinselzug, 1962, Öl auf
Zeichenpapier, 150 x 41, (509)

- Dünenkopf, 1963, Öl auf
Zeichenpapier, 150 x 65, (54)

- Meer und Düne, 1963, Öl auf
Zeichenpapier, 65 x 150, (614)

8a. Knieende Frau mit Tuch, 1964, Öl auf
Zeichenpapier, 150 x 65 (678)

9. Vorfahren einer Nereide, 1964, Collage aus
Illustriertenausschnitten, 28,5 x 27,5, (Collage 116)

- Nereide Cres, 1965, Dispersions- und
Ölfarbe auf Leinwand, 205 x 155, (706)
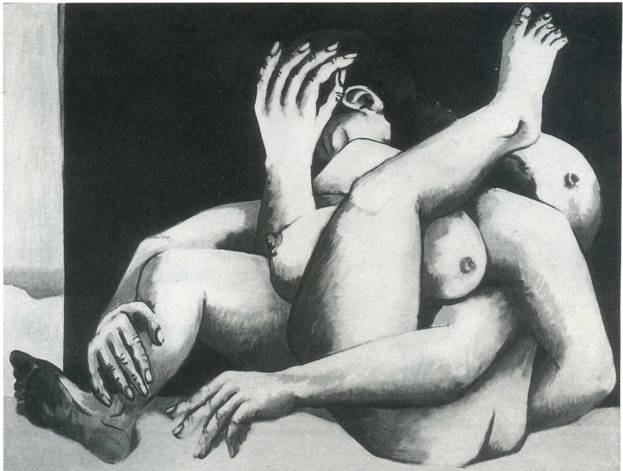
11. Schlafende
Venus, 1965, Dispersionsfarbe auf Leinen, 132 x 175, (722)
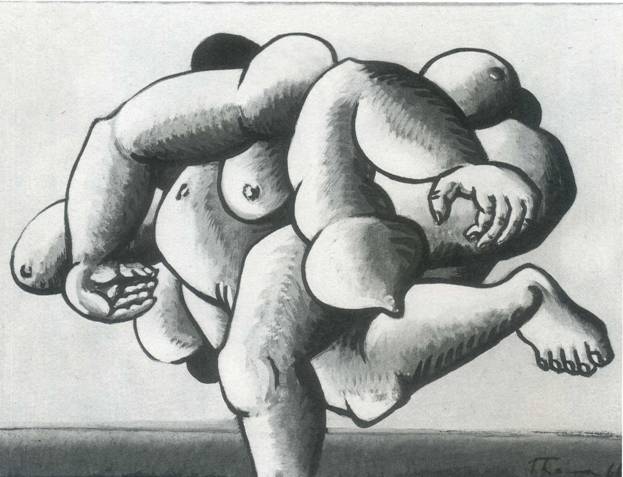
12.
Strandläuferin, 1966, Dispersionsfarbe auf
Leinen, 50 x 65, (746)

13.
Kopf hinter Händen, 1976, Holzkohle auf
Zeichenpapier, 59 x 42, (76/3)

14.
In den Händen der Wegelagerer, 1979, Aquatec auf
grünem Leinen, 95 x 75, 944
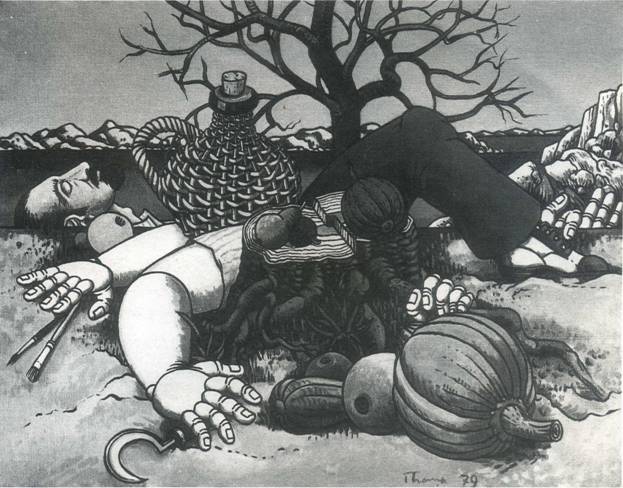
15.
Der kranke Maler, 1979, Aquatec auf Leinen, 80 x
105, (943)


16.
Haupt- und Nebenköpfe, 1986, Aquatec auf Leinen,
99,5 x 80, (1038)

17.
Zeitgenosse am Tisch, 1982, Aquatec auf Jute, 95
x 125, (965)
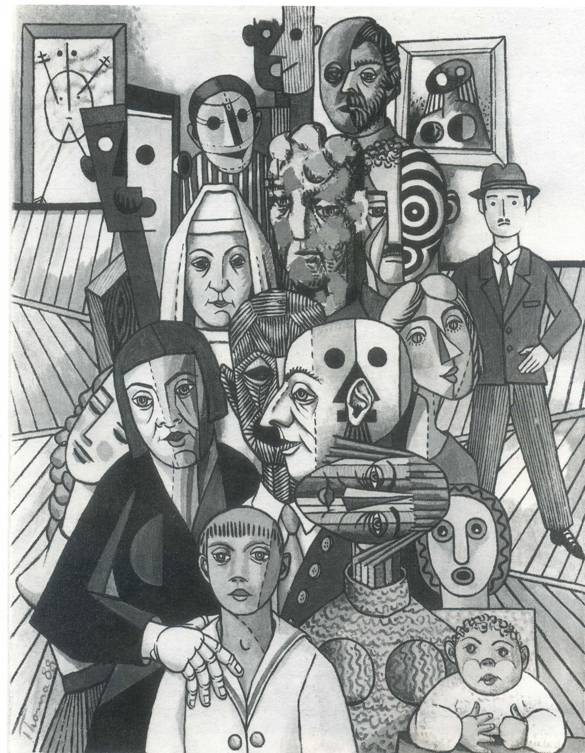
18. Familienportrait oder Vorsicht! Individuen,
1988, Aquatec auf Jute, 116 x 89, (1098)
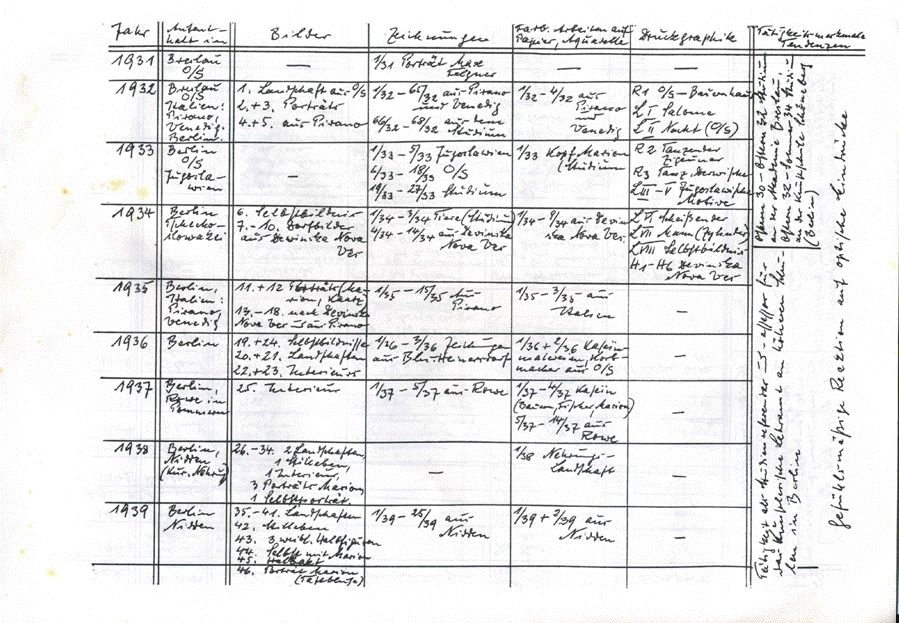
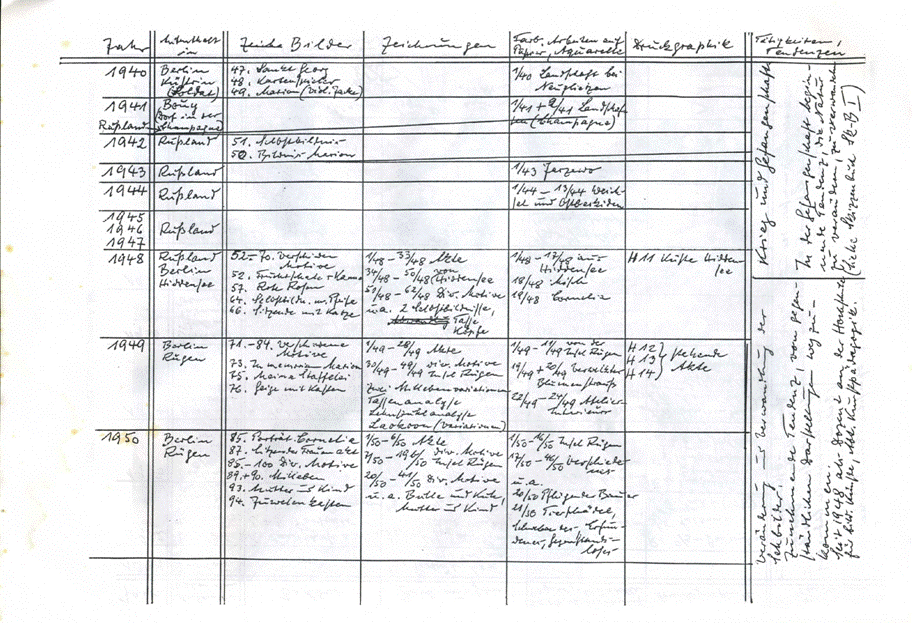
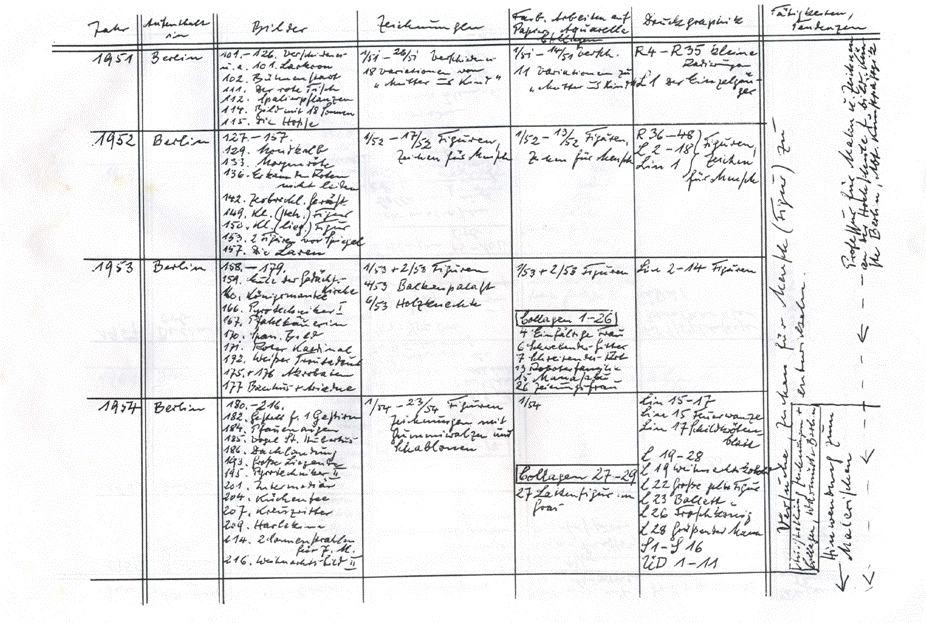
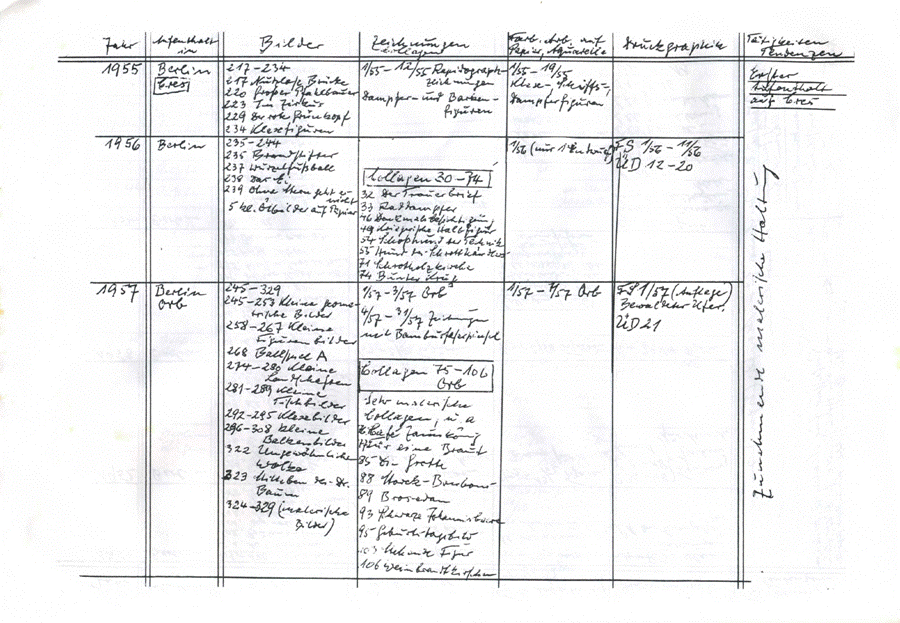
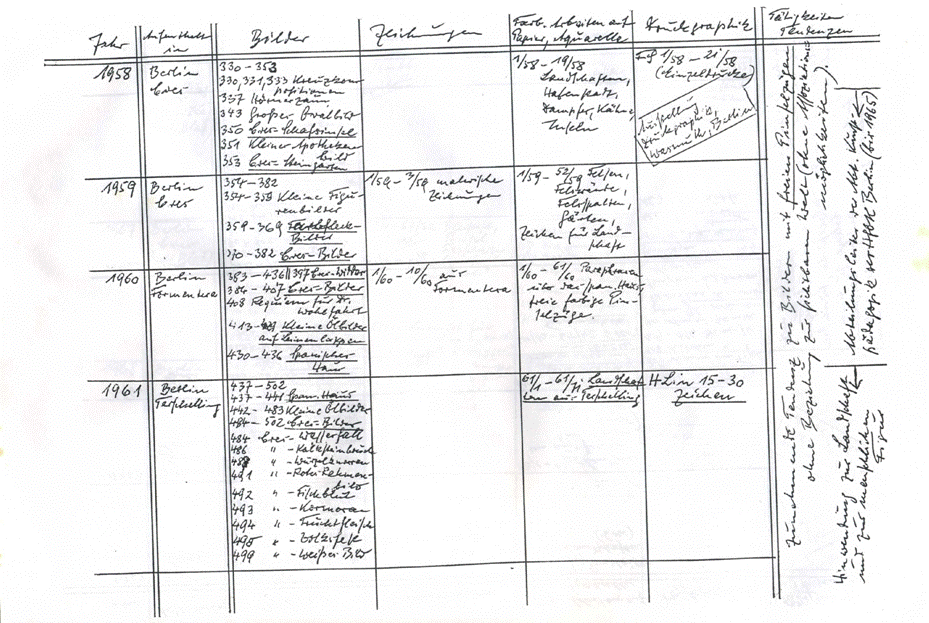
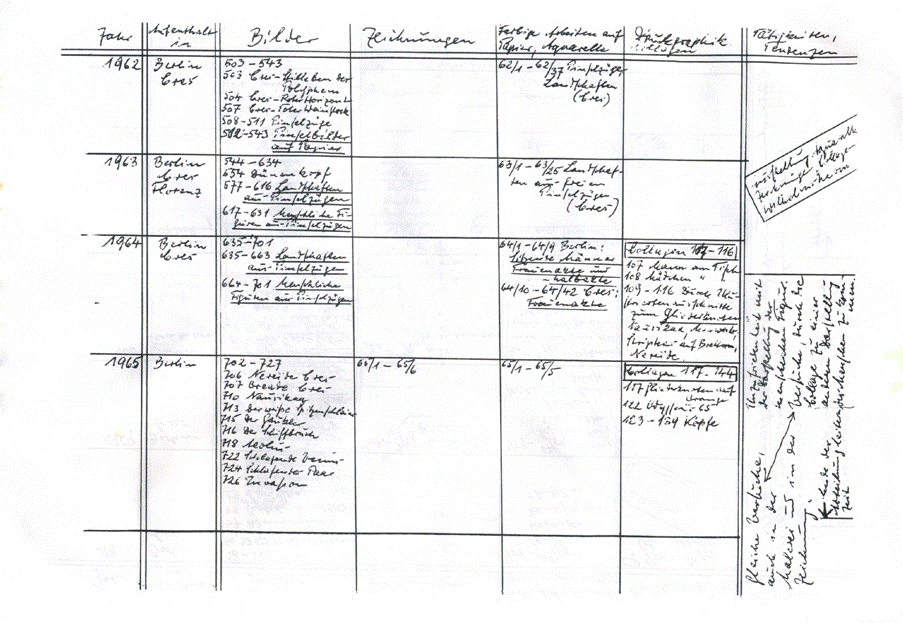
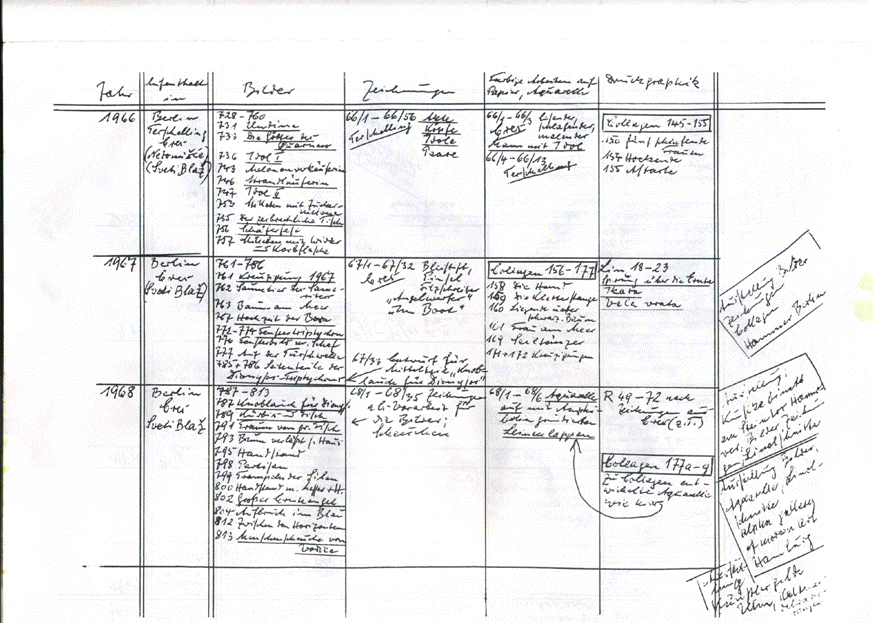
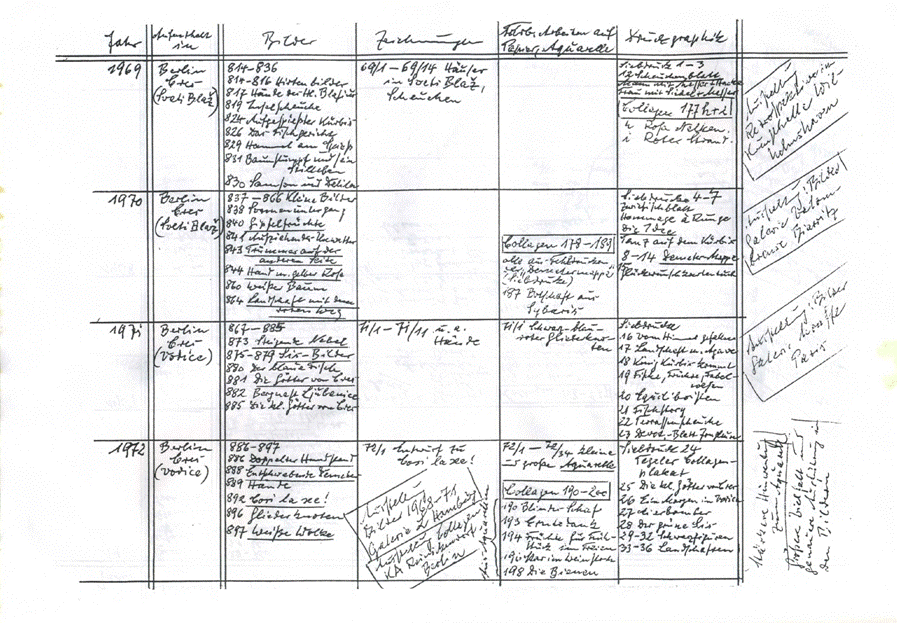
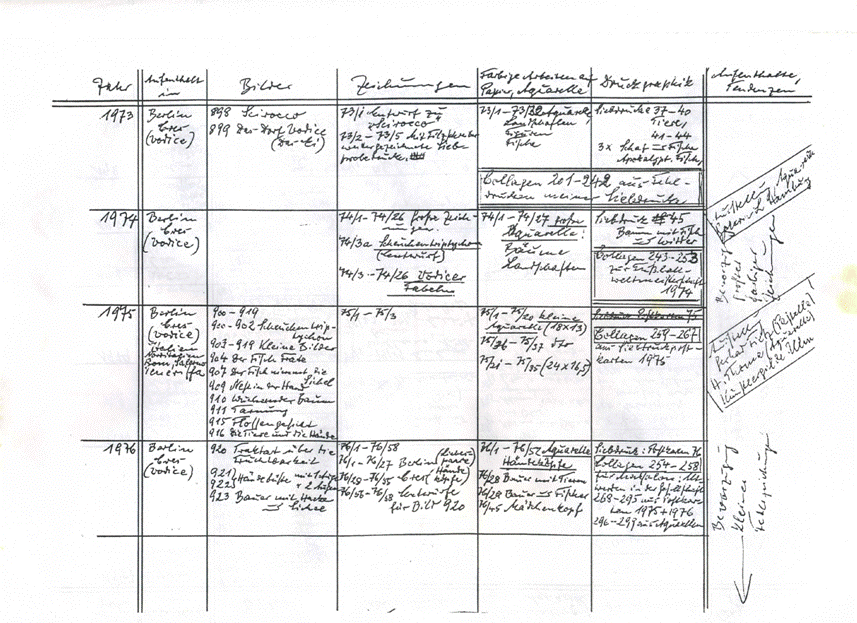
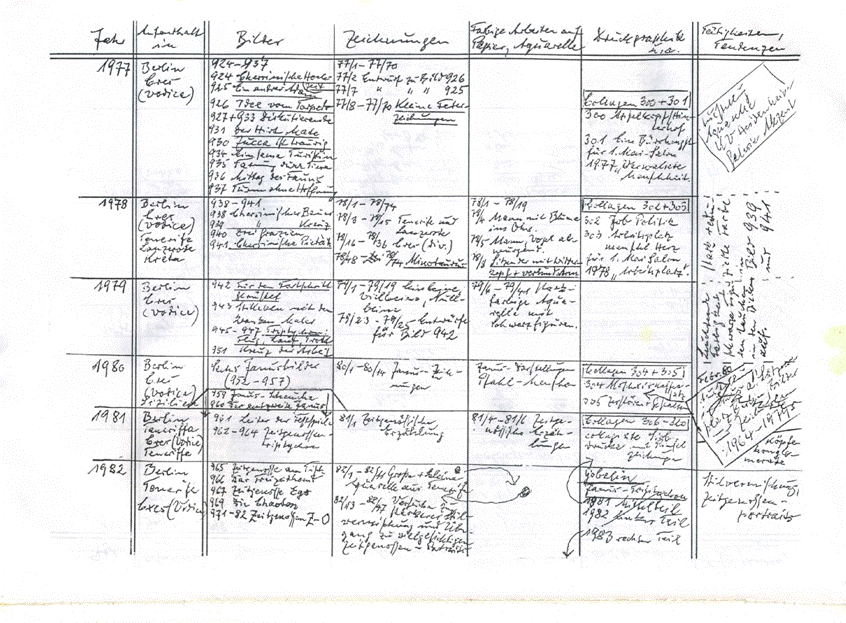
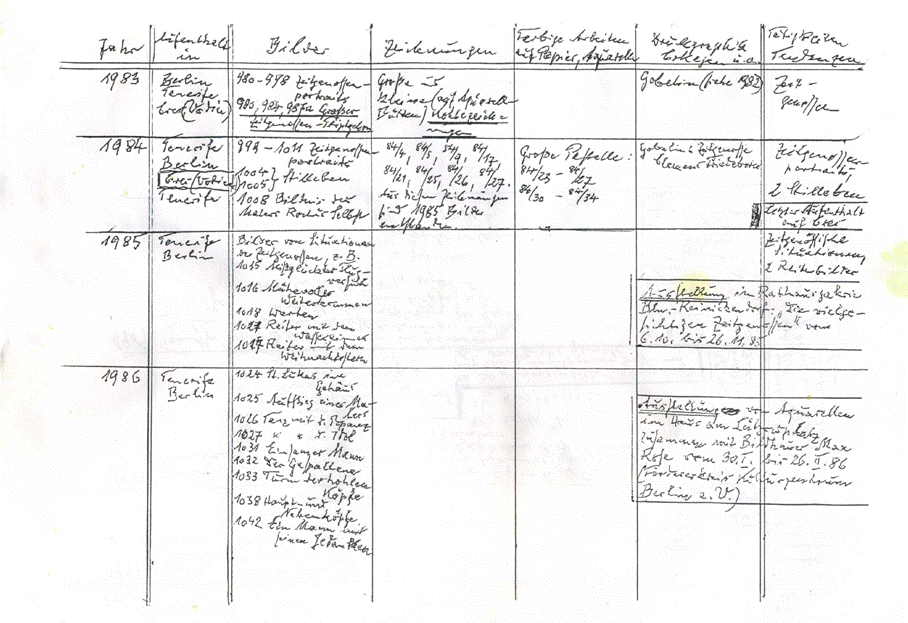
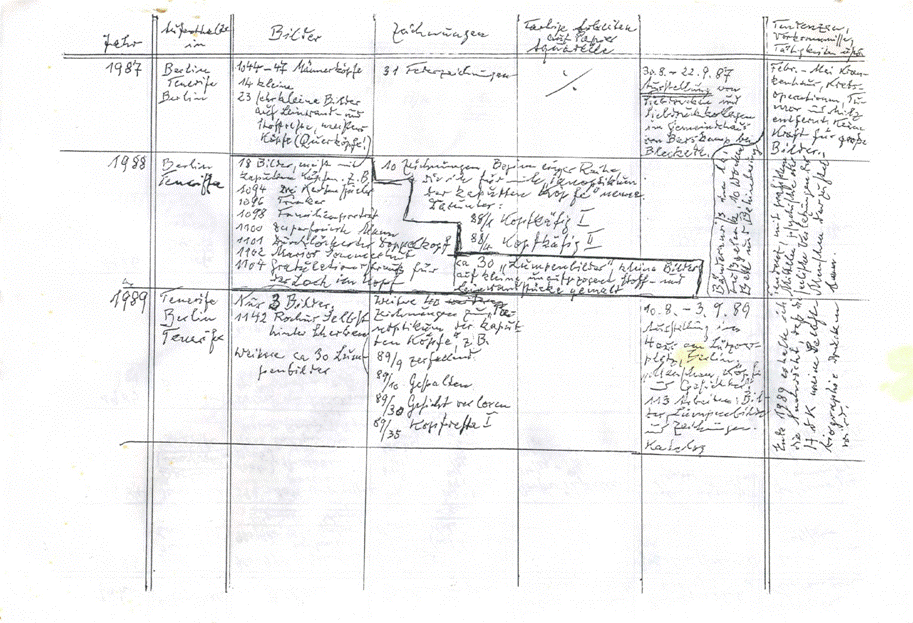
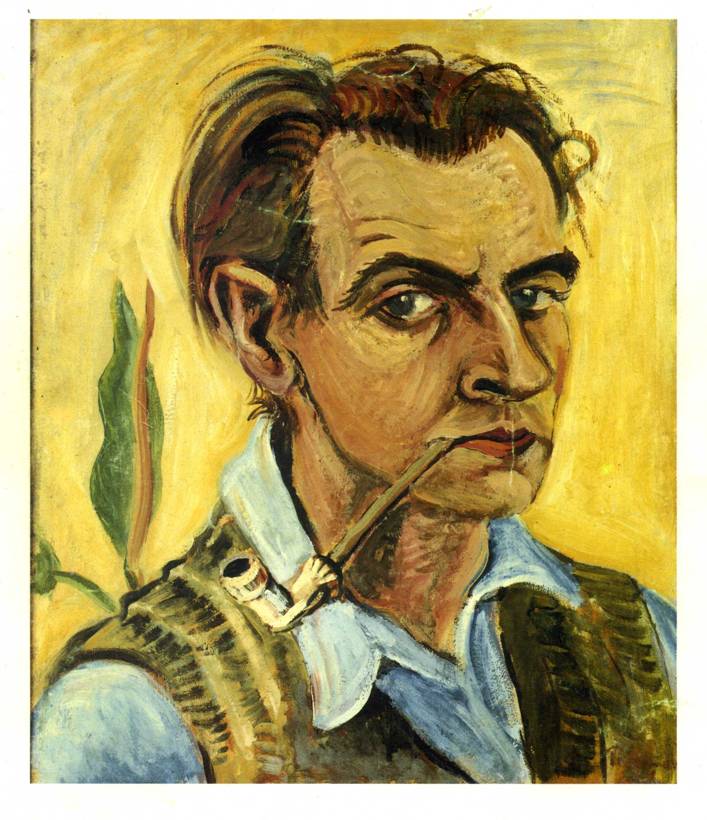
Zurück
Helmut-Thoma-Stiftung an der
Universität der Künste Berlin
Wikipedia Artikel Helmut
Thoma Maler
Weitere Werke von Helmut
Thoma
Helmut Thoma – Sein größtes Bild: Cosi
la xe – So ist das Leben
Ulrich Thoma
Nordseeurlaub im Haus Bernstein